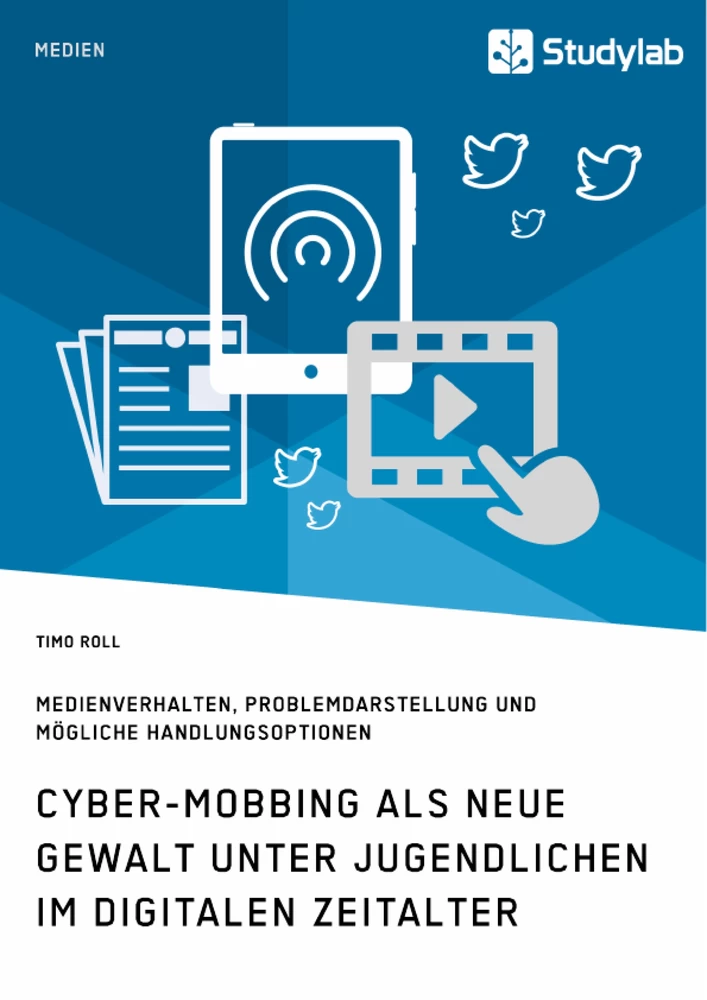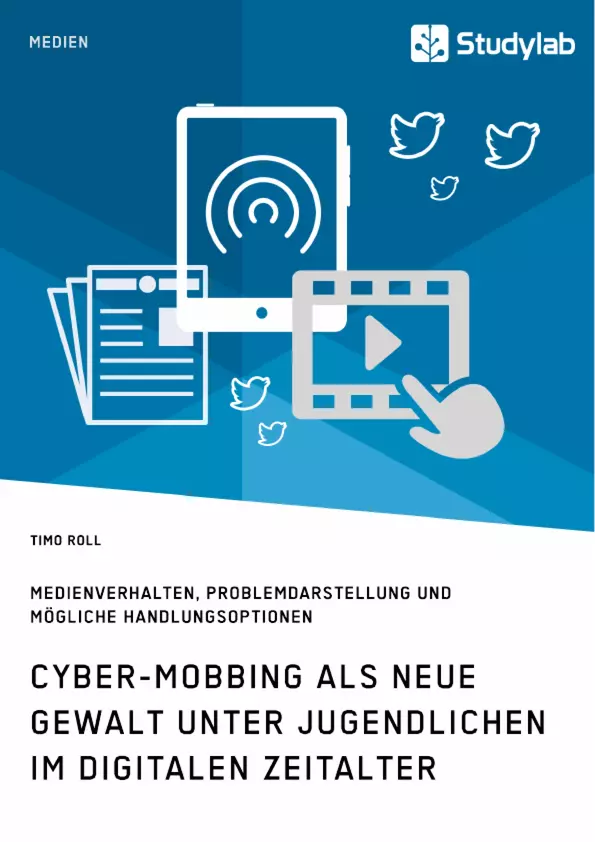Mobbing unter Schülern gibt es schon lange, durch die Sozialen Medien verlagert es sich jedoch mittlerweile vom Schulhof in die Kinderzimmer. So entwickelt das Mobbing eine ungeahnte Qualität. Das Internet verkommt zu einem Ort, an dem andere als sozialer Mülleimer missbraucht werden - und jeder kann es sehen beziehungsweise mitlesen.
Diese Arbeit behandelt die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt um sowohl präventiv als auch in der konkreten Situation jungen Menschen zu helfen. Des Weiteren wird erörtert, welchen Stellenwert die Soziale Arbeit dabei einnehmen kann oder sogar muss.
Zu Beginn der Arbeit soll zunächst die heutige Jugendkultur „Generation Social Media“ vorgestellt werden um im Anschluss daran deren Medienverhalten genauer zu beleuchten.
Da die sozialen Medien wie WhatsApp und Facebook und die davon ausgehende Kommunikation bei Jugendlichen hoch im Kurs stehen, befasst sich diese Arbeit mit der computervermittelten Kommunikation. Es sollen die Grundlagen sowie die Besonderheiten der digitalen Kommunikation und deren Zusammenhang mit Cybermobbing erläutert und vorgestellt werden.
Dazu werden Cybermobbing und Parallelen zum traditionellen Schulmobbing vorgestellt. Um diese Parallelen erkennen und verstehen zu können, ist es zunächst wichtig, traditionelles Mobbing unter Schülern kurz zu definieren und die wichtigsten Basics zu benennen, um danach auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede einzugehen. Nach einer Definition des Phänomens „Cybermobbing“ werden die Methoden und deren Straftatbestände herausgearbeitet, sowie die verschiedenen Akteure vorgestellt und beschrieben.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit sind die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Akteure Schule, Sozialarbeiter*in, Betroffene und Erziehungsberechtigte. Besonderes Augenmerk liegt hier auf den möglichen Interventions- und Präventionsmaßnahmen der Sozialen Arbeit und dem Peer-to-Peer-Konzept.
Aus dem Inhalt:
- Cybermobbing;
- Social Media;
- Medienverhalten;
- Soziale Arbeit;
- Intervention;
- Prävention
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1 „Jugend 2.0“
- 1.1 Der Generationsbegriff
- 1.2 Social Media
- 1.3 Generation „Social Media“ ein Erklärungsversuch
- 2 Mediennutzung der Generation „Social Media“
- 2.1 JIM-Studie 2015
- 2.2 Medienkompetenz
- 3 Online-Kommunikation
- 3.1 Was ist Kommunikation
- 3.2 Computervermittelter Kommunikation (CvK)
- 3.3 Grundlegende Unterschiede zwischen computervermittelter Kommunikation und der Face-to-Face-Kommunikation
- 3.4 Theorien der computervermittelten Kommunikation
- 4 Cybermobbing
- 4.1 Traditionelles Mobbing unter Schülern
- 4.2 Cybermobbing ein Definitionsversuch
- 4.3 Besonderheiten
- 4.4 Methoden
- 4.5 Rechtliche Folgen
- 4.6 Die Beteiligten
- 5 Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit und anderer Akteure
- 5.1 Handlungsmöglichkeiten von Schule
- 5.2 Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit bzw. der Sozialen Arbeit
- 5.3 Handlungsmöglichkeiten der betroffenen Personen
- 5.4 Handlungsmöglichkeiten und Prävention durch Medien
- 5.5 Handlungsmöglichkeiten Erwachsener von betroffenen Jugendlichen
- 6 Zusammenfassung
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Cybermobbing unter Jugendlichen im digitalen Zeitalter. Sie beleuchtet das Medienverhalten der Generation „Social Media“, analysiert die Besonderheiten von Cybermobbing im Vergleich zu traditionellem Mobbing und untersucht die rechtlichen Folgen sowie die Handlungsmöglichkeiten verschiedener Akteure, wie Schule, Sozialarbeit und Medien.
- Mediennutzung und Medienkompetenz von Jugendlichen
- Besonderheiten von Cybermobbing im Vergleich zu traditionellem Mobbing
- Rechtliche Folgen von Cybermobbing
- Handlungsmöglichkeiten von Schule, Sozialarbeit und anderen Akteuren
- Prävention von Cybermobbing
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Cybermobbing ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Kapitel 1 beleuchtet den Generationsbegriff „Jugend 2.0“ und die Rolle von Social Media im Leben junger Menschen. Kapitel 2 analysiert die Mediennutzung der Generation „Social Media“ anhand der JIM-Studie 2015 und untersucht den Zusammenhang mit Medienkompetenz. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Online-Kommunikation und ihren Besonderheiten im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation. Kapitel 4 definiert Cybermobbing, beleuchtet seine Besonderheiten und Methoden sowie die rechtlichen Folgen. Kapitel 5 untersucht verschiedene Handlungsmöglichkeiten von Schule, Sozialarbeit, betroffenen Personen, Medien und Erwachsenen, um Cybermobbing zu begegnen und zu präventieren.
Schlüsselwörter (Keywords)
Cybermobbing, Jugend, Social Media, Mediennutzung, Medienkompetenz, Online-Kommunikation, Computervermittelte Kommunikation, Rechtliche Folgen, Handlungsmöglichkeiten, Schule, Sozialarbeit, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Cyber-Mobbing von traditionellem Mobbing?
Cyber-Mobbing findet im digitalen Raum statt, ist oft rund um die Uhr sichtbar und erreicht ein größeres Publikum. Es verlagert die Gewalt vom Schulhof direkt in den privaten Raum (Kinderzimmer).
Welche Rolle spielen soziale Medien bei Jugendlichen?
Für die „Generation Social Media“ sind Plattformen wie WhatsApp und Facebook zentrale Orte der Kommunikation und Identitätsbildung, was sie jedoch auch anfällig für digitale Gewalt macht.
Welche rechtlichen Folgen kann Cyber-Mobbing haben?
Cyber-Mobbing kann verschiedene Straftatbestände erfüllen, wie z.B. Beleidigung, Üble Nachrede oder die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch die Verbreitung von Fotos.
Wie kann die Soziale Arbeit bei Cyber-Mobbing helfen?
Sozialarbeiter können durch Präventionsprojekte, das Peer-to-Peer-Konzept und konkrete Interventionsmaßnahmen sowohl Betroffenen als auch Tätern zur Seite stehen.
Was ist computervermittelte Kommunikation (CvK)?
CvK bezeichnet den Austausch von Informationen über digitale Endgeräte. Sie unterscheidet sich von der Face-to-Face-Kommunikation durch Aspekte wie Anonymität und fehlende nonverbale Signale.
- Arbeit zitieren
- Timo Roll (Autor:in), 2016, Cyber-Mobbing als neue Gewalt unter Jugendlichen im digitalen Zeitalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353557