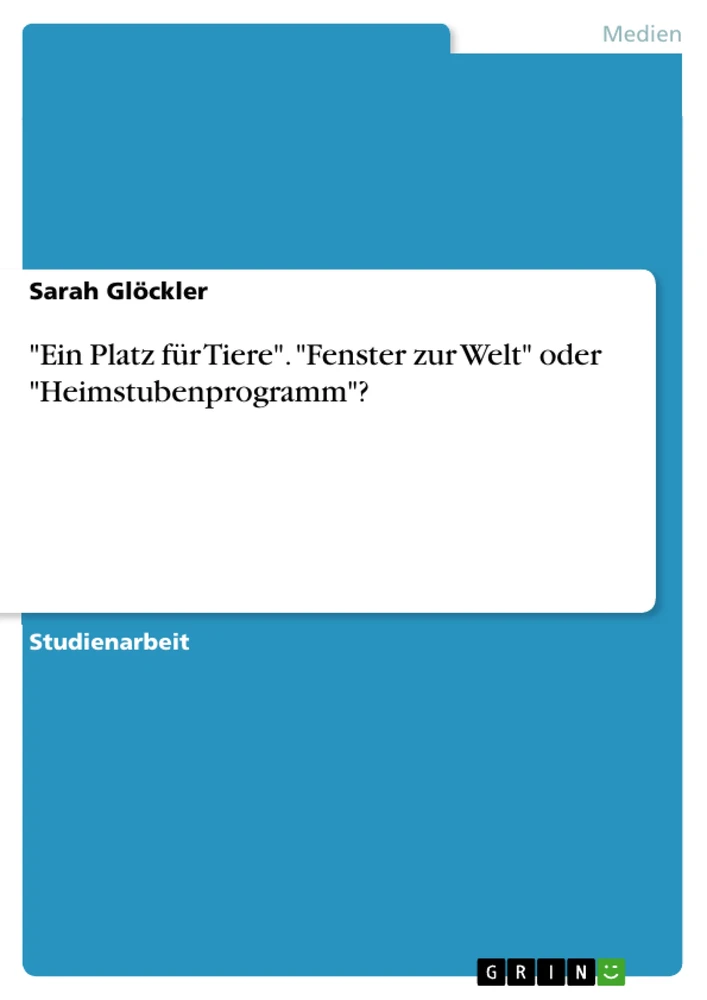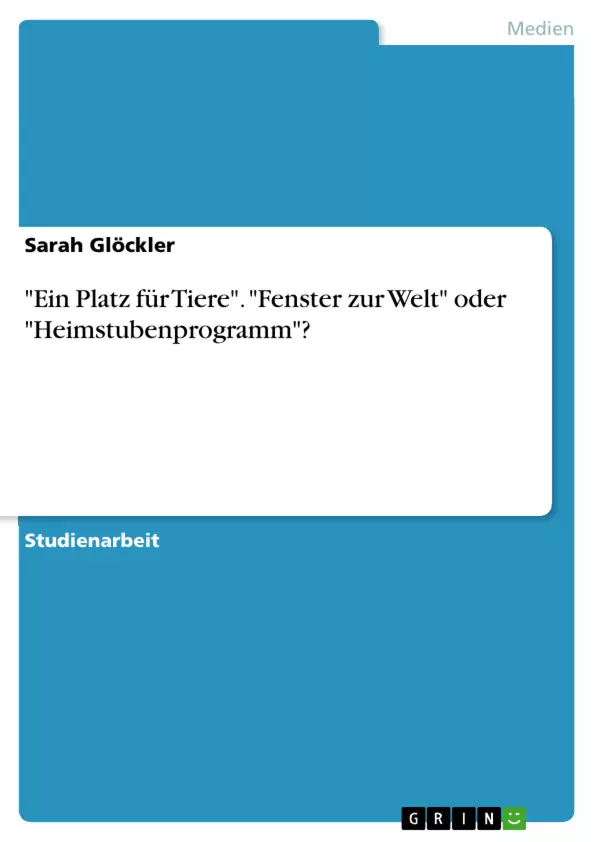Im der Hausarbeit werden die Gründe, Umstände und Tatsachen dargelegt, die zum jahrelangen Erfolg von "Ein Platz für Tiere" führten. Im ersten Teil wird die Sendung an sich vorgestellt. Dabei werden das TV-Studio, die charakteristischen Elemente der Sendung und ihr Live-Charakter näher beleuchtet. Der zweite Teil setzt sich mit Bernhard Grzimeks Art und Weise der Moderation auseinander. Hinführen soll die Arbeit auf den dritten Teil, in dem herausgearbeitet wird, ob es sich bei der Sendung um ein „Fenster zur Welt“ handelt oder inwiefern sie sich als „Heimstuben-Programm“ bezeichnen lässt.
Nach der Eröffnung des offiziellen NWDR-Fernsehprogramms am 25.12.1952 etablierten sich Tierdokumentationen und Tiersendungen rasch als eigenständiges Genre innerhalb der Fernsehprogramme. Intention und Ziel dieser Sendungen war es, die Zuschauer über die einheimische und exotische Tierwelt zu belehren und zu informieren. Die feste Verankerung dieses Genres im deutschen Fernsehen lässt sich zum einen darauf zurückzuführen, dass Wissenschaftssendungen, denen auch Tiersendungen angehörten, „von Anfang an über einen höheren Status innerhalb der Hierarchie der Programmsparten [verfügten]“. Zum anderen erfuhr die Thematisierung der Tierwelt im Rahmen von Tierdokumentationen eine landesweite Popularität, da sie eine breite Bevölkerungsmasse ansprach und begeisterte.
Großen Erfolg hatte vor allem die Dokumentarserie „Ein Platz für Tiere“ von und mit Prof. Dr. Bernhard Grzimek, dem Direktor des Frankfurter Zoos. Auf die Erstausstrahlung im Oktober 1956 folgten 174 weitere Folgen, die vom Hessischen Rundfunk für das Abendprogramm der ARD produziert wurden. Einmal im Monat, immer zur Sendezeit von 20.15 bis 21.00 Uhr, erschien Bernhard Grzimek auf dem Fernsehbildschirm. Über dreißig Jahre lang faszinierte der Zoodirektor und Tierdokumentarist die ganze Familie mit vierbeinigen Studiogästen aus dem Frankfurter Zoo und gewährte umfassende Einblicke in seine Forschungsreisen. Das Konzept der Sendung stammte allerdings nicht vom Hessischen Rundfunk selbst, sondern vom US-amerikanischen Fernsehsender NBC. In der Sendung Zoo Parade, die von 1949-1957 ausgestrahlt wurde, berichtete der Chicagoer Zoodirektor Marlin Perkins über seine Erfahrungen in der Wildnis und zeigte Zootiere live in der Show. Jedoch war es die deutsche Ausgabe mit Bernhard Grzimek, die häufig Einschaltquoten von bis zu siebzig Prozent erzielte und zur weltweit erfolgreichsten Dokumentarserie wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sendung Ein Platz für Tiere
- Ästhetik und Inszenierung des TV-Studios
- Die charakteristischen Elemente der Sendung
- Der Live-Charakter
- Die Moderation von Bernhard Grzimek
- Parasoziale Beziehung
- Spenden
- Tierschutz
- „Fenster zur Welt“ oder „Heimstuben-Programm“?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den langjährigen Erfolg der Fernsehsendung „Ein Platz für Tiere“ mit Bernhard Grzimek. Ziel ist es, die Gründe für die Popularität der Sendung zu analysieren und ihr Konzept im Kontext der Fernsehgeschichte zu verorten. Die Arbeit beleuchtet dabei insbesondere die Rolle des Studios, die Moderation Grzimeks und die Frage, ob die Sendung eher als „Fenster zur Welt“ oder als „Heimstuben-Programm“ zu charakterisieren ist.
- Die ästhetische Gestaltung und Inszenierung des Fernsehstudios von „Ein Platz für Tiere“
- Die Moderationstechnik und der Einfluss von Bernhard Grzimek auf den Erfolg der Sendung
- Der Vergleich der Sendung mit ähnlichen Formaten und die Einordnung in den Kontext der Fernsehgeschichte
- Die Rolle von Tierschutz und Spendenaufrufen in der Sendung
- Die Analyse des Verhältnisses zwischen der Sendung und dem Publikum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entwicklung von Tierdokumentationen im deutschen Fernsehen nach 1952 und hebt die herausragende Bedeutung und den Erfolg von Bernhard Grzimeks „Ein Platz für Tiere“ hervor. Sie verortet die Sendung im Kontext der damaligen Fernsehprogramme und kündigt die folgende Analyse der Erfolgsfaktoren an. Die Einleitung betont die lange Laufzeit der Sendung und ihre hohen Einschaltquoten, um den Fokus der Arbeit zu begründen.
Die Sendung Ein Platz für Tiere: Dieses Kapitel analysiert die Sendung selbst, konzentriert sich auf die Inszenierung des TV-Studios, charakteristische Elemente und den Live-Charakter. Die bescheidene, aber gezielt eingesetzte Studioausstattung – Globus, Bücherregal, Schreibtisch – wird als wichtiger Bestandteil des Wiedererkennungswerts der Sendung hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Präsentation der Tiere und der Informationsvermittlung durch Grzimek.
Die Moderation von Bernhard Grzimek: Dieser Abschnitt untersucht Grzimeks Moderationsstil, seine Beziehung zum Publikum (parasoziale Beziehung), die Integration von Spendenaufrufen und den Aspekt des Tierschutzes. Es wird die persönliche Ausstrahlung Grzimeks als Schlüsselfaktor für den Erfolg der Sendung herausgearbeitet, sowie seine Fähigkeit, wissenschaftliche Informationen ansprechend zu vermitteln und gleichzeitig das Publikum emotional zu involvieren.
„Fenster zur Welt“ oder „Heimstuben-Programm“?: Dieser Teil befasst sich mit der Frage nach der Einordnung der Sendung. Es werden Argumente für beide Perspektiven diskutiert, indem der informative Charakter der Sendung ("Fenster zur Welt") mit dem intimen und familiären Ton ("Heimstuben-Programm") abgeglichen wird. Die Analyse sucht nach dem Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Information und Unterhaltung.
Schlüsselwörter
Ein Platz für Tiere, Bernhard Grzimek, Tierdokumentation, Fernsehgeschichte, Moderationsstil, Studioinszenierung, Tierschutz, Spenden, Parasoziale Beziehung, „Fenster zur Welt“, „Heimstuben-Programm“, Fernsehprogrammgeschichte, Zuschauerbindung.
Häufig gestellte Fragen zu "Ein Platz für Tiere" - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den langjährigen Erfolg der Fernsehsendung „Ein Platz für Tiere“ mit Bernhard Grzimek. Sie untersucht die Gründe für ihre Popularität und ordnet ihr Konzept in die Fernsehgeschichte ein.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die ästhetische Gestaltung des Fernsehstudios, die Moderationstechnik von Bernhard Grzimek, den Vergleich mit ähnlichen Formaten, die Rolle von Tierschutz und Spendenaufrufen, sowie die Analyse des Verhältnisses zwischen Sendung und Publikum. Es wird auch die Frage untersucht, ob die Sendung eher als „Fenster zur Welt“ oder „Heimstuben-Programm“ zu charakterisieren ist.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Sendung „Ein Platz für Tiere“ selbst, zu Grzimeks Moderation, zur Einordnung der Sendung als „Fenster zur Welt“ oder „Heimstuben-Programm“, und ein Fazit. Sie beinhaltet zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel über die Sendung "Ein Platz für Tiere" analysiert?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Inszenierung des TV-Studios (bescheidene, aber gezielt eingesetzte Ausstattung), die charakteristischen Elemente der Sendung und ihren Live-Charakter. Der Fokus liegt auf der Präsentation der Tiere und der Informationsvermittlung durch Grzimek.
Wie wird Grzimeks Moderationsstil beschrieben?
Der Abschnitt über Grzimeks Moderation untersucht seinen Stil, seine parasoziale Beziehung zum Publikum, die Integration von Spendenaufrufen und den Aspekt des Tierschutzes. Seine persönliche Ausstrahlung, seine Fähigkeit, wissenschaftliche Informationen ansprechend zu vermitteln und das Publikum emotional zu involvieren, werden als Schlüsselfaktoren für den Erfolg der Sendung herausgearbeitet.
Wie wird die Sendung im Kontext der Fernsehgeschichte eingeordnet?
Die Arbeit diskutiert, ob die Sendung eher als „Fenster zur Welt“ (informativer Charakter) oder als „Heimstuben-Programm“ (intimer, familiärer Ton) zu charakterisieren ist. Es wird nach dem Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Information und Unterhaltung gesucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ein Platz für Tiere, Bernhard Grzimek, Tierdokumentation, Fernsehgeschichte, Moderationsstil, Studioinszenierung, Tierschutz, Spenden, Parasoziale Beziehung, „Fenster zur Welt“, „Heimstuben-Programm“, Fernsehprogrammgeschichte, Zuschauerbindung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für die Popularität von „Ein Platz für Tiere“ zu analysieren und das Konzept der Sendung im Kontext der Fernsehgeschichte zu verorten.
- Quote paper
- Sarah Glöckler (Author), 2014, "Ein Platz für Tiere". "Fenster zur Welt" oder "Heimstubenprogramm"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353571