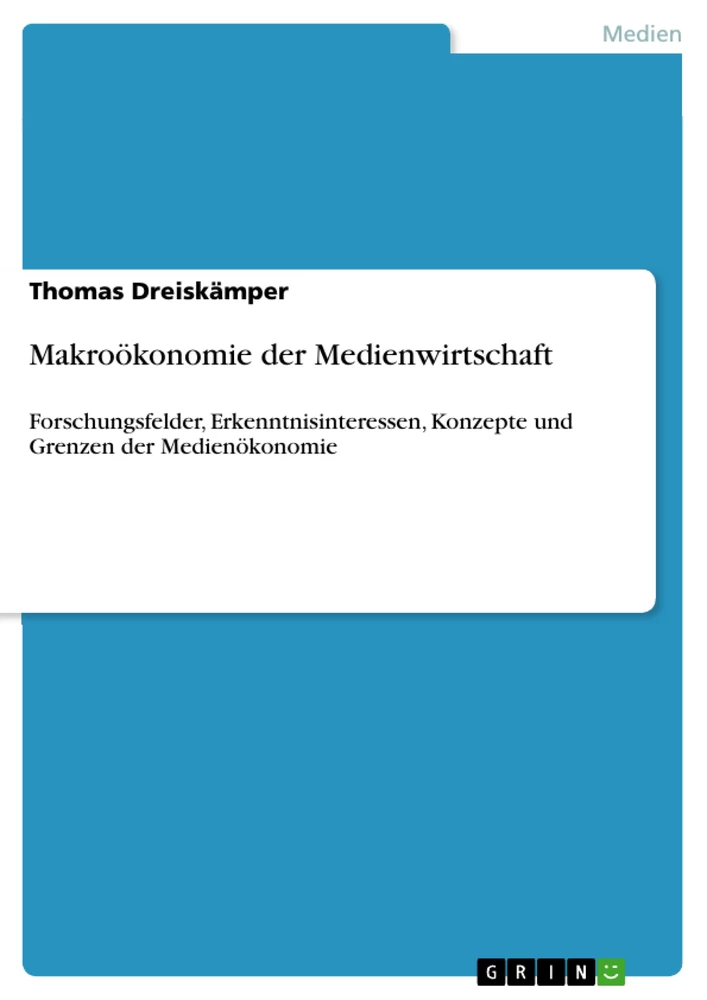Diese Studienbegleitpublikation bezieht sich in seinen erklärenden und vertiefenden Ausführungen auf grundsätzliche Forschungsfelder und Erkenntnisinteressen der Medienökonomie. Die Publikation ist in drei Teile strukturiert. Ergänzt werden die Ausführungen in dieser Publikation mit 81 erklärenden Abbildungen, 27 systematisierenden und statistischen Tabellen sowie insgesamt fast 170 Literaturquellen (Teil I: 47 Quellen, Teil II: 65 Quellen, Teil III: 57 Quellen).
Teil I: Forschungsfelder und Erkenntnisinteressen richtet sich eher an den ökonomischen Laien. Es werden Begriffe und Zusammenhänge der Ökonomie vorgestellt. Im Anschluss werden volkswirtschaftliche, branchenwirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, konsumwirtschaftliche und medienpolitische Forschungsfragen formuliert und erläutert, welche ökonomischen Disziplinen (und Literaturquellen) Antworten liefern.
Teil II: Konzepte zur Differenzierung der Medienwirtschaft zeichnet die Konturen der Medienwirtschaft und zeigt auf, wie unterschiedlich die Medienwirtschaft als volkswirtschaftlicher Sektor ausdifferenziert wird. Hier werden alle prominenten Ansätze dargestellt und problematisiert: Von der europäischen Klassifizierung der ISIC, über die Einteilung in der deutschen VGR und der Kultur‐ und Kreativwirtschaft der Wirtschaftsministerkonferenz bis hin zur privatwirtschaftlichen Abgrenzung der Medien‐ und Unterhaltungsindustrie und der TIME‐Branchen. Was gehört zur Medienindustrie, warum vermischen sich die Konturen immer stärker und wie können Lösungskonzepte aussehen?
Teil III: Makroökonomische Analyse der Medienwirtschaft liefert und kommentiert Zahlen, Daten und Fakten über Gattungsumsätze, Beschäftigungszahlen, Entwicklung der Unternehmensgründungen u.v.a.m. Abschließend werden die Absatzmärkte (Werbemärkte und Rezipientenmärkte) und Beschaffungsmärkte hinsichtlich ihrer Größenordnungen und Entwicklungen intensiv analysiert.
Eine mikroökonomische Analyse der Werbepreise und eine Darstellung unterschiedlicher Zielgruppensystematiken (marketingtechnische Abgrenzungen, Abgrenzung über Sinus‐Milieus und MedienNuzterTypen) runden den dritten Teil ab. Abgeschlossen wird er mit der Fragestellung, ob die Medienwirtschaft tatsächlich so konjunkturabhängig reagiert, wie immer behauptet
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Ausblick auf Teil I: Forschungsfelder und Erkenntnisinteressen der Medienökonomie
- Ausblick auf Teil II: Konzepte zur Differenzierung der Medienökonomie
- Ausblick auf Teil III: Makroökonomische Analyse der Medienwirtschaft
- Teil I: Medienökonomische Forschungsfelder
- 1. Funktionsweise und Begriffe ökonomischer Systeme
- 2. Ökonomische Forschungsfelder der Medienökonomie
- 3. Erkenntnisinteressen medienökonomischer Forschungsfelder
- 3.1 Methodologische Fragestellungen medienökonomischer Analysen
- 3.2 Gütertypologische Fragestellungen medienökonomischer Analysen
- 3.3 Makroökonomische Fragestellungen medienökonomischer Analysen
- 3.4 Mikroökonomische Fragestellungen medienökonomischer Analysen
- 3.5 Betriebswirtschaftliche Fragestellungen medienökonomischer Analysen
- 3.6 Fragestellungen der Mediennutzungs- und Konsumentenforschung
- 3.7 Politische Fragestellungen in der Medienwirtschaft
- Literaturverzeichnis zu Teil I
- Teil II: Konzepte zur Differenzierung der Medienwirtschaft
- 1. Die ökonomische Abgrenzung von Wirtschaftssektoren und Märkten
- 2. Die Medienwirtschaft aus industrieökonomischer Sicht
- 2.1 Die sektoralökonomische Abgrenzung der Medienwirtschaft
- 2.2 Die Medienwirtschaft aus der Sicht der VGR und der ISIC
- 2.3 Die Medienwirtschaft als Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft
- 2.4 Das Konzept der Medien- und Unterhaltungswirtschaft
- 2.5 Die TIME-Industrie als intersektorales Konvergenzgebilde
- 3. Abgrenzung von Medienbranchen - Das Gattungsproblem
- 3.1 Die Ausdifferenzierung der Mediengattungen anhand der Technizität des Produktions- und Empfangsprozesses
- 3.2 Die Ausdifferenzierung der Mediengattungen anhand des Interaktionsgrades der Beteiligten
- 3.3 Die Ausdifferenzierung der Mediengattungen anhand der Reichweite
- 3.4 Die Ausdifferenzierung der Mediengattungen anhand der Leistungsangebote und Leistungsnutzen
- 3.5 Die Folgen der mangelhaften Ausdifferenzierbarkeit der Mediengattungen
- 3.6 Entwurf für eine neue medienwirtschaftliche Gattungsmodellierung
- 3.6.3 Wertschöpfungsorientierte Organisation der Medienwirtschaft
- 3.6.4 Strategieorientierte Organisation der Medienwirtschaft
- Literaturverzeichnis zu Teil II
- Teil III: Makroökonomische Analyse der Medienwirtschaft
- 1. Die Medienwirtschaft: Daten, Zahlen, Fakten
- 2. Dynamik und Struktur der Medienwirtschaft
- 3. Märkte und Marktmerkmale der Medienwirtschaft
- 3.1. Das Marktumfeld der Medienunternehmen
- 3.2. Die Nutzendimensionen der Medienmärkte
- 3.3. Die geografische Dimension der Medienmärkte
- 3.4. Die produkttechnische Dimension der Medienmärkte
- 3.5. Die Absatzmärkte der Medienwirtschaft
- 3.5.1. Werbemärkte: Größe und Struktur
- 3.5.1.1. Volumina und Strukturen der Werbeinvestitionen
- 3.5.1.2. Niedrige Werbemarktpreise als Resultat des Überangebotes
- 3.5.1.3. Die Werbemarktpreise als Resultat der Machtverteilung
- 3.5.2. Rezipientenmärkte: Größe und Struktur
- 3.5.2.1. Mediennutzung im Intermediavergleich
- 3.5.2.2. Die Motive der Mediennutzung
- 3.5.2.3. Rezipienten aus Sicht unterschiedlicher Zielgruppensystematiken
- 3.5.3. Die Beschaffungsmärkte in der Medienindustrie
- 4. Die Konjunkturabhängigkeit der Medienmärkte
- Literaturverzeichnis zu Teil III
- Einführung in die Denkweise der Ökonomie und grundlegende Begriffe
- Systematisierung medienökonomischer Fragestellungen in verschiedenen Disziplinen
- Erkenntnisinteressen in den Bereichen methodologischer, gütertypologischer, makroökonomischer, mikroökonomischer, betriebswirtschaftlicher, medienpolitischer Fragestellungen sowie in der Mediennutzungs- und Konsumentenforschung
- Differenzierung der Medienwirtschaft anhand verschiedener Konzepte, wie z.B. ISIC, VGR, Kultur- und Kreativwirtschaft und TIME-Industrie
- Analyse der Größe, Dynamik und Struktur der Medienwirtschaft in Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Studienbegleitpublikation bietet einen umfassenden Überblick über die Forschungsfelder und Erkenntnisinteressen der Medienökonomie. Sie führt den Leser in die Funktionsweise und die Denkweise der Ökonomie ein und zeigt, wie medienwirtschaftliche Fragestellungen systematisiert und differenzierten Forschungsfeldern zugeordnet werden können. Dabei werden die wichtigsten Disziplinen und ihre zentralen Fragestellungen in Bezug auf Güter, Akteure, Märkte und Branchen beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Teil I bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte der Ökonomie, die als Basis für das Verständnis medienökonomischer Fragestellungen dienen. Es werden die wichtigsten wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen und ihre Erkenntnisinteressen vorgestellt. Teil II widmet sich der Differenzierung der Medienwirtschaft. Es werden verschiedene Konzepte zur Abgrenzung der Medienwirtschaft vorgestellt und kritisch analysiert, wobei die Problematik der klassischen Gattungsbegriffe und der Wandel hin zu einer konvergierenden TIME-Industrie im Vordergrund stehen. Teil III präsentiert eine makroökonomische Analyse der Medienwirtschaft in Deutschland, die sich mit der Größe, Dynamik und Struktur des Wirtschaftszweiges befasst. Es werden die wichtigsten Medienmärkte und ihre Eigenschaften vorgestellt und die Relevanz der Medienwirtschaft in der Gesamtökonomie beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Medienökonomie, Medienwirtschaft, Forschungsfelder, Erkenntnisinteressen, Konzepte, Differenzierung, Makroökonomische Analyse, Daten, Zahlen, Fakten, Dynamik, Struktur, Märkte, Marktmerkmale, Absatzmärkte, Werbemärkte, Rezipientenmärkte, Mediennutzung, Konsumenten, Zielgruppen, MedienNutzerTypen, Konjunkturabhängigkeit.
- Arbeit zitieren
- Professor Dipl. Medien-Ökonom Thomas Dreiskämper (Autor:in), 2017, Makroökonomie der Medienwirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353657