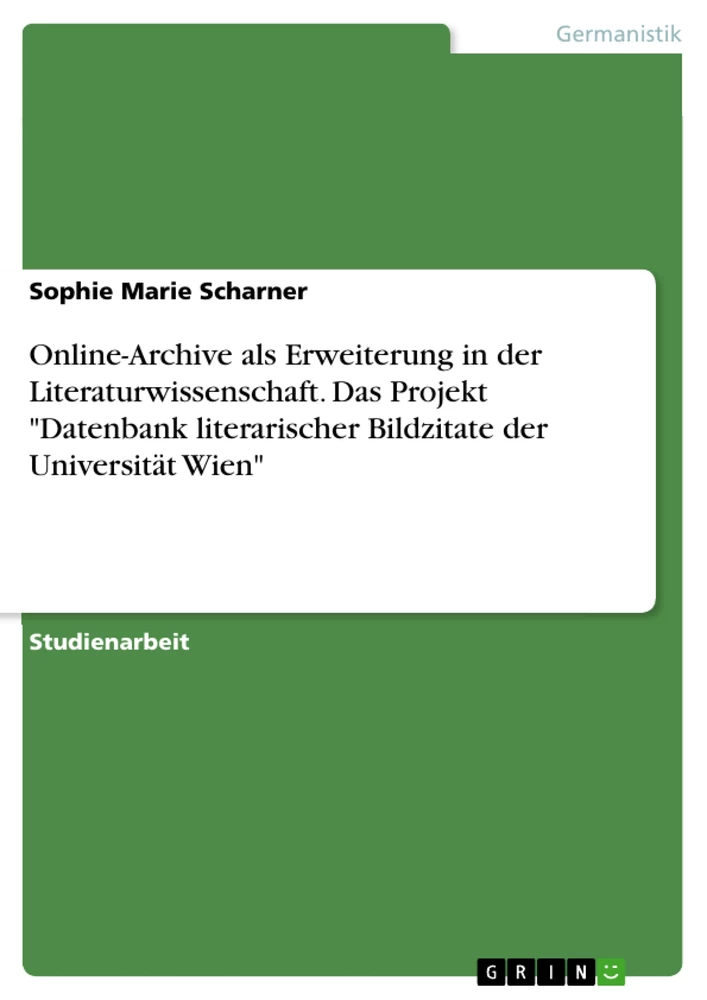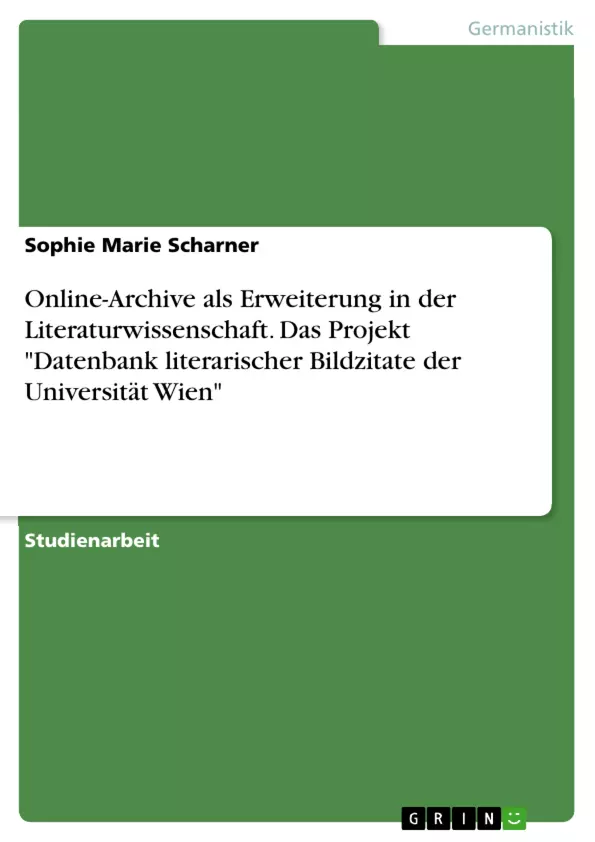Smartphones, Tablets, LapTops oder eBook Reader. Die Devise heißt schneller, besser und vor allem mehr Speicher. Denn die Dateien brauchen Platz und der wird heutzutage immer seltener auf analogen Trägern geschaffen. Der Trend geht in Richtung Digitalisierung. Das spielt aber nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich eine Rolle. Die Gesellschaft hat das Verlangen nach permanenter Verfügbarkeit von Fotos, Videos, Scans oder Dokumenten. Sozusagen immer und überall abrufbare Informationen zur Verfügung zu haben, sei es zum Vergnügen, für die Arbeit oder das Studium. Auf diese Weise wird Wissen als Allgemeingut gehandelt und ist für jedermann zugänglich, der über die technischen Mittel und das nötige Know-how verfügt.
Die Technik eröffnet fortwährend neue Möglichkeiten diese Online-Welt zu nutzen. So nimmt auch die Literaturwissenschaft an diesem Wandel teil. Das soll besonders unter dem Aspekt der Archivierung analysiert werden. Diese wissenschaftliche Ausarbeitung befasst sich daher mit der Frage nach der Digitalisierung von Literatur und deren Unterkategorie des Archivs. Zuerst werden theoretische Begriffe klar abgegrenzt, damit eine Basis für die behandelte Thematik geschaffen ist. Dann folgt eine Darstellung des Internets, die in Hinblick auf die Literatur den Werdegang sowie die Vor- und Nachteile der Digitalität aufzeigen.
Bis heute ist die Digitalität ein viel diskutierter Sachverhalt. Nach dem genauen Abwägen der Funktionen von Literatur im, mit und durch das Internet, wird genauer auf die Verwendung als Archiv eben desselben eingegangen. Hier liegt der Kern der Arbeit und stellt neben der Netzliteratur die Online-Sammlungen in den Fokus. Die Recherche verkörpert dabei den Schlüssel zur Information. Weiters wird die Datenbank literarischer Bildzitate der Universität Wien vorgestellt, um die Thematik greifbarer zu machen. Abschließend folgt ein Ausblick zu kommenden Tendenzen, die unser digitales Miteinander betreffen. Auch, wenn die Arbeit auf Literaturrecherche basiert, ist eine umfassende Behandlung des Inhalts versichert. Jedoch ist zu beachten, dass es sich um eine Hausarbeit als Erweiterung zu einem Referat im Rahmen eines Seminars handelt, weshalb ein bestimmter Umfang einzuhalten ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Literalität und Digitalität
- 1. Internet als allgegenwärtiger Informationszugang
- 2. Medien im digitalen Wandel
- a) Analog vs. digital
- b) Möglichkeiten im virtuellen Raum
- II. Archivfunktion der digitalen Welt
- 1. Netzliteratur
- 2. Online-Sammlungen
- 3. Recherche im World Wide Web
- III. Die Datenbank literarischer Bildzitate
- 1. Projektdarstellung der Universität Wien
- 2. Analoge Pendants zum Online-Auftritt
- 3. Konkrete Darstellung im Gebrauch der Homepage
- 4. Verbesserungswürdigkeit
- IV. Zukunftstendenzen
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Digitalisierung von Literatur und deren Unterkategorie des Archivs. Es werden theoretische Begriffe der Literalität und Digitalität geklärt, um eine Basis für die behandelte Thematik zu schaffen. Anschließend wird das Internet in Hinblick auf die Literatur analysiert und die Vor- und Nachteile der Digitalität aufgezeigt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Archivfunktion des Internets und untersucht die Verwendung als Archiv in Bezug auf Netzliteratur, Online-Sammlungen und die Recherche.
- Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Literatur und die damit verbundenen Veränderungen in der Archivierung.
- Die Rolle des Internets als Informationsquelle und die Herausforderungen der Archivierung im digitalen Zeitalter.
- Die Funktionsweise und Bedeutung von Netzliteratur, Online-Sammlungen und Online-Recherche in der Literaturwissenschaft.
- Die Datenbank literarischer Bildzitate der Universität Wien als Beispiel für ein digitales Archiv und dessen Einsatzmöglichkeiten.
- Zukunftsperspektiven und Tendenzen im Bereich der Digitalisierung und deren Bedeutung für die Literaturwissenschaft.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel definiert die Begriffe Literalität und Digitalität und untersucht deren Zusammenspiel im Kontext der Archivierung. Das zweite Kapitel erörtert die Archivfunktion des Internets und analysiert verschiedene Aspekte wie Netzliteratur, Online-Sammlungen und die Recherche im World Wide Web. Das dritte Kapitel stellt die Datenbank literarischer Bildzitate der Universität Wien vor und analysiert deren Aufbau und Nutzung als Beispiel für ein digitales Archiv. Das vierte Kapitel beleuchtet zukünftige Entwicklungen in der Literaturwissenschaft im Zusammenhang mit der Digitalisierung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt die Digitalisierung von Literatur, die Archivfunktion des Internets, Netzliteratur, Online-Sammlungen, Online-Recherche, Datenbank literarischer Bildzitate, Hypertext, Interaktivität, Intermedialität, Inszenierung, digitale Medien, und die Zukunftstendenzen der Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Sophie Marie Scharner (Author), 2016, Online-Archive als Erweiterung in der Literaturwissenschaft. Das Projekt "Datenbank literarischer Bildzitate der Universität Wien", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353760