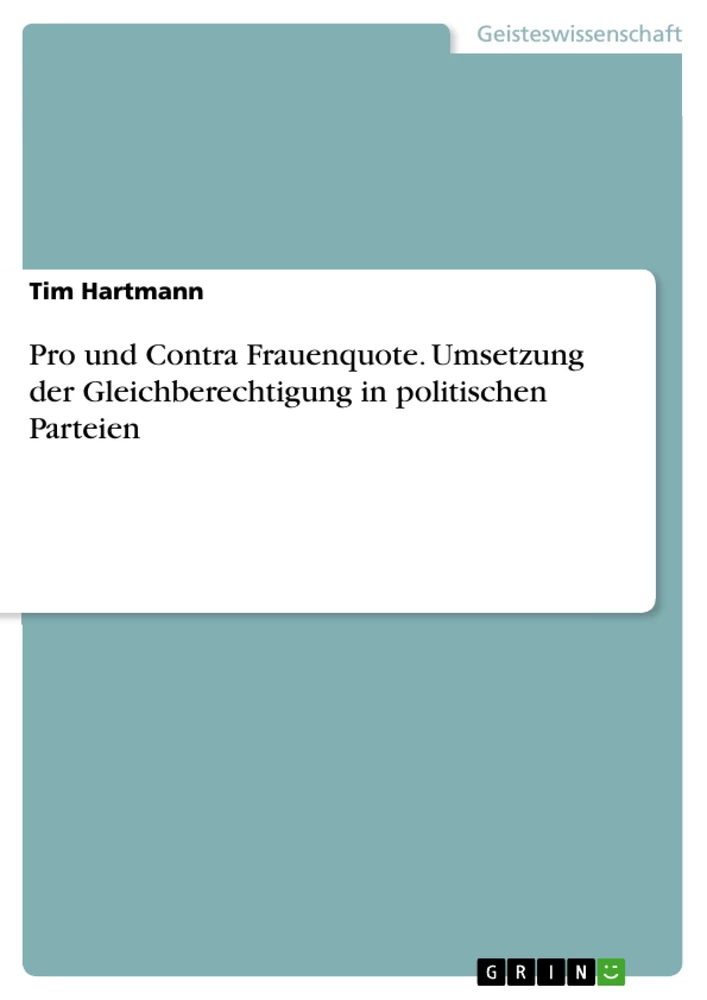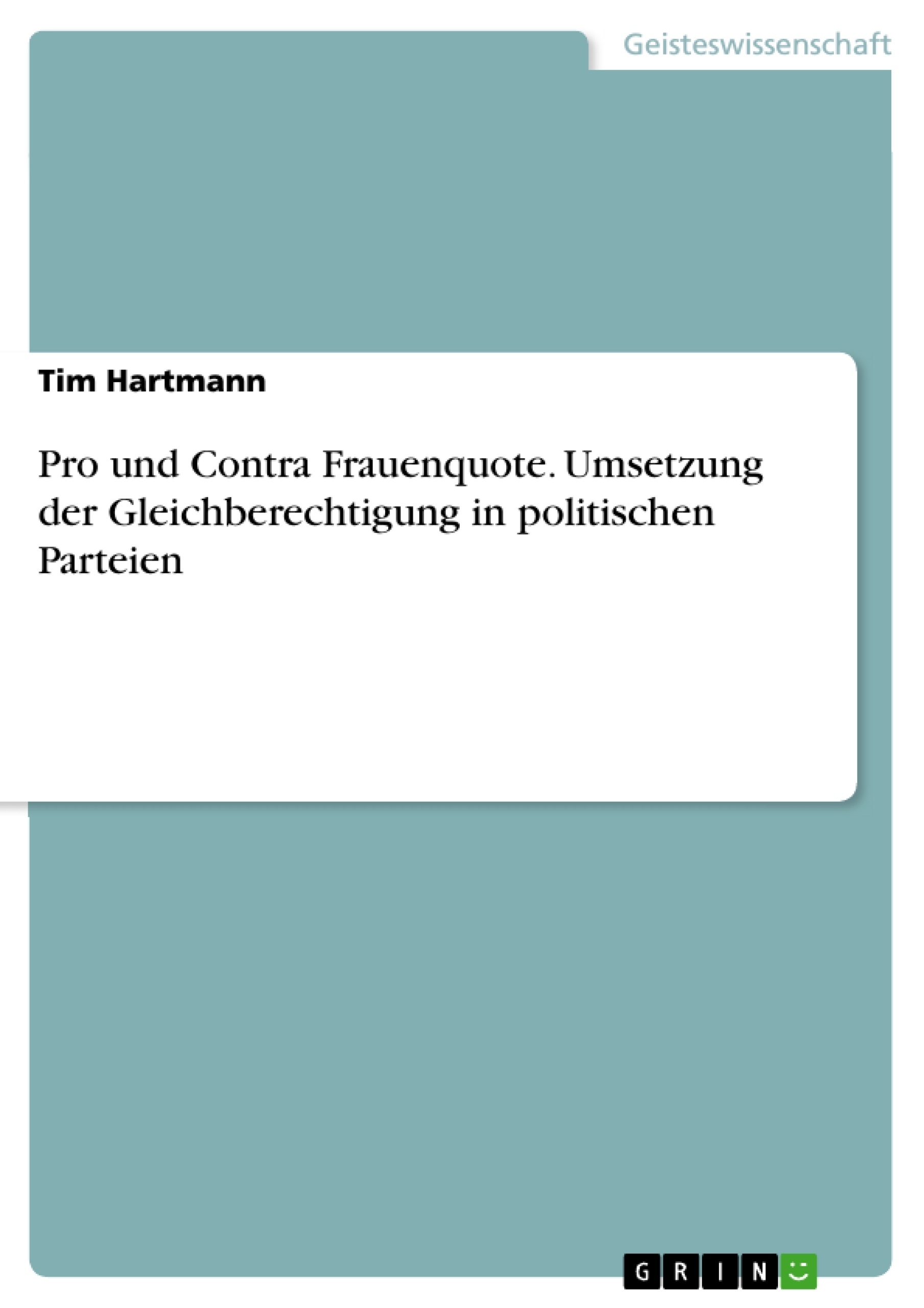Bis 1918 war ein quantitativ und qualitativ bedeutender Teil der Bevölkerung von politischen Ämtern ausgesperrt. Seither sind Frauen berechtigt zu wählen und gewählt zu werden. In den vergangenen Jahrzehnten war die Frauenrolle starken Wandlungen ausgesetzt. Einst nur auf den privaten Raum beschränkt können Frauen den Sprung ins öffentliche Leben nun zumindest schaffen und in politischen Gremien Präsenz zeigen. Der Zugang zu politischen Ämtern steht Frauen theoretisch offen.
Die Zeit der politischen Unterdrückung der Frauen schien mit der Frauenrechtsbewegung 1918 beendet und der Diskurs nach stärkerer Einbindung von Frauen in das politische Leben ist allgegenwärtig. Das Bild der Bundesrepublik Deutschlands scheint nach außen als gerechter Staat für Frauen. Einen besonders großen Anteil daran hat Angela Merkel, die erste Bundeskanzlerin Deutschlands. Doch entspricht das Bild der Wahrheit? Und wenn ja, warum denken wir an einen graubärtigen weißen Mann, wenn das Bild eines klassischen Politikers zum Diskurs steht?
Dies liegt daran, dass Deutschland in Sachen Gleichberechtigung der Frauen in politischen Ämtern doch noch nicht das Maximum erreicht hat. Zu groß die Differenzen zwischen Männern und Frauen.
Diese Arbeit handelt von diesem Sachverhalt. Dabei werde ich auf Entwicklung der Quote, aktuelle Repräsentation und Regelungen in den unterschiedlichen Parteien eingehen und mich mit der Frage beschäftigen, warum sich die Parteien sich nicht selbst an die auferlegten innerparteilichen Quoten halten.
Weiterhin werde ich auf die Frage eingehen, ob die allgemeine Stagnation der Quote diese mittlerweile überflüssig macht und sie überhaupt noch benötigt wird. Des Weiteren werde ich auch noch kurz auf Minderheitenquoten im deutschen Parteiensystem eingehen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Geschichtlicher Abriss über Einführung der Frauenquote
- Wird die Frauenquote heutzutage noch benötigt? Eine Pro und Contra Argumentation
- Übersicht der handelnden Parteien und deren Bemühungen für Gleichberechtigung
- CDU
- SPD
- Die Linke
- Die Grünen
- FDP
- Kann der Stagnation der Quote entgegen gewirkt werden?
- Lassen sich mit Hilfe von Minderheitenquoten ähnliche Effekte erzielen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert die aktuelle Situation der Frauenquote in Deutschland und beleuchtet die historischen Entwicklungen, die zu ihrer Einführung führten. Sie hinterfragt die Notwendigkeit der Quote im Kontext des aktuellen Stands der Gleichberechtigung und untersucht, ob sie zur Überwindung der Stagnation beitragen kann. Außerdem werden die unterschiedlichen Positionen der politischen Parteien in Bezug auf die Frauenquote und die Gleichberechtigung im Allgemeinen beleuchtet.
- Historische Entwicklung der Frauenquote in Deutschland
- Bewertung der Notwendigkeit der Frauenquote im aktuellen Kontext
- Analyse der Positionen der politischen Parteien zur Frauenquote und Gleichberechtigung
- Untersuchung der Möglichkeiten zur Überwindung der Stagnation der Frauenquote
- Diskussion der Relevanz von Minderheitenquoten im politischen System
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Frauenquote ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar. Dabei wird auf die historische Entwicklung der Frauenrolle im politischen Leben sowie auf die Bedeutung von Gleichberechtigung in der heutigen Gesellschaft eingegangen. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Frage, ob die Frauenquote noch zeitgemäß ist und ob sie die politische Gleichstellung von Frauen tatsächlich fördert.
Geschichtlicher Abriss über Einführung der Frauenquote: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Frauenquote und zeichnet die wichtigsten Meilensteine ihrer Entwicklung nach. Dabei wird auf die Rolle der Frauenrechtsbewegung, die Einführung der ersten Frauenquote durch die Grünen und den „Dominoeffekt“, der zur Verbreitung der Quote in anderen Parteien führte, eingegangen.
Wird die Frauenquote heutzutage noch benötigt? Eine Pro und Contra Argumentation: In diesem Kapitel werden die Argumente für und gegen die Frauenquote diskutiert. Die Pro-Argumente fokussieren auf die Notwendigkeit der Quote zur Herstellung von Repräsentativität, die Überwindung von strukturellem Sexismus und die Förderung von Frauen in der Politik. Die Contra-Argumente argumentieren dagegen, dass die Quote zu einer Ungleichbehandlung von Männern führen könnte und dass Frauen in der heutigen Zeit die gleichen Chancen wie Männer haben.
Übersicht der handelnden Parteien und deren Bemühungen für Gleichberechtigung: Dieses Kapitel untersucht die Positionen der verschiedenen politischen Parteien in Bezug auf die Frauenquote und die Gleichberechtigung. Dabei werden die Grundsatzprogramme der Parteien analysiert und die unterschiedlichen Ansätze zur Lösung der Problematik beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Frauenquote, Gleichberechtigung, politische Repräsentation, Gender, Parteienlandschaft, Geschlechtergerechtigkeit, politische Partizipation, Frauenrechte, feministische Politik, struktureller Sexismus, Parteiengesetz.
- Quote paper
- Tim Hartmann (Author), 2015, Pro und Contra Frauenquote. Umsetzung der Gleichberechtigung in politischen Parteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353893