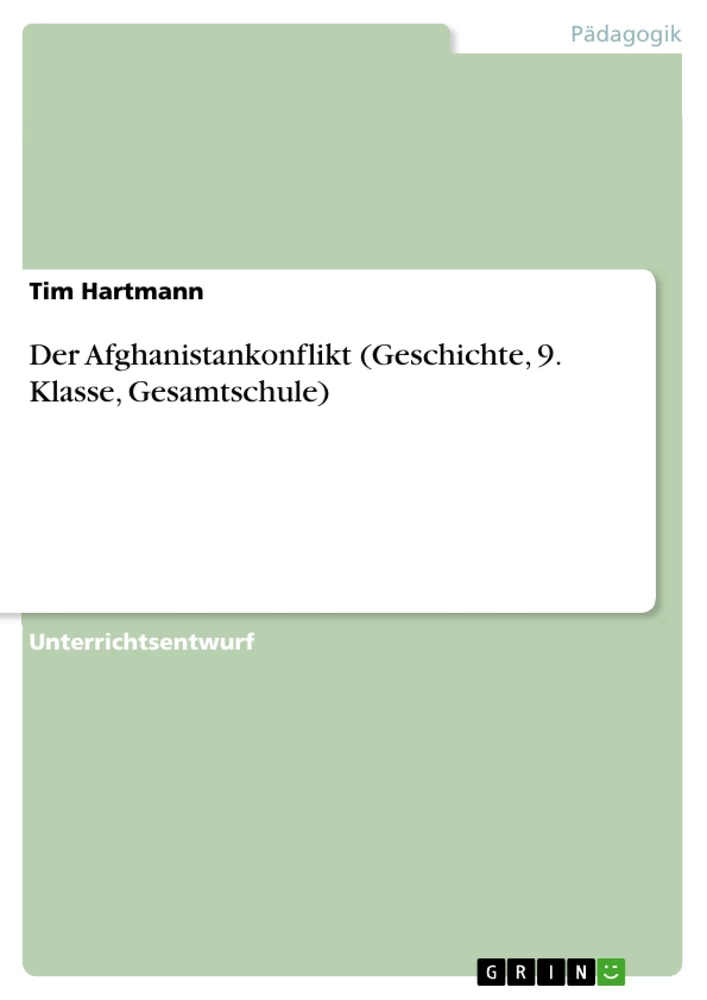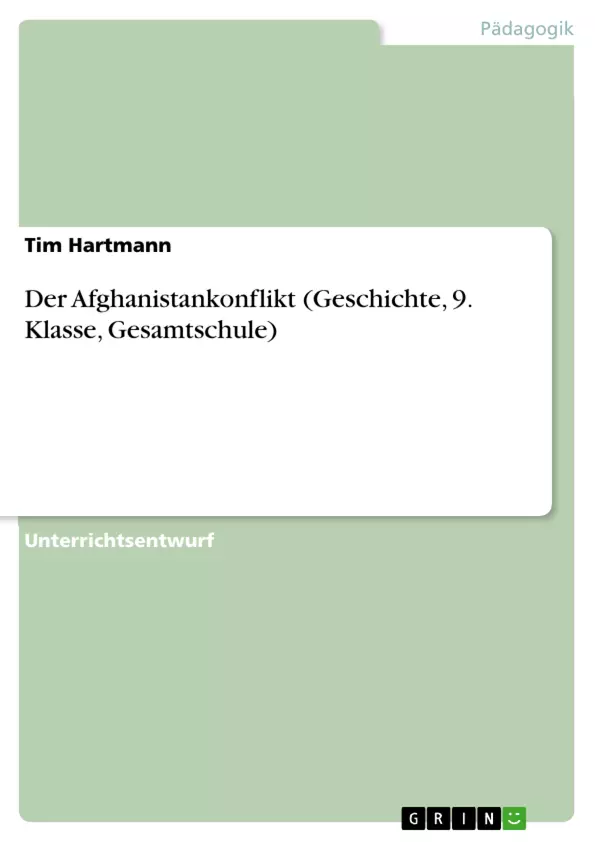Bei dem vorliegenden Portfolio handelt es sich um die Ausarbeitung des Seminares Unterricht im Fach "Politik und Wirtschaft" – Konzeption und Gestaltung. Laut der Arbeitsaufgabe ist dieses Portfolio in sieben Werkstücke aufgeteilt. Diese Werkstücke besitzen unterschiedliche Aufgaben zur Planung einer Unterrichtsreihe über den Afghanistankonflikt. Beginnend mit dem Werkstück 1, in dem die Lernausgangslage einer Klasse beschrieben wird, welche durch das Studium eines Videos analysiert wird. Das zweite Werkstück setzt sich mit dem fachwissenschaftlichen Teil auseinander, über den die Lehrkraft und die SuS Bescheid wissen müssen. Dies geschieht über eine kategoriale Sachanalyse, welche es ermöglicht, dass Lernen auf Inhalte beziehen zu können. Die Aufgabe des dritten Werkstückes ist es, eine Lernumgebung zu schaffen. Ab dem dritten Werkstück geht es um die didaktische Strukturierung. Es hat die Aufgabe einen geeigneten Lernweg zu finden, um einen größtmöglichen Lernerfolg bei den SuS zu erreichen. Nach Feststellung eines geeigneten Lernweges beschäftigt sich das Werkstück 4 damit, eine Leitkompetenz für die Unterrichtsreihe zu schaffen und die Unterrichtsstunden kompetenzorientiert zu strukturieren. Eine Aufstellung der Unterrichtsreihe ist dann um Werkstück 5 angedacht. In dem darauffolgenden Werkstück kommt es zu einer detaillierten Planung einer Einzelstunde im Kontext des Unterrichts. Im finalen Werkstück 7 kommt es zu einer allgemeinen Reflexion des Seminares und die Entwicklung eigener Unterrichtsplanungskompetenzen durch Bearbeitung des Portfolios.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Werkstück 1: Die Schülerinnen und Schüler kennenlernen – Reflektieren Sie die Lernvoraussetzungen!
- Lerngruppenanalyse
- Politikbewusstsein
- Kompetenzbereiche
- Reflexion Werkstück
- Werkstück 2: Afghanistan – Arbeiten Sie heraus, was Schülerinnen und Schüler daran über Krieg und Frieden lernen können!
- Dimension "Prozess"
- Dimension "System"
- Dimension "Sinn"
- Dimension "Handeln"
- Reflexion des Werkstücks
- Werkstück 3: Wählen Sie einen Lernweg aus – strukturieren Sie Lernprozess und Thema didaktisch sinnvoll!
- Werkstück 4: Die Kompetenzen der Unterrichtseinheit: Formulieren Sie eine Leitkompetenz und inhaltsbezogene Kompetenzen für alle Unterrichtsstunden
- Werkstück 5: Erstellen Sie eine Übersicht zur Ihrer Unterrichtseinheit!
- Werkstück 6: Planen Sie eine Einzelstunde detailliert!
- Werkstück 7: Reflektieren Sie das Seminar und Ihren eigenen Lernprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieses Portfolio widmet sich der Konzeption und Gestaltung einer Unterrichtsreihe über den Afghanistankonflikt. Das Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern ein tiefgreifendes Verständnis für die komplexen Ursachen, Akteure, und Auswirkungen dieses langjährigen Konflikts zu vermitteln.
- Die Fragilität des afghanischen Staates und die Auswirkungen auf die Friedensbemühungen
- Die Rolle internationaler Akteure und deren Einfluss auf den Konflikt
- Die Herausforderungen des Wiederaufbaus und der Stabilisierung Afghanistans
- Die Bedeutung des Konflikts für die internationale Sicherheit und die deutsche Gesellschaft
- Mögliche Lösungsansätze für eine nachhaltige Friedenslösung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die einzelnen Werkstücke des Portfolios beleuchten verschiedene Aspekte der Unterrichtsplanung. Werkstück 1 analysiert die Lernvoraussetzungen einer 9. Klasse und identifiziert die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre politischen Kompetenzen. Werkstück 2 beschäftigt sich mit dem Afghanistankonflikt und untersucht die relevanten Dimensionen des Konflikts: Prozess, System, Sinn, und Handeln. Werkstück 3 beschreibt den gewählten Lernweg, der auf die strukturellen Probleme Afghanistans fokussiert. Werkstück 4 formuliert eine Leitkompetenz und inhaltsbezogene Kompetenzen für die Unterrichtseinheit. Werkstück 5 präsentiert eine Übersicht der gesamten Unterrichtsreihe mit den geplanten Inhalten und Kompetenzen. Werkstück 6 analysiert eine detaillierte Einzelstunde der Unterrichtsreihe, die den Einstieg in den Konflikt behandelt. Werkstück 7 reflektiert das Seminar und den eigenen Lernprozess.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Themengebiete des Portfolios sind: Afghanistankonflikt, Fragilität des Staates, internationale Akteure, Wiederaufbau, Friedenssicherung, politische Bildung, Lernvoraussetzungen, Kompetenzorientierung, Unterrichtsplanung, Unterrichtsstunde, Kategoriale Sachanalyse.
- Quote paper
- Tim Hartmann (Author), 2016, Der Afghanistankonflikt (Geschichte, 9. Klasse, Gesamtschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353894