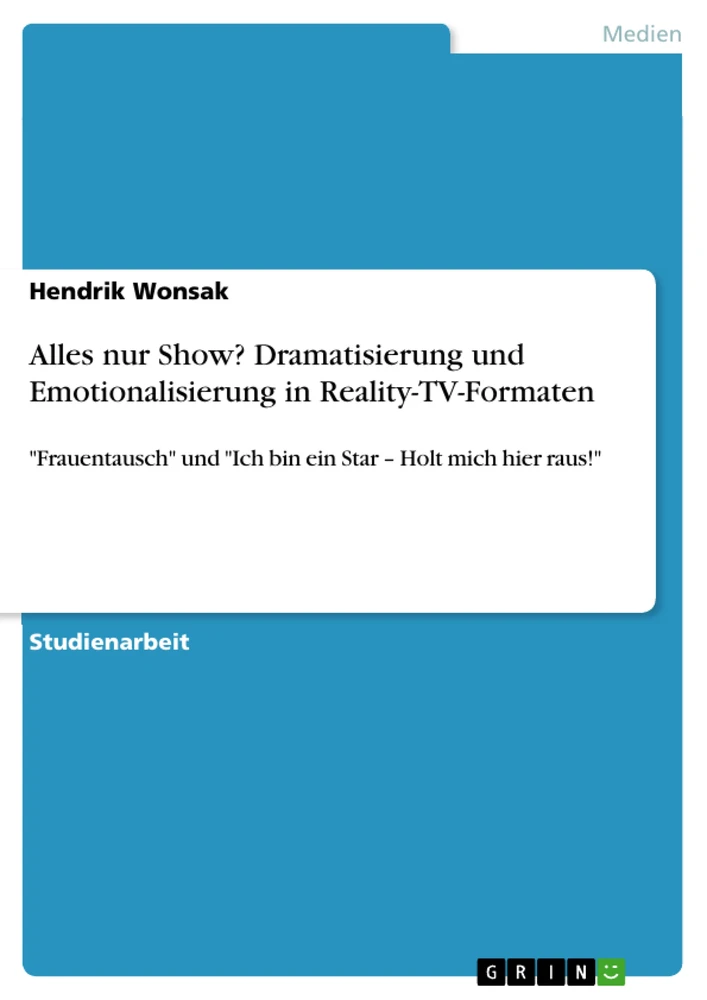Diese Hausarbeit befasst sich mit der kontroversen Mediengattung des Reality TVs und mit verschiedenen Aspekten der Dramatisierung und Inszenierung innerhalb zweier Reality-TV-Formate. Für die exemplarische Analyse wurden die beiden Formate „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” (in vielen Fällen auch als „Dschungelcamp” bezeichnet) und „Frauentausch” gewählt. Bei beiden Formaten handelt es sich um langjährig erfolgreiche Adaptionen aus dem Ausland, die in Deutschland von privaten Sendeanstalten ausgestrahlt werden. Des Weiteren sind beide Formate, wie in dem nächsten Abschnitt erläutert wird, dem performativen Reality TV zuzuordnen.
Sich prügelnde Kinder, verzweifelte Mütter und verliebte Prominente – diese und ähnliche Szenerien sind aus der zeitgenössischen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. „Wenn die Zeiten draußen ungemütlich sind, wenn Krieg ist, wenn Unsicherheit ist, dann wollen die Leute gemütliches Fernsehen sehen. Wenn man sich an das Chaos draußen gewöhnt hat, dann sind die Menschen bereit für ein bisschen kontroverse Themen”, erklärte Boris Brandt von der Produktionsfirma „Endemol“ vor einigen Jahren in einem Interview mit Spiegel Online. Diese Produktionsfirma ist unter anderem für einige der derzeit beliebtesten TV-Formate in Deutschland verantwortlich, wie zum Beispiel „Vermisst”, „Verzeih Mir” oder „Promi Big Brother”.
Eben jene Formate tragen, wenn man Brandt Glauben schenkt, dazu bei, die angesprochenen, kontroversen Themen über den Fernseher in die deutschen Wohnzimmer zu transportieren. Die aufgelisteten Formate haben die Gemeinsamkeit, dass sie einer der populärsten Genre-Gattungen der internationalen Fernsehlandschaft angehören – dem Reality TV. Diese hybride, sich stetig wandelnde Gattung zeichnet sich unter anderem durch Skandale, Schockmomente, Ekel und Grenzübertretungen aus. Fernsehproduzent Markus Peichl verglich Reality TV gar mit einem altertümlichen Jahrmarkt: „Das ist wie frühher auf dem Jahrmarkt, wo in den Schaubuden Schlangenmenschen, Pygmäen und Frauen mit Bärten ausgestellt wurden”. Auch die aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel gab ihr Interesse an den voyeuristischen, an den Alltag angelehnten Merkmalen des Reality TV zu: „Da schaut man doch gerne hinein, wenn die Leute ihre Gardinen nicht zugezogen haben”.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reality TV
- Docu-Soaps
- Docu-Soaps - „Frauentausch“
- Reality-Soaps
- Reality-Soaps - „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“
- Dramatisierung und Emotionalisierung
- Inszenierungsstrategien anhand des Formats „Frauentausch“
- Inszenierungsstrategien anhand des Formats „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die kontroverse Mediengattung Reality TV und analysiert verschiedene Aspekte der Dramatisierung und Inszenierung innerhalb zweier beliebter Formate: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und „Frauentausch“. Die Arbeit betrachtet die beiden Formate als Beispiele für performatives Reality TV und beleuchtet, wie sie durch Inszenierungstechniken Emotionen erzeugen und Zuschauer fesseln.
- Entwicklung und Definition von Reality TV
- Untersuchung der Subgenres Docu-Soaps und Reality-Soaps
- Analyse der Inszenierungsstrategien in „Frauentausch“ und „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“
- Bedeutung der Dramatisierung und Emotionalisierung für den Erfolg von Reality TV
- Kritik und Reflexion der Rolle von Reality TV in der heutigen Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die beiden untersuchten Formate „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und „Frauentausch“ vor. Sie beleuchtet die Relevanz von Reality TV in der heutigen Medienlandschaft und die Bedeutung von Dramatisierung und Inszenierung in diesen Formaten.
- Reality TV: Dieses Kapitel definiert den Begriff Reality TV und stellt seine verschiedenen Subgenres vor. Es beleuchtet die Entwicklung des Genres und die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition zu finden. Außerdem wird auf die Unterscheidung zwischen narrativem und performativem Reality TV eingegangen.
- Docu-Soaps: Dieses Kapitel fokussiert auf das Subgenre der Docu-Soaps und beleuchtet deren Entstehung und charakteristische Merkmale. Es erläutert den Ansatz der „seriellen dokumentarischen Erzählung“ und die inszenierte Nähe zum Alltag, die diese Formate erzeugen.
- Docu-Soaps - „Frauentausch“: Dieses Kapitel analysiert das Format „Frauentausch“ im Detail. Es stellt das Konzept, die Handlung und die Inszenierungsstrategien der Sendung vor. Außerdem beleuchtet es die Popularität des Formats und den Einfluss, den es auf andere TV-Formate hatte.
- Reality-Soaps - „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“: Dieses Kapitel analysiert das Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und erklärt seine Besonderheiten. Es stellt die Inszenierungsstrategien vor, die für die Emotionalisierung der Zuschauer eingesetzt werden. Außerdem werden die Elemente der performativen Inszenierung im Kontext von Game-Shows, Beziehungs-Shows und Problemlösesendungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Reality TV, Dramatisierung, Emotionalisierung, Inszenierung, Docu-Soaps, Reality-Soaps, „Frauentausch“, „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, performatives Reality TV, Medienlandschaft, Unterhaltung, Zuschauerbindung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Docu-Soaps und Reality-Soaps?
Docu-Soaps wie „Frauentausch“ nutzen eine dokumentarische Erzählweise im Alltagskontext, während Reality-Soaps wie das „Dschungelcamp“ oft künstliche Wettbewerbssituationen schaffen.
Wie wird in „Frauentausch“ Dramaturgie erzeugt?
Dramaturgie entsteht durch die gezielte Auswahl gegensätzlicher Charaktere, den Schnitt und die Inszenierung von Konflikten während des Rollentauschs.
Was bedeutet „performatives Reality TV“?
Es bezeichnet Formate, in denen die Teilnehmer vor der Kamera agieren und ihre Emotionen oder Handlungen durch die Anwesenheit der Kamera und die Spielregeln beeinflusst werden.
Warum ist Emotionalisierung für Reality TV so wichtig?
Emotionen binden die Zuschauer an das Format; durch Schock, Ekel oder Mitgefühl wird ein voyeuristisches Interesse geweckt, das den Erfolg der Sendungen sichert.
Gibt es Kritik an diesen TV-Formaten?
Ja, Kritiker vergleichen Reality TV oft mit historischen Jahrmärkten, auf denen Menschen zur Schau gestellt werden, und kritisieren die Grenze zwischen Realität und Inszenierung.
- Quote paper
- Hendrik Wonsak (Author), 2016, Alles nur Show? Dramatisierung und Emotionalisierung in Reality-TV-Formaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353949