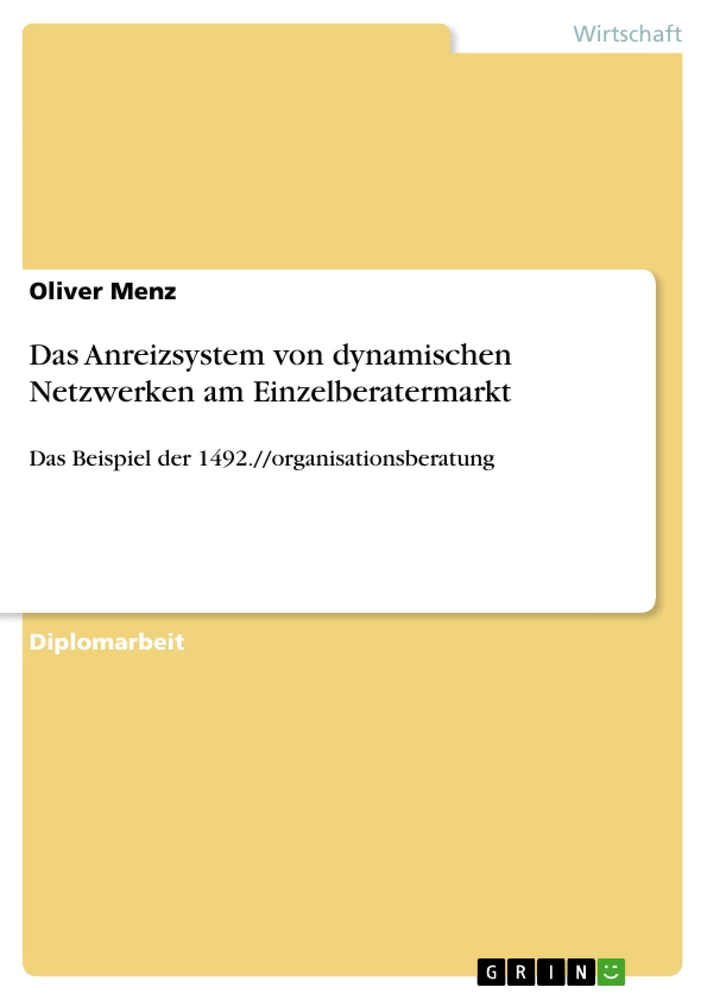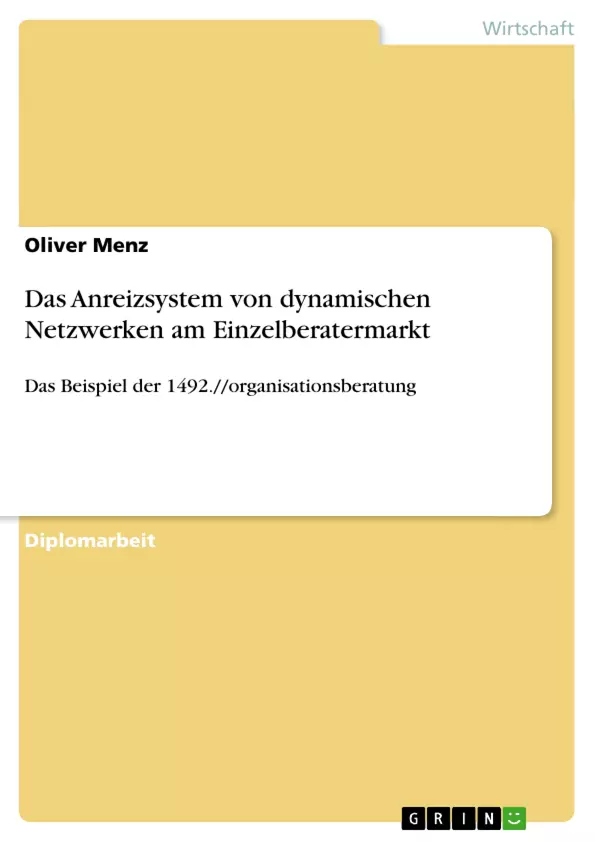[...] Die klassische Unternehmung ist eine Form der Zusammenarbeit, in der Kapazitätsschwankungen besser als durch den individuellen Berater begegnet werden kann. Dabei stellt sich jedoch die Anreizproblematik, dass sein Einkommen innerhalb der Organisation u.U. geringer ist, als dies bei einer kontinuierlichen Auslastung der individuellen Beratungstätigkeit der Fall wäre. Sobald durch die Tätigkeit innerhalb der Organisation Kontakte zu Kunden aufgebaut wurden, die sich auch individuell nutzen lassen, steigt der Anreiz, mit der Übernahme des Kunden aus der Organisation auszutreten. Aufgrund der sich verändernden Anreizstrukturen kommt es immer wieder zum Wechsel zwischen den Koordinationsformen, was wiederum eine hohe Unbeständigkeit für alle Beteiligten zur Folge hat. Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, warum weder die Koordinationsform Einzelberater, noch die der klassischen Unternehmung dauerhafte Stabilität bieten können. Ferner ist zu prüfen, in wie weit ein Netzwerk zwischen Beratern als hybride Koordinationsform geeignet ist, die Vorteile der verschiedenen Seiten stabiler zu verbinden. Dabei gilt es auch, die Nachteile von Netzwerken bezügliche der Problemstellung zu benennen und nach möglichen Verbesserungen zu suchen. Nach einigen grundlegenden Informationen über den deutschsprachigen Beratermarkt geht es im folgenden Kapitel um oben skizzierte Problematik. Dabei werden die Anreizstrukturen der Einzelberater und der angestellten Berater untersucht. Darauf aufbauend folgt in Kapitel vier die Darstellung der Koordinationsform Netzwerk als Hybrid von klassischer Organisation und marktlicher Koordination. Zusammen aus der theoretischen Abhandlung und den Praxiserfahrungen aus dem Netzwerk erfolgt abschließend eine kritische Würdigung der Koordinationsform Netzwerk im Bezug auf die Fragestellung. Als Beispiel und zum Vergleich wird die 1492.//organisationsberatung an verschiedenen Stellen in dieser Arbeit erwähnt. Diese Absätze sind kursiv gehalten. Da nicht zu erwarten ist, dass durch ein Netzwerk automatisch alle Vorteile vereint und alle Nachteile ausgeschlossen werden können, folgen im fünften Kapitel institutionelle Vorschläge, durch die die identifizierten Nachteile behoben werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Beratermarkt
- Einführung in die Problemstellung
- Analyse der Anreizinkompatibilität zwischen Einzelberatern und klassischen Organisationsformen
- Anreizstrukturen am Einzelberatermarkt
- Anreizstruktur einer klassischen Beratungsgesellschaft
- Methoden und theoretische Grundlagen
- Alternative Koordinationsformen
- Netzwerk
- Dynamische Netzwerke (Miles/Snow)
- Kooperative Netzwerke (Thorelli)
- Virtuelle Unternehmen
- Netzwerkgrenzen
- Leistungsspektrum und Potentiale von Netzwerken
- Arbeitsweise/Leistungserstellung
- Institutionelles Anreizsystem von dynamischen Netzwerken
- Netzwerkstruktur und pekuniäre Anreize
- Nichtpekuniäre Nutzen
- Mehr Sicherheit im Netzwerk und gegenüber dem Einzelberatermarkt
- Anreiz zu regelkonformem Verhalten
- Anreiz zum sozialen Miteinander
- Anreiz zur gegenseitigen Unterstützung und Vertrauen
- Verbundvorteile
- Anreiz zu gemeinschaftlichen Investitionen
- Kein Anreiz zum Wachstum des Netzwerkes
- Agentur
- Forschung und Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Anreizstrukturen im Beratermarkt, insbesondere die Herausforderungen, die sich für Einzelberater und klassische Beratungsgesellschaften ergeben. Sie beleuchtet die Anreizinkompatibilitäten und analysiert alternative Koordinationsformen, wie z.B. Netzwerke, um den Herausforderungen zu begegnen.
- Anreizstrukturen im Beratermarkt
- Alternative Koordinationsformen
- Institutionelle Anreizsysteme von dynamischen Netzwerken
- Analyse möglicher institutioneller Anpassungen
- Herausforderungen für Einzelberater und klassische Beratungsgesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik des Beratermarktes und die Motivation für die Untersuchung darlegt. Anschließend wird der Beratermarkt mit seinen Anreizstrukturen und der Anreizinkompatibilität zwischen Einzelberatern und klassischen Organisationsformen näher betrachtet. Die Arbeit analysiert verschiedene Koordinationsformen, insbesondere dynamische und kooperative Netzwerke sowie virtuelle Unternehmen. Im weiteren Verlauf wird das institutionelle Anreizsystem von dynamischen Netzwerken beleuchtet und auf mögliche institutionelle Anpassungen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Anreizstrukturen, Beratermarkt, Einzelberater, klassische Beratungsgesellschaften, Netzwerke, dynamische Netzwerke, kooperative Netzwerke, virtuelle Unternehmen, institutionelle Anreizsysteme, Koordinationsformen und Anpassungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Anreizproblematik bei angestellten Beratern?
Angestellte Berater haben oft den Anreiz, mit eigenen Kundenkontakten aus der Organisation auszutreten, wenn ihr individuelles Einkommen dort höher wäre.
Warum bieten Einzelberater oft keine dauerhafte Stabilität?
Einzelberater leiden unter Kapazitätsschwankungen und fehlender Sicherheit, was sie oft zurück in klassische Organisationsformen treibt.
Was sind "dynamische Netzwerke" im Beratermarkt?
Es handelt sich um hybride Koordinationsformen, die die Flexibilität des Marktes mit der Stabilität einer Organisation verbinden wollen.
Welche nicht-pekuniären Vorteile bieten Berater-Netzwerke?
Dazu gehören gegenseitige Unterstützung, Vertrauen, Wissensaustausch und ein Gefühl des sozialen Miteinanders.
Wie kann ein Netzwerk regelkonformes Verhalten sicherstellen?
Durch institutionelle Anreizsysteme und gegenseitige Abhängigkeiten wird ein Anreiz geschaffen, sich an gemeinsame Regeln zu halten und Trittbrettfahren zu vermeiden.
- Quote paper
- Oliver Menz (Author), 2004, Das Anreizsystem von dynamischen Netzwerken am Einzelberatermarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35407