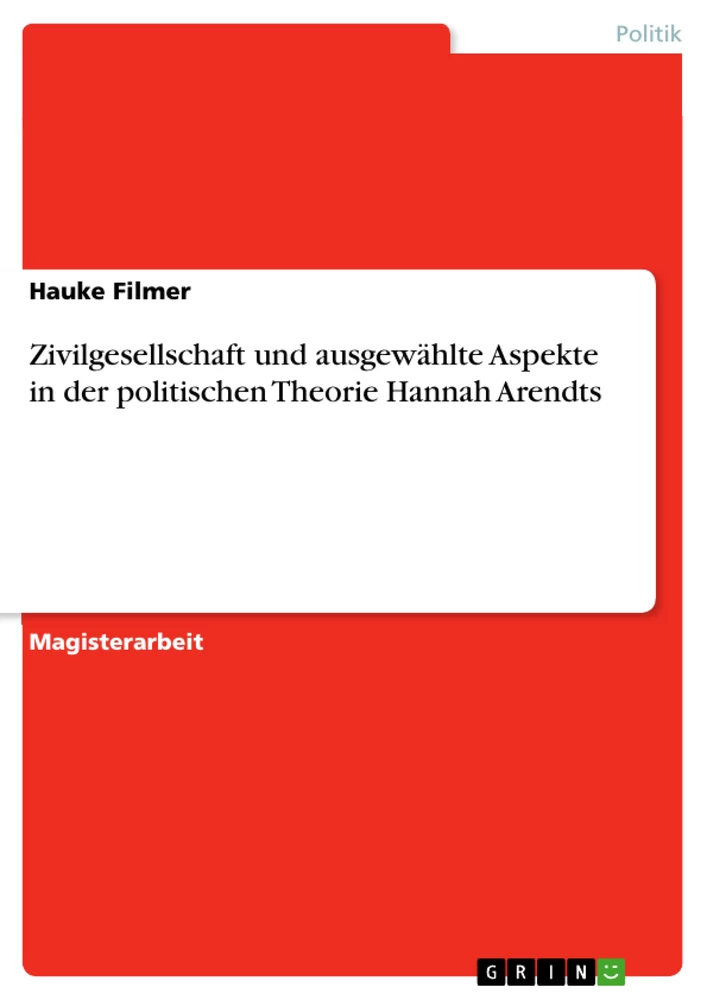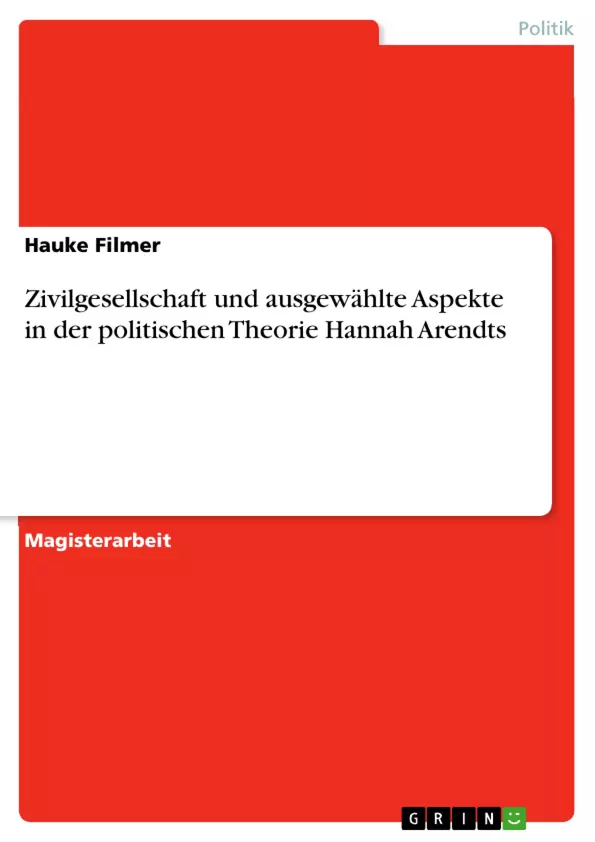Die Magisterarbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Arendts Begriffe der Freiheit, des Handelns, der Öffentlichkeit und der Macht bilden den Rahmen, in dem sich Politik widerspiegelt und in dem sich Politik immer wieder neu konstituieren kann. Im ersten Hauptteil werden deshalb diese ausgewählten Aspekte der politischen Theorie Arendts skizziert. Dabei wird primär auf die beiden Hauptwerke Arendts, „Vita activa“ und „Über die Revolution“ Bezug genommen.
Im zweiten Hauptteil wird ein Bezug der politischen Theorie Arendts zur Zivilgesellschaft hergestellt. Hier wird in einem ersten Schritt der Begriff der Zivilgesellschaft kurz skizziert und Arendts Gesellschaftskritik gegenübergestellt.
Innerhalb der deutschen Zivilgesellschaftsdebatte hat die Autorengruppe Ulrich Rödel, Günter Frankenberg und Helmut Dubiel Hannah Arendts politische Theorie, insbesondere ihren Begriff positiver Freiheit, zur Begründung eines Modells demokratischer Selbstregierung herangezogen. In Kapitel 11 werde ich deshalb auf den Essay „Die demokratische Frage“ eingehen, in welchem die Autoren ein „neorepublikanisches Projekt der Selbstregierung [formulieren,], das um die Frage kreist, wie Arendts emphatisches Projekt des Politischen auf Dauer gestellt und veralltäglicht werden kann.“ Hier werde ich schwerpunktmäßig auf das Phänomen des zivilen Ungehorsams eingehen, das neben Arendts Interpretation der Amerikanischen Revolution den Ausgangspunkt für die Theorie der Autoren bildet.
Da Arendts Politiktheorie wegen ihres positiven Rückbezugs auf die griechische Antike immer wieder in der Kritik steht, sie habe elitär-aristokratische Züge und sei aus diesem Grund nicht für eine gegenwärtige Demokratietheorie verwertbar, werde ich in dem Abschnitt „Elitismus“ auf diese Kritik eingehen. Hier werde ich versuchen zu zeigen, dass es sich in der Arendt‘schen Theorie um einen nicht-konventionellen Begriff der Elite handelt, der auch mit demokratischen bzw. zivilgesellschaftlichen Theorien vereinbar ist.
Zum Schluss werde ich aus theoretischer Perspektive das Weltsozialforum als zivilgesellschaftlich-politisches bzw. demokratisches Phänomen mit Rückgriff auf die politische Theorie Arendts beschreiben. Ich werde hierbei vor allem auf ihren Begriff der Macht, ihre Handlungstheorie und die entscheidende Frage, wie öffentliche Sphären als Räume politischen Handelns entstehen und auf Dauer bestehen können, eingehen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Inhaltsverlauf
- 3 Politische Freiheit
- 3.1 Positive und negative Freiheit
- 3.2 Arendts Konzept politischer Freiheit
- 4 Vita activa
- 4.1 Arbeiten
- 4.2 Herstellen
- 4.3 Handeln
- 5 Der öffentliche Raum
- 5.1 Erscheinungsraum
- 5.2 Gemeinsame Welt
- 5.3 „Künstlichkeit“ politischen Lebens
- 5.4 Der räumliche Charakter politischen Lebens
- 5.5 Der agonistische Charakter des öffentlichen Raumes
- 5.6 Öffentlich / Privat
- 6 Das Phänomen der Macht
- 6.1 Macht und Gewalt
- 6.2 Intransitive Macht
- 6.3 Macht und Totalitarismus
- 6.4 Die Rolle der Macht in der Amerikanischen und der Französischen Revolution
- 7 Urteilskraft
- 2. Hauptteil: Hannah Arendt und Zivilgesellschaft
- 8 Der Begriff der Zivilgesellschaft
- 9 Arendts Gesellschaftsbegriff
- 10 Elitismus
- 11 Ziviler Ungehorsam und das „Projekt demokratischer Selbstregierung“
- 12 Weltsozialforum
- 12.1 Das WSF als politischer Neubeginn
- 12.2 Das WSF als politischer Raum
- 12.3 Das WSF und das Phänomen der Macht
- 13 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Magisterarbeit setzt sich zum Ziel, Hannah Arendts politische Theorie auf den Begriff der Zivilgesellschaft anzuwenden und anhand des Beispiels des Weltsozialforums zu analysieren, inwiefern das Konzept der „Vita activa“ und der „öffentlichen Raum“ auf aktuelle politische Prozesse und Entwicklungen übertragen werden kann.
- Arendts Konzept der „Vita activa“ und seine Relevanz für die Zivilgesellschaft
- Der öffentliche Raum als Ort der politischen Partizipation und des Handelns
- Das Weltsozialforum als Beispiel für einen „neuen“ öffentlichen Raum
- Die Rolle der Macht in der Zivilgesellschaft und im Kontext des Weltsozialforums
- Ziviler Ungehorsam als Ausdruck politischer Freiheit und Handlungsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und beleuchtet die Relevanz von zivilgesellschaftlichem Engagement für das Funktionieren von Demokratien. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Hannah Arendts politischer Theorie und dem Begriff der Zivilgesellschaft her und zeigt die Bedeutung des Themas im Kontext der aktuellen Debatten um die Zukunft der Demokratie auf.
Kapitel 3 behandelt Arendts Konzept der politischen Freiheit, indem es zwischen positiver und negativer Freiheit unterscheidet und Arendts Verständnis von politischer Freiheit als aktives, handlungsorientiertes Engagement in der Öffentlichkeit beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich dem zentralen Konzept der „Vita activa“, das Arendts politisches Denken prägt. Es werden die drei Formen des menschlichen Handelns - Arbeiten, Herstellen und Handeln - dargestellt und deren Bedeutung für die politische Sphäre erläutert.
Kapitel 5 untersucht den öffentlichen Raum als Ort der politischen Partizipation. Hier wird die Bedeutung des öffentlichen Raumes für die Entstehung von Gemeinschaft, für die Bildung von Meinung und für die Ausübung politischer Macht aufgezeigt. Es werden verschiedene Aspekte des öffentlichen Raumes, wie seine „Künstlichkeit“, sein räumlicher Charakter und sein agonistischer Charakter, analysiert.
Kapitel 6 beleuchtet das Phänomen der Macht in Arendts Theorie. Es wird zwischen Macht und Gewalt unterschieden und Arendts Verständnis von Macht als ein relationales Phänomen, das auf der Fähigkeit zur gemeinsamen Handlung beruht, dargestellt. Außerdem wird die Rolle der Macht im Kontext von Totalitarismus und Revolution beleuchtet.
Kapitel 7 behandelt Arendts Konzept der Urteilskraft, das eine wichtige Rolle für die politische Praxis spielt. Die Urteilskraft ermöglicht es dem Menschen, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, politische Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.
Kapitel 8 widmet sich dem Begriff der Zivilgesellschaft und seinen unterschiedlichen Bedeutungen. Es werden verschiedene Definitionen und Ansätze zur Analyse der Zivilgesellschaft vorgestellt und ihre Rolle im Kontext von Demokratie und politischer Partizipation diskutiert.
Kapitel 9 analysiert Arendts eigenen Gesellschaftsbegriff und seine Relevanz für die Zivilgesellschaft. Es wird untersucht, inwiefern Arendts Theorie der „Vita activa“ und des „öffentlichen Raumes“ zur Erklärung von zivilgesellschaftlichem Engagement und zur Analyse der aktuellen Entwicklungen in der Zivilgesellschaft beitragen kann.
Kapitel 10 beschäftigt sich mit dem Thema des Elitismus in Arendts Werk. Es wird untersucht, ob Arendts Theorie einen elitistischen Charakter trägt und wie sich dies auf ihre Analyse der Zivilgesellschaft auswirkt.
Kapitel 11 analysiert das Phänomen des zivilen Ungehorsams als Ausdruck politischer Freiheit und Handlungsfähigkeit. Es werden die Bedeutung des zivilen Ungehorsams für die demokratische Selbstregierung und die Verbindung zu Arendts Theorie der politischen Handlung untersucht.
Kapitel 12 analysiert das Weltsozialforum als ein Beispiel für einen „neuen“ öffentlichen Raum. Es wird untersucht, inwiefern das Weltsozialforum den Kriterien von Arendts Theorie des „öffentlichen Raumes“ gerecht wird und wie es die Chancen und Herausforderungen der Zivilgesellschaft im 21. Jahrhundert widerspiegelt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf die zentrale Frage, wie Hannah Arendts politische Theorie auf das Konzept der Zivilgesellschaft angewendet werden kann. Dabei werden zentrale Begriffe und Konzepte wie „Vita activa“, „öffentlicher Raum“, „Macht“, „Ziviler Ungehorsam“ und „demokratische Selbstregierung“ analysiert. Das Weltsozialforum dient als ein exemplarisches Beispiel für einen „neuen“ öffentlichen Raum im Kontext der Globalisierung und der Herausforderungen der modernen Zivilgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Begriffe in Hannah Arendts politischer Theorie?
Die wichtigsten Begriffe sind Freiheit, Handeln, Öffentlichkeit und Macht, die den Rahmen für die Konstituierung von Politik bilden.
Was versteht Arendt unter der „Vita activa“?
Die Vita activa umfasst drei Grundtätigkeiten des Menschen: Arbeiten (Lebensnotwendigkeit), Herstellen (Weltlichkeit) und Handeln (Interaktion im öffentlichen Raum).
Welche Bedeutung hat der öffentliche Raum?
Er ist der Erscheinungsraum, in dem Menschen durch gemeinsames Handeln und Sprechen politisch aktiv werden und eine gemeinsame Welt schaffen.
Wie wird Arendts Theorie auf die Zivilgesellschaft angewendet?
Die Arbeit nutzt Arendts Konzepte, um Modelle demokratischer Selbstregierung und Phänomene wie zivilen Ungehorsam zu begründen.
Welche Rolle spielt das Weltsozialforum in der Arbeit?
Das Weltsozialforum wird als modernes Beispiel für einen öffentlichen Raum analysiert, in dem globale zivilgesellschaftliche Macht durch gemeinsames Handeln entsteht.
- Quote paper
- Hauke Filmer (Author), 2010, Zivilgesellschaft und ausgewählte Aspekte in der politischen Theorie Hannah Arendts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354132