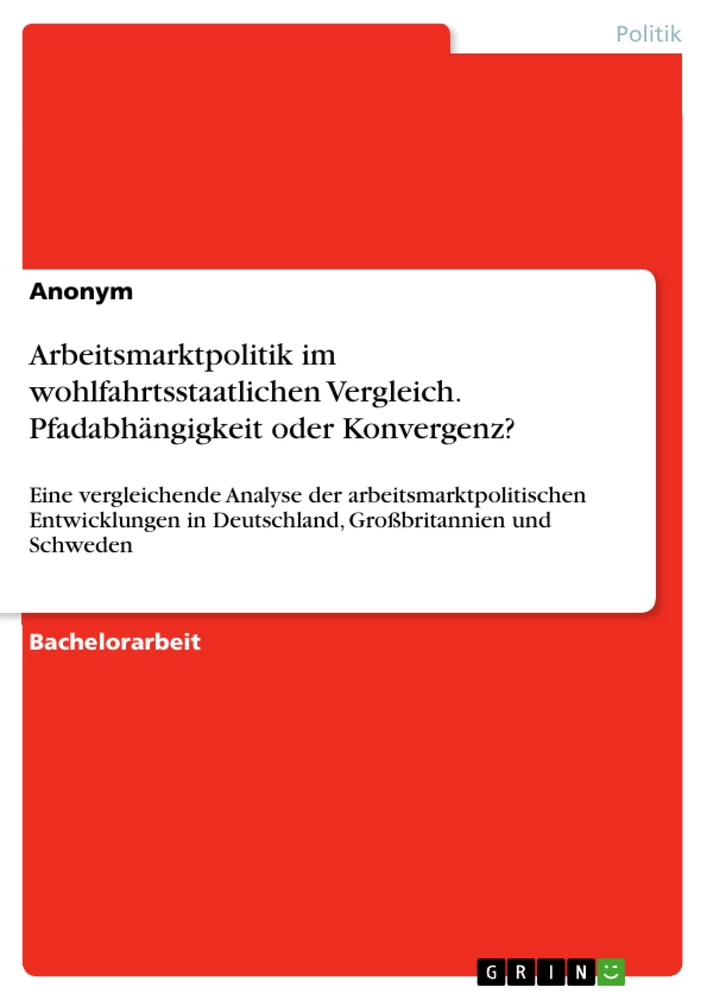Diese Arbeit beschäftigt sich damit, ob sich unterschiedliche Wohlfahrtsregime durch den entstandenen Globalisierungsdruck annähern. Vermutet wird dabei ein „race to the bottom“, also ein Wettlauf nach unten bei der Absicherung, verursacht durch eine Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten der Kapitalseite. Diese Verschiebung resultiert aus einem, durch die Globalisierung entstandenen, Standortwettbewerb, der die Staaten dazu zwingt, attraktive wirtschaftliche Bedingungen auf Kosten der sozialen Sicherung der Bevölkerung zu schaffen.
Ob ein wohlfahrtsstaatlicher Rückbau festgestellt werden kann, soll durch den Vergleich der Länder Deutschland, Großbritannien und Schweden im Bereich der Arbeitsmarktpolitik geprüft werden. Untersucht werden sowohl Einschnitte in der passiven Leistungserbringung im Falle von Erwerbslosigkeit als auch die Entwicklung im Bereich der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik. Diese Fallauswahl ist deshalb getroffen worden, da diese Länder jeweils ein unterschiedliches Wohlfahrtsregime repräsentieren, wie von Gøsta Esping-Andersen 1990 in seinem Werk „The Three Worlds of Welfare Capitalism“ eingeführt.
Der folgende erste inhaltliche Abschnitt dieser Arbeit soll sich einem kurzen Abriss der historischen Entstehung und Expansion von Wohlfahrtsstaatlichkeit sowie der bedeutenden typologischen Einordnung von Gøsta Esping-Andersen widmen. Das dritte Kapitel befasst sich dann mit dem Phänomen der Globalisierung und den unterschiedlichen, in der Wissenschaft vertretenen, Meinungen zu deren Auswirkung auf entwickelte Wohlfahrtsstaaten. Im vierten Kapitel dieser Arbeit werden dann die aufgestellten Hypothesen und das methodische Vorgehen zur Überprüfung dieser näher erläutert, bevor dann im Hauptteil die arbeitsmarktpolitischen Reformen der Untersuchungsländer qualitativ miteinander verglichen werden.
In einem kurzen Zwischenfazit werden dann die ersten Schlussfolgerungen aus der qualitativen Analyse gezogen, bevor dann im letzten inhaltlichen Abschnitt, zur Schaffung einer besseren Beurteilungsgrundlage, auch quantitative Kennwerte in die Untersuchung einbezogen werden. Abschließend werden dann die Erkenntnisse der qualitativen und der quantitativen Analyse miteinander verknüpft um im Fazit eine Aussage zu den eingangs aufgestellten Hypothesen treffen zu können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Wohlfahrtsstaatlichkeit: Einführung
- 2.1 Definition und historische Entwicklung
- 2.2 Theorien wohlfahrtsstaatlicher Entwicklung
- 2.3 Esping-Andersen: The Three Worlds Of Welfare Capitalism
- 3. Globalisierung
- 3.1 Globalisierung: Begriff und Definition
- 3.2 Globalisierungseffekte: Meinungen und Stand der Forschung
- 3.3 Auswirkungen auf westeuropäische Arbeitsmärkte
- 4. Hypothesen und methodisches Vorgehen
- 5. Arbeitsmarktreformen im Vergleich
- 5.1 Schweden
- 5.2 Großbritannien
- 5.3 Deutschland
- 5.4 Zwischenfazit qualitative Analyse
- 6. Vergleich quantitativer Kennwerte
- 7. Fazit: Pfadabhängigkeit oder Konvergenz?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf den Wohlfahrtsstaat und analysiert, ob sich unterschiedliche Wohlfahrtsregime aufgrund des globalen Drucks annähern. Sie untersucht, ob ein „race to the bottom“ stattfindet, bei dem Staaten aufgrund des Standortwettbewerbs soziale Sicherungssysteme auf Kosten der Bevölkerung abbauen.
- Definition und historische Entwicklung von Wohlfahrtsstaatlichkeit
- Theorien der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung
- Globalisierung und ihre Auswirkungen auf entwickelte Wohlfahrtsstaaten
- Vergleich von Arbeitsmarktreformen in Schweden, Großbritannien und Deutschland
- Qualitative und quantitative Analyse der Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung erläutert den zentralen Stellenwert von Wohlfahrtsstaatlichkeit in modernen Demokratien und stellt die Herausforderungen durch die Globalisierung dar.
- Kapitel 2: Wohlfahrtsstaatlichkeit: Einführung: Dieses Kapitel definiert den Begriff Wohlfahrtsstaatlichkeit, beleuchtet seine historische Entwicklung und stellt die unterschiedlichen Ansätze und Typologien vor, insbesondere das Werk von Gøsta Esping-Andersen.
- Kapitel 3: Globalisierung: Das Kapitel widmet sich dem Phänomen der Globalisierung, definiert den Begriff und diskutiert die verschiedenen Meinungen über seine Auswirkungen auf entwickelte Wohlfahrtsstaaten.
- Kapitel 4: Hypothesen und methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die aufgestellten Hypothesen und die methodischen Ansätze zur Überprüfung dieser Hypothesen.
- Kapitel 5: Arbeitsmarktreformen im Vergleich: Dieses Kapitel beinhaltet einen qualitativen Vergleich der Arbeitsmarktpolitik in Schweden, Großbritannien und Deutschland.
- Kapitel 6: Vergleich quantitativer Kennwerte: Dieses Kapitel integriert quantitative Kennwerte in die Analyse, um die qualitative Analyse zu ergänzen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Wohlfahrtsstaatlichkeit, Globalisierung, Arbeitsmarktpolitik, soziale Sicherungssysteme, Standortwettbewerb und Pfadabhängigkeit. Sie analysiert verschiedene Wohlfahrtsregime, insbesondere die von Esping-Andersen entwickelten Modelle, und untersucht, ob die Globalisierung zu einer Annäherung oder Konvergenz der Wohlfahrtsstaaten führt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist mit dem „race to the bottom“ im Wohlfahrtsstaat gemeint?
Es beschreibt die Vermutung, dass Staaten ihre sozialen Sicherungssysteme abbauen, um im globalen Standortwettbewerb attraktivere Bedingungen für das Kapital zu schaffen.
Welche drei Länder werden in der Studie verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Arbeitsmarktpolitik von Deutschland, Großbritannien und Schweden, da diese unterschiedliche Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen repräsentieren.
Was sind die „Three Worlds of Welfare Capitalism“?
Ein Typologiemodell von Gøsta Esping-Andersen, das Wohlfahrtsstaaten in liberale, konservative und sozialdemokratische Regime unterteilt.
Führt Globalisierung zur Konvergenz der Sozialsysteme?
Die Arbeit untersucht, ob sich die verschiedenen Systeme einander annähern (Konvergenz) oder ob sie trotz des Drucks ihren eigenen historischen Pfaden treu bleiben (Pfadabhängigkeit).
Welche Bereiche der Arbeitsmarktpolitik werden untersucht?
Untersucht werden sowohl die passive Leistungserbringung (z.B. Arbeitslosengeld) als auch die Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Arbeitsmarktpolitik im wohlfahrtsstaatlichen Vergleich. Pfadabhängigkeit oder Konvergenz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354226