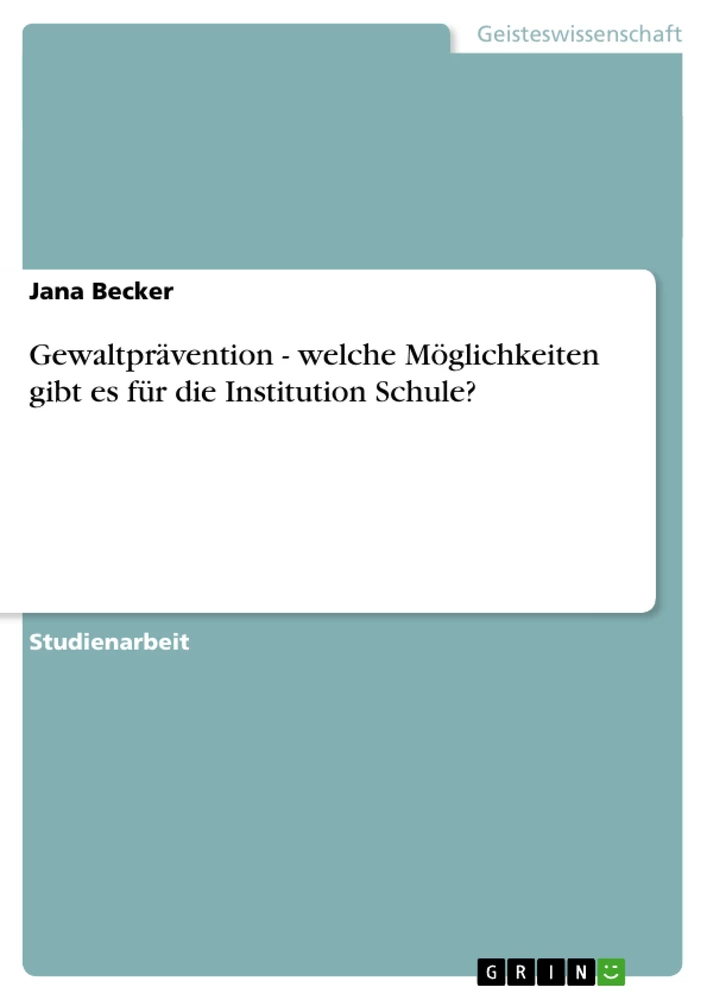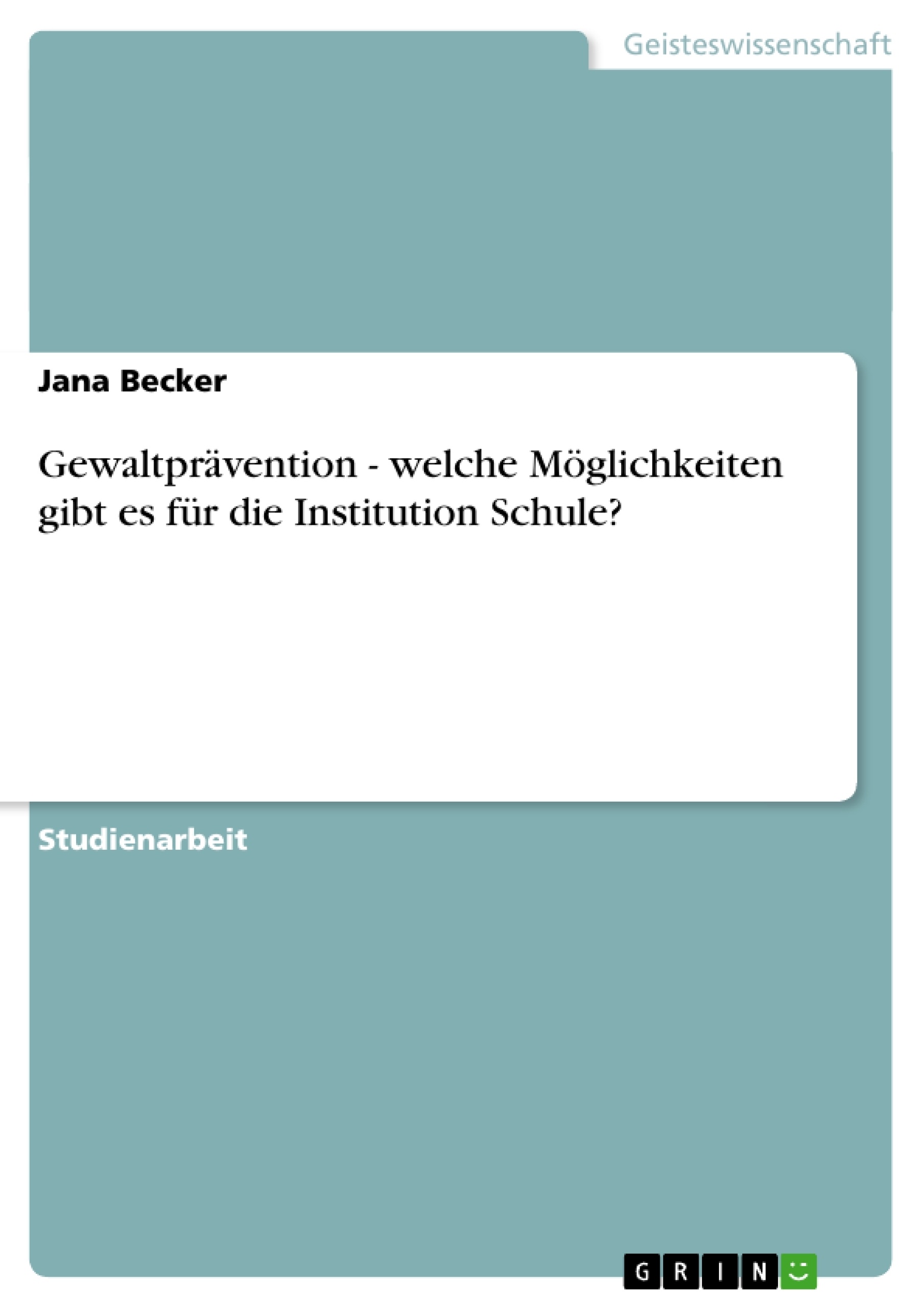Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Problem gewalttätiger SchülerInnen auseinander. Es soll darum gehen, inwieweit Schule bei der Prävention von Gewaltverhalten präventiv wirken kann. Um Gewalt vorbeugen zu können, muss man eine Vorstellung davon haben, wodurch Gewalt entsteht bzw. wie sie ausgelöst wird. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze, von denen ich im Folgenden zwei vorstellen werde.
Klaus Hurrelmann auf der einen Seite sieht gewalttätiges Verhalten als fehlende soziale Kompetenz, die er im weitesten Sinne auf die Veränderte Kindheit zurückführt. Die Projektgruppe „Schulen ohne Gewalt“ auf der anderen Seite sieht Gewalt begründet in einem fehlenden oder falschen Selbstbewusstsein. Beide Ansätze entwickeln Leitideen für eine positive Einwirkung der Schulen auf ihre SchülerInnen.
Im Folgenden sollen jeweils die Ansätze über die Entstehung von Gewalt ebenso wie die daraus gewonnen Konsequenzen für die Schule dargestellt werden.
Ob und inwieweit sich diese Ansätze überschneiden oder ob sie womöglich gegensätzlich sind, wird sich am Ende dieser Arbeit zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klaus Hurrelmann: Gewalt ist ein Symptom für fehlende soziale Kompetenz
- Die Ursachen von Gewaltverhalten
- Möglichkeiten der Schule zur Gewaltprävention
- Das Projekt „Schulen ohne Gewalt“
- Entstehung des Projektes „Schulen ohne Gewalt“
- Die Ursachen von Gewaltverhalten - das systemische Grundmodell
- Die Bedeutung des Selbstbewusstseins
- Die Bedeutung der Kooperation
- Die Entwicklung der Kooperation
- Die Durchführung des Projektes
- Einige Projektbausteine
- Ergebnisse des Projektes
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Schule bei der Prävention von Gewaltverhalten bei SchülerInnen. Sie beleuchtet die Entstehungsursachen von Gewalt aus unterschiedlichen Perspektiven und zeigt auf, wie die Schule präventiv eingreifen kann.
- Die Ursachen von Gewaltverhalten aus der Sicht von Klaus Hurrelmann
- Das systemische Grundmodell des Projektes „Schulen ohne Gewalt“
- Die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Kooperation für die Gewaltprävention
- Die Möglichkeiten der Schule, Gewaltverhalten zu präventiv zu begegnen
- Die Ergebnisse des Projektes „Schulen ohne Gewalt“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik von Gewaltverhalten in Schulen dar und skizziert die verschiedenen Ansätze zur Erklärung und Prävention von Gewalt.
- Klaus Hurrelmann: Gewalt ist ein Symptom für fehlende soziale Kompetenz: Dieser Abschnitt beleuchtet die Ursachen von Gewalt aus Sicht von Klaus Hurrelmann, der Gewalt als Ausdruck von mangelnder sozialer Kompetenz interpretiert. Er führt diese auf die Lebensbedingungen heutiger Kinder und Jugendlicher zurück, die von Unsicherheit und mangelnder Stabilität geprägt sind.
- Das Projekt „Schulen ohne Gewalt“: Der Abschnitt stellt das Projekt „Schulen ohne Gewalt“ vor, das sich mit dem systemischen Ansatz zur Erklärung von Gewaltverhalten auseinandersetzt. Es betont die Bedeutung des Selbstbewusstseins und der Kooperation für die Prävention von Gewalt.
- Einige Projektbausteine: Dieser Abschnitt beschreibt die einzelnen Bausteine des Projektes „Schulen ohne Gewalt“ und deren konkrete Umsetzung in der Praxis.
- Ergebnisse des Projektes: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse des Projektes „Schulen ohne Gewalt“ und zeigt auf, wie das Projekt die Gewaltprävention an Schulen verbessert.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Schule, soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein, Kooperation, systemischer Ansatz, Projekt „Schulen ohne Gewalt“, außerschulische Faktoren, Leistungsdruck, Identifikation mit der Schule.
- Quote paper
- Jana Becker (Author), 2004, Gewaltprävention - welche Möglichkeiten gibt es für die Institution Schule?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35429