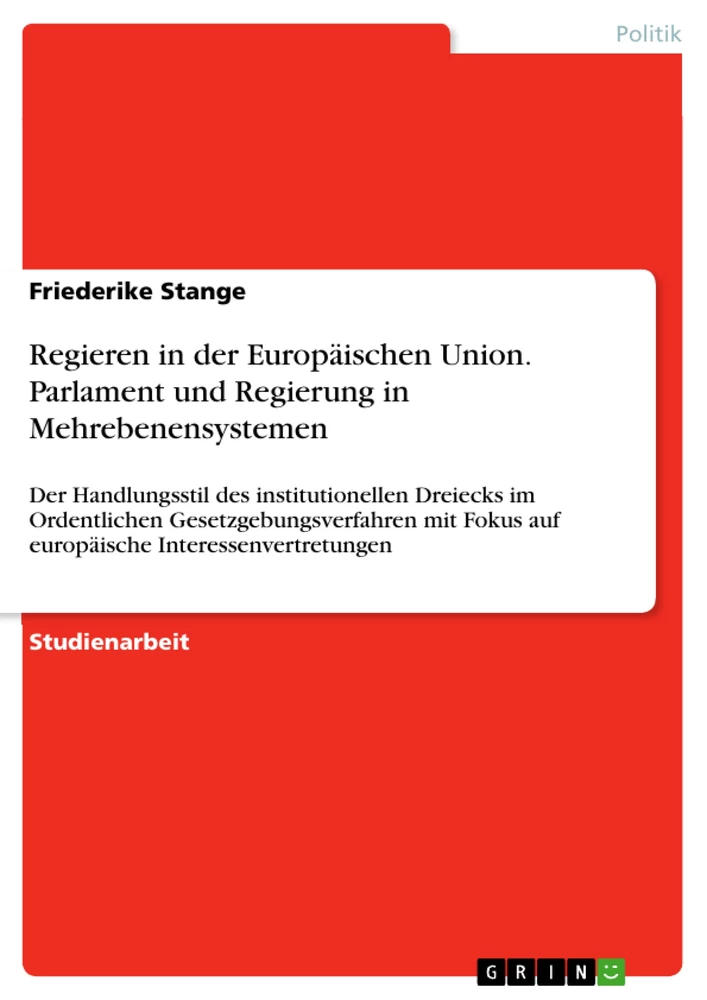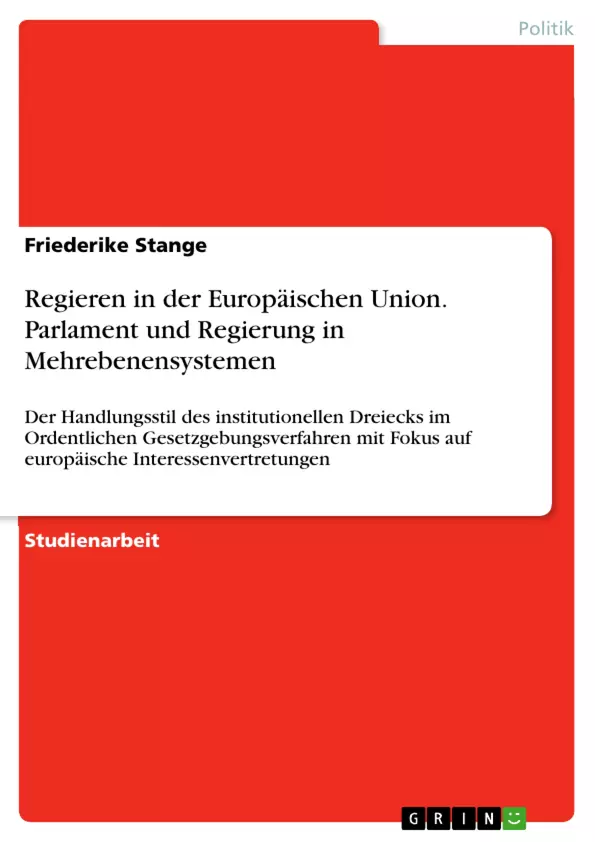Brüssel wird auch die „Hauptstadt Europas“ genannt, da hier unter anderem die gesetzgeberisch tätigen Institutionen der Europäischen Union, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union – also das Institutionendreieck – ihren Sitz haben. Im Europaviertel der belgischen Hauptstadt sind zudem „enorm viele Lobbybüros von Unternehmen, die hier Büros eröffnet haben, um EU-Entscheidungen zu beeinflussen“, angesiedelt. So konstatiert Olivier Hoedeman, ein Mitarbeiter von Corporate Europe Observatory (CEO). Die Mitglieder dieser Nichtregierungsorganisation gehen seit 1997 der Aufgabe nach, den Einfluss von Lobbygruppen auf europäische Entscheidungsprozesse offenzulegen. Das gleicht einer Mammutaufgabe, denn das Transparenz-Register der Europäischen Kommission hat im Jahr 2016 über 9000 Organisationen erfasst. Die Europäische Kommission erklärt dazu wie folgt:
„Die EU-Organe interagieren mit einem breiten Spektrum von Gruppen und Organisationen, die Sonderinteressen vertreten. Dies ist ein legitimes und notwendiges Element des Entscheidungsprozesses (…) Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission verpflichten sich, nicht zu verbergen, mit welchen Gruppen und Organisationen sie zusammenwirken.“
Die Eintragung in das Transparenz-Register der Europäischen Kommission ist, trotz Kritik seitens des Europäischen Parlaments und Organisationen wie CEO, eine freiwillige Leistung der Interessenvertreter.
Der rasante Anstieg von Vertretern, waren es 2011 noch knapp 1000 registrierte Organisationen und Berater, die einen Einfluss auf europäische Entscheidungsprozesse vollziehen wollten, erklärt die Relevanz des Sujets der vorliegenden Arbeit: Wie gestaltet sich Regieren des institutionellen Dreiecks der Europäischen Union im Rahmen des Ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens vor dem Hintergrund von 9969 Interessenvertretungen?
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsgegenstand, Fragestellung und Aufbau der Arbeit...
- Die EU als Konkordanzdemokratie nach Arend Lijphart
- Regieren in der Europäischen Union……….....
- Das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren
- Das institutionelle Dreieck
- Interessenvertretungen in der EU
- Schlussbetrachtungen: Das institutionelle Viereck der EU?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Handlungsstil des institutionellen Dreiecks im Ordentlichen Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union vor dem Hintergrund der Vielzahl an Interessenvertretungen. Sie analysiert, wie die EU-Institutionen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses mit den Interessenvertretungen interagieren und welche Auswirkungen dies auf die Entscheidungsfindung hat.
- Das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren als zentraler Mechanismus der EU-Gesetzgebung
- Die Rolle des institutionellen Dreiecks (Europäisches Parlament, Europäische Kommission, Rat der Europäischen Union) im Gesetzgebungsprozess
- Der Einfluss von Interessenvertretungen auf das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren
- Die Herausforderungen des Regierens in der EU im Kontext der Interessenvielfalt
- Die Relevanz des Transparenz-Registers der Europäischen Kommission für die Regulierung des Lobbyismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit erläutert den Forschungsgegenstand, die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit. Es werden die zentralen Begriffe und Konzepte der Arbeit definiert und die Forschungsmethodik vorgestellt.
Das zweite Kapitel beleuchtet die EU als Konkordanzdemokratie nach Arend Lijphart. Es werden die zentralen Merkmale dieses Demokratiemodells dargestellt und auf die EU übertragen.
Das dritte Kapitel behandelt das Regieren in der Europäischen Union. Es werden das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren sowie das institutionelle Dreieck im Detail analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Interessenvertretungen in der EU. Es werden die verschiedenen Formen und Funktionen von Interessenvertretungen in der EU dargestellt und ihre Bedeutung für den Gesetzgebungsprozess beleuchtet.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Ordentliches Gesetzgebungsverfahren, institutionelles Dreieck, Interessenvertretungen, Lobbyismus, Transparenz-Register, Konkordanzdemokratie, Arend Lijphart, Regieren in der EU
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "institutionelle Dreieck" der EU?
Es besteht aus der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union, die gemeinsam die Gesetzgebung der EU gestalten.
Was ist das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren?
Es ist das Standardverfahren der EU-Gesetzgebung, bei dem das Parlament und der Rat gleichberechtigt über Vorschläge der Kommission entscheiden.
Wie groß ist der Einfluss von Lobbyisten in Brüssel?
Mit über 9.000 registrierten Organisationen ist der Lobbyismus sehr präsent. Interessenvertreter versuchen, frühzeitig Einfluss auf die Richtlinien und Verordnungen der Kommission zu nehmen.
Was ist das Transparenz-Register der EU?
Es ist eine Datenbank, in der sich Interessenvertreter eintragen müssen, um Informationen über ihre Ziele und Budgets offenzulegen, wenn sie mit EU-Organen interagieren.
Was versteht man unter einer Konkordanzdemokratie?
Nach Arend Lijphart ist dies ein Demokratiemodell, das auf Konsens und Machtteilung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen oder politischen Gruppen basiert, ähnlich wie in der EU.
- Quote paper
- Friederike Stange (Author), 2016, Regieren in der Europäischen Union. Parlament und Regierung in Mehrebenensystemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354370