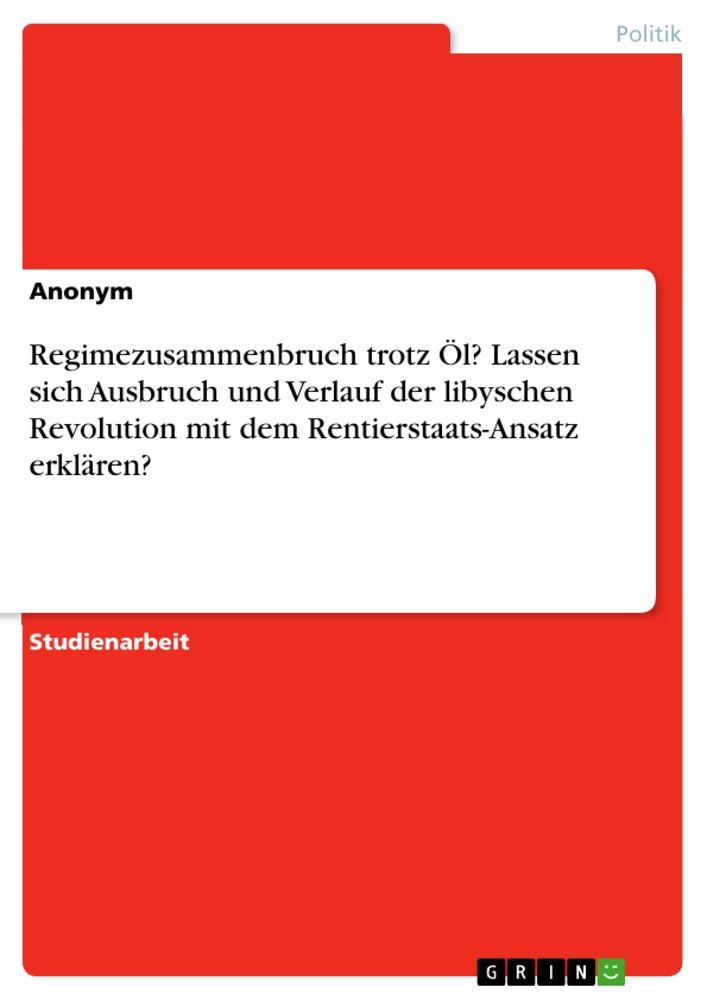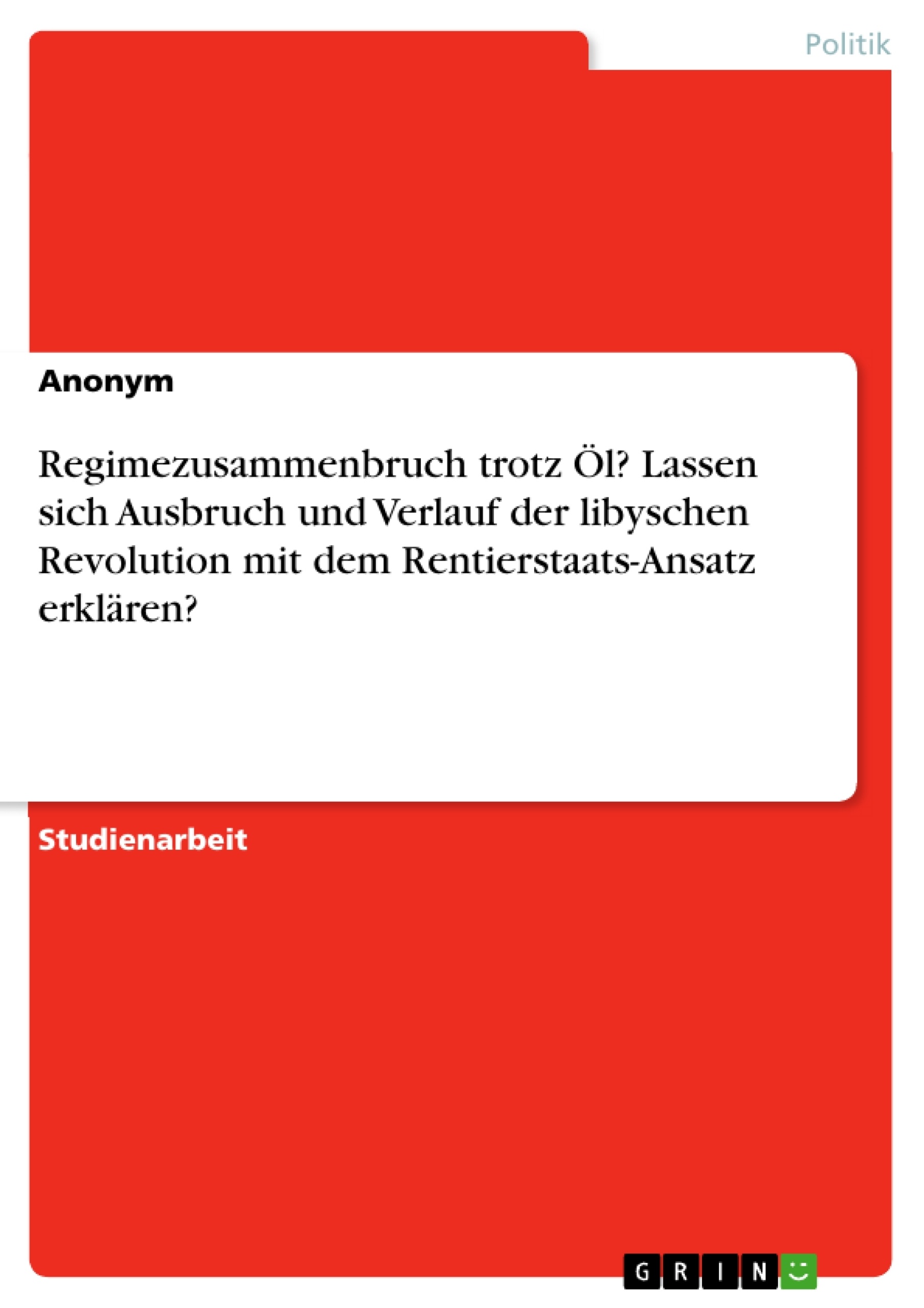Vier Jahre nach den weitreichenden Umwälzungen in der arabischen Welt bleiben aus politikwissenschaftlicher Sicht noch immer viele Fragen offen. Neben der nötigen Analyse von Ausbruch, Verlauf und Ergebnis der Proteste, stellt sich auch die Frage, ob alte Konzepte einen Erklärungsbeitrag leisten können oder ob sie an Erklärungspotential eingebüßt haben. In den letzten beiden Jahrzehnten galten die Bestrebungen der Forschung vor allem dem Ziel, den „Sonderweg“ der MENA-Region, die nur in geringem Maß an den globalen Phänomenen der Globalisierung und Demokratisierung teilnahm, näher zu erklären. Einen substanziellen Beitrag dazu lieferte der von Hazem Beblawi und Giacomo Luciani in ihrem Sammelband von 1987 grundlegend eingeführte Rentierstaats-Ansatz. Seine zentralen Thesen sind, dass sich in Staaten mit hohem Rentenbezug autoritäre Strukturen verfestigen und entwicklungspolitisch defizitäre Wege beschritten werden. In seiner vielbeachteten Groß-N-Studie aus dem Jahr 2001 überprüfte Michael Ross die zentralen Thesen des Ansatzes und kam zum Schluss: „(...) oil does hurt democracy.“ (Ross 2001: 356). Auch im deutschen Sprachraum erlangte der Ansatz Prominenz, wobei besonders die Publikationen von Peter Pawelka. Während nur wenige Autoren den generellen Zusammenhang von hohen Ölrenten und ausbleibender Demokratisierung anzweifeln, werden dem Ansatz gemeinhin eine hohe Erklärungskraft für die MENA-Region sowie begriffliche Klarheit, Interdisziplinarität und Innovationsfähigkeit attestiert.
Doch welche Implikationen ergeben sich für die Rentierstaats-These nach den Umwälzungen des „Arabischen Frühlings“? Zunächst kann festgehalten werden, dass praktisch alle Staaten, die keinen systemgefährdeten Unruhen ausgesetzt waren, hohe Ölrenten bezogen. Während die Proteste in den ölreichen Golfstaaten eher begrenzt blieben, kam es in ölarmen Ländern zur Regimekrise (Syrien) oder gar zum Umsturz (Ägypten, Tunesien). Die offensichtlichen Ausnahmen dieses Befundes bilden die Geschehnisse in Bahrain und Libyen. Diese Arbeit macht es sich zur Aufgabe, den letzteren der beiden abweichenden Fälle näher zu untersuchen. Zwar wäre es Gaddafi ohne die Intervention der NATO im Februar 2011 wohl gelungen, sich an der Macht zu halten, dennoch bleibt erklärungsbedürftig, warum es überhaupt erst zu den systemgefährdenden Protesten im Land kam.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Rente, Rentierstaat und rent-seeking.
- Der Rentierstaats-Ansatzes.
- Fallstudie Libyen
- Libyen als Rentenstaat.
- Überprüfung der Hypothesen
- Zum Erklärungspotential des Rentierstaats-Ansatzes
- Ungleichverteilung der Renten.
- Ende des ,,Arabischen Sozialvertrags“.
- Zerstörung ziviler Institutionen.
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Rentierstaats-Ansatz den Ausbruch und Verlauf der libyschen Revolution erklären kann. Sie untersucht, ob der hohe Ölrentenbezug in Libyen zu autoritären Strukturen und entwicklungspolitischen Defiziten geführt hat, die letztendlich die Revolution auslösten.
- Der Rentierstaats-Ansatz und seine zentralen Thesen
- Libyen als Rentierstaat und die Folgen des hohen Ölrentenbezugs
- Die Rolle der Ölrenten im Ausbruch und Verlauf der libyschen Revolution
- Das Erklärungspotenzial des Rentierstaats-Ansatzes für die libyschen Ereignisse
- Die Auswirkungen der Revolution auf das libysche Rentensystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Das Kapitel „Theoretische Grundlagen“ erläutert die zentralen Begriffe des Rentierstaats-Ansatzes, wie Rente, Rentierstaat und rent-seeking. Die Fallstudie Libyen analysiert Libyen als Rentierstaat und überprüft die Hypothesen des Ansatzes anhand der libyschen Geschichte. Das Kapitel „Zum Erklärungspotential des Rentierstaats-Ansatzes“ diskutiert die Schwächen und Stärken des Ansatzes im Hinblick auf die Erklärung der libyschen Revolution. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Rentierstaat, Ölrente, rent-seeking, Libyen, Revolution, autoritäre Strukturen, politische Institutionen, Entwicklung, „Arabischer Frühling“, MENA-Region.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernbotschaft des Rentierstaats-Ansatzes?
Der Ansatz besagt, dass Staaten mit hohen Einnahmen aus Rohstoffrenten (wie Öl) dazu neigen, autoritäre Strukturen zu verfestigen, da sie keine Steuern von Bürgern benötigen und somit weniger Rechenschaft schuldig sind.
Kann der Ansatz den Sturz von Gaddafi in Libyen erklären?
Die Arbeit untersucht dies kritisch: Während Ölrenten das Regime stabilisierten, führten die Ungleichverteilung der Renten und die Zerstörung ziviler Institutionen letztlich zu systemgefährdenden Protesten.
Was versteht man unter "rent-seeking"?
Rent-seeking beschreibt das Bestreben von Akteuren, sich Anteile an den staatlichen Renteneinnahmen zu sichern, ohne dafür eine produktive Gegenleistung zu erbringen, was oft zu Korruption führt.
Was war der "Arabische Sozialvertrag"?
Es war ein implizites Abkommen, bei dem der Staat soziale Leistungen und Wohlstand bot, während die Bevölkerung im Gegenzug auf politische Partizipationsrechte verzichtete.
Warum gilt Libyen als abweichender Fall der Rentierstaats-These?
Weil es trotz extrem hoher Ölrenten zu einer erfolgreichen Revolution kam, während die Theorie eigentlich besagt, dass "Öl die Demokratie beschädigt" und Regimes stabilisiert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Regimezusammenbruch trotz Öl? Lassen sich Ausbruch und Verlauf der libyschen Revolution mit dem Rentierstaats-Ansatz erklären?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354462