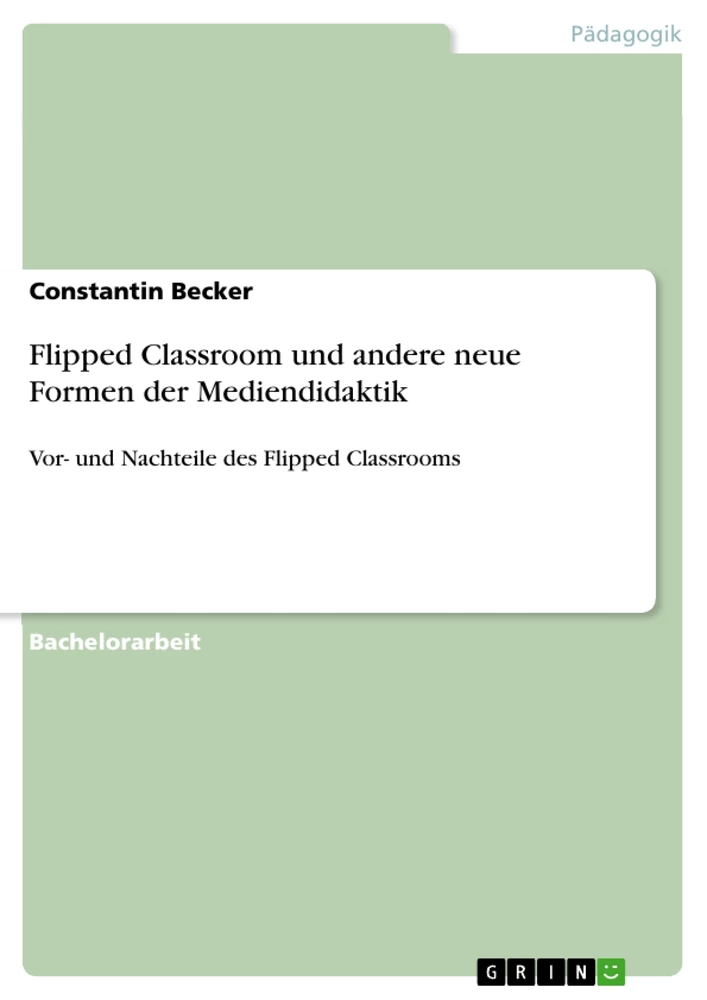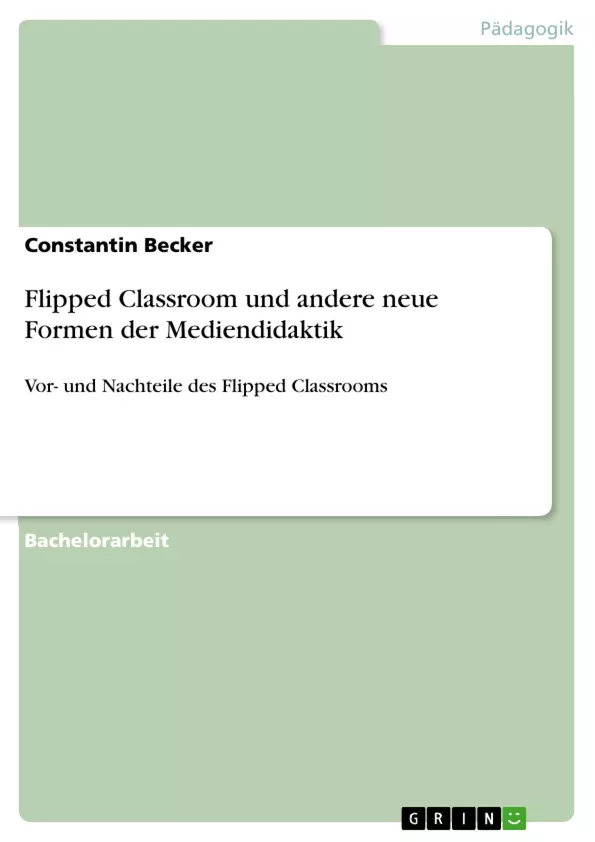Diese Arbeit möchte dem Leser und möglicherweise Lehrenden das von den amerikanischen Physik- und Chemielehrern Aaron Sams und Jonathan Bergmann im Jahre 2006 entwickelte Konzept des Flipped Classrooms näherbringen.
Flipped Classroom (oder Inverted Classroom sowie deutsch: umgedrehter Unterricht) beschreibt ein Unterrichtskonzept, nach welchem die Übungsphase in Form der Hausaufgaben einerseits und die Präsenzphase der Stoffvermittlung innerhalb des Schulunterrichts andererseits vertauscht sind.
Im konventionellen Unterricht folgen SuS bei der Erschließung neuen Lernstoffs gewöhnlich passiv dem Lehrvortrag der Lehrerin. Zu Hause sollen die SuS dann alleine anhand von Übungsaufgaben das Erlernte verinnerlichen. Im Flipped Classroom-Modell beginnt die Unterrichtseinheit zu Hause. Die SuS schauen sich aktiv von der Lehrerin erstellte Videos zum neuen Themengebiet an. Dabei können sie beliebig zurückspulen, pausieren und mitschreiben. So können sie beispielsweise einen Teil der Videos direkt nach der Schule schauen und einen anderen Teil bevor sie ins Bett gehen. Dabei legt jede Schülerin individuell ihr eigenes Lerntempo fest. Nach Möglichkeit nutzen die SuS dabei weitere digitale Angebote wie Lehrerblogs oder Lernspiele.
In der Schule wird das erlernte Wissen dann in Gruppenarbeitsphasen rekapituliert. Die SuS wenden das Erlernte anschließend in Übungs- oder Projektaufgaben an und erklären sich gegenseitig mögliche Verständnisschwierigkeiten. Die Lehrerin hilft individuell direkt bei Problemen weiter und bleibt stetiger Ansprechpartner. Ziel der Präsenzphase ist es die gemeinsame face-to-face Zeit möglichst effektiv zum gemeinsamen Arbeiten sowie Lernen zu nutzen und Unterrichtsteile in denen dies nicht so erforderlich erscheint, nach Hause auszulagern.
Der Flipped Classroom-Ansatz verheißt ein individualisiertes, verbessertes Lernen, um den heutigen heterogenen Klassen auch im Zuge der Inklusion gerecht zu werden. Die SuS würden sich die Lerninhalte asynchron, ortsunabhängig, individuell, selbstgesteuert und im eigenen Lerntempo anhand von digitalen Lernmaterialien aneignen können. Dabei würden Kompetenzen eigenverantwortlich und aus eigener Motivation heraus erlernt werden. Durch die direkte Anwendung der Lerninhalte sollen Zusammenhänge und Verknüpfungen langfristig im Kopf erschlossen werden können. Diese und weitere Hypothesen sollen innerhalb dieser Arbeit in der Praxis untersucht und durch Interviews evaluiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lerntheoretische Grundlagen
- Lernformen
- Montessori-Pädagogik
- Motivation
- Wie lernen Menschen besser mit digitalen Medien?
- Die Interviews und das Auswertungsverfahren
- Schriftliches qualitatives Interview
- Das Gruppeninterview
- Das Experteninterview
- Das Auswertungsverfahren
- Flipped Classroom
- Was ist Flipped Classroom?
- Theorie des Blended Learnings
- Geschichte des Flipped Classrooms
- Blooms Taxonomie
- Vier Fragen an den Lehrenden
- Neue Formen der Mediendidaktik
- Wichtige Komponenten des Flipped Classrooms
- Lehrvideos und Screencasts
- Skript (optional)
- Schülerportfolio (optional)
- Lehrerblog (optional)
- Lernspiele (optional)
- Unterrichtsmethode Flipped Classroom
- Szenario 1 mit Anwendung von Screencasts
- Szenario 2 mit Screencasts, Skript, Schülerportfolio und einer Projektaufgabe
- Wichtige Komponenten des Flipped Classrooms
- Vor- und Nachteile des Modells
- Aufbau des Flipped Classrooms Modells im Seminar Kosmochemie
- Ergebnisse der Interviews mit den Studierenden
- Flipped Classroom im Vergleich mit klassischen Unterrichtseinheiten
- Weitere digitale Medien (Quiz, Instant Reviews, Skripte)
- Langzeitgedächtnis
- Zeitaufwand
- Fehlender Stress bei Prüfungen
- Präsenzphase
- Schwierigkeiten als Lehrender
- Männliche / Weibliche Unterschiede
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Flipped Classroom-Konzept, einer innovativen Unterrichtsmethode, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen und die praktische Anwendung des Flipped Classrooms im Seminar Kosmochemie an der Universität zu Köln.
- Analyse der theoretischen Grundlagen des Flipped Classrooms
- Bewertung der Vorteile und Nachteile des Flipped Classroom-Modells
- Untersuchung der Auswirkungen des Flipped Classrooms auf das Lernen der Studierenden
- Beurteilung der Rolle digitaler Medien im Flipped Classroom
- Entwicklung von Empfehlungen zur Verbesserung des Flipped Classroom-Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Flipped Classroom-Konzept und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Anschließend werden die lerntheoretischen Grundlagen des Flipped Classrooms beleuchtet. Kapitel 3 beschreibt die Interviewmethoden, die für die Datenerhebung verwendet wurden.
Kapitel 4 stellt das Flipped Classroom-Modell im Detail vor, einschließlich seiner Geschichte, seiner Komponenten und seiner Anwendung in der Praxis. Kapitel 5 widmet sich den Vor- und Nachteilen des Modells, wobei die Ergebnisse der Interviews mit den Studierenden im Fokus stehen. Abschließend werden in Kapitel 6 die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten gegeben.
Schlüsselwörter
Flipped Classroom, Mediendidaktik, Blended Learning, digitale Medien, Lerntheorie, Motivation, Interviewforschung, qualitative Forschung, Hochschullehre, Geowissenschaften, Kosmochemie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Flipped Classroom"-Konzept?
Beim Flipped Classroom (umgedrehter Unterricht) werden die Wissensvermittlung nach Hause (z. B. per Video) und die Übungsphasen in die Schule verlegt.
Welche Vorteile bietet dieses Modell für Schüler?
Schüler können in ihrem eigenen Tempo lernen, Inhalte beliebig oft wiederholen und die Präsenzzeit im Unterricht effektiver für Fragen und Gruppenarbeit nutzen.
Welche Rolle spielen digitale Medien dabei?
Digitale Medien wie Lehrvideos, Screencasts, Blogs und Lernspiele sind zentral, um den Lernstoff asynchron und ortsunabhängig zur Verfügung zu stellen.
Wie sieht die Präsenzphase in der Schule aus?
Anstatt passiv zuzuhören, wenden die Lernenden ihr Wissen in Projekten oder Übungen an. Der Lehrende fungiert dabei als individueller Coach und Ansprechpartner.
Was ist "Blended Learning"?
Blended Learning ist die Kombination aus klassischen Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Modulen, zu denen auch der Flipped Classroom gehört.
- Arbeit zitieren
- Constantin Becker (Autor:in), 2016, Flipped Classroom und andere neue Formen der Mediendidaktik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354486