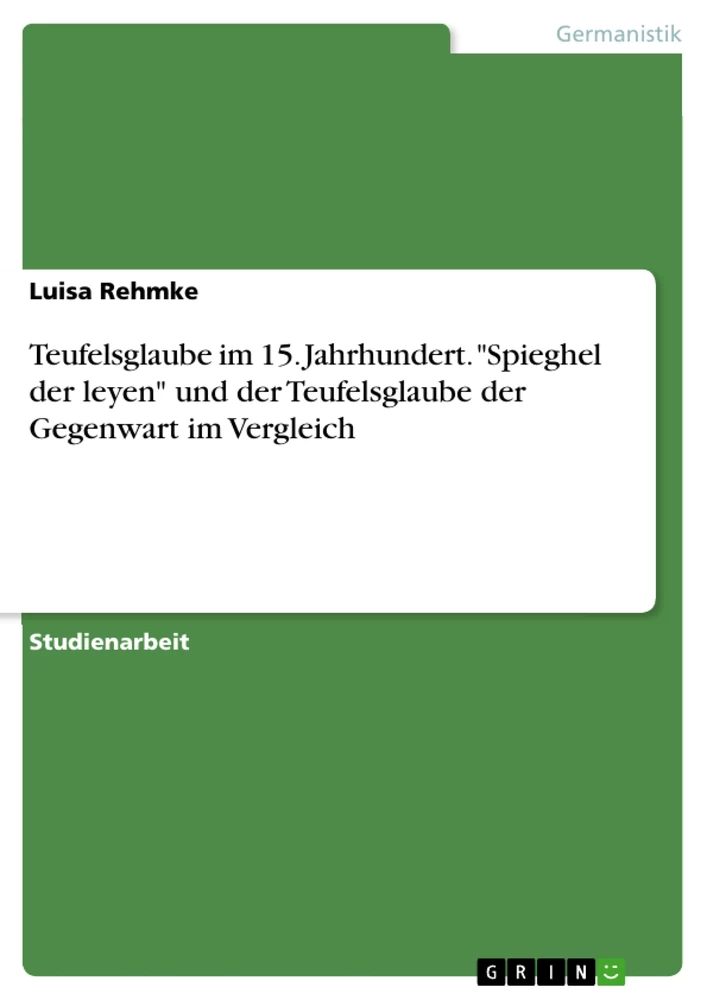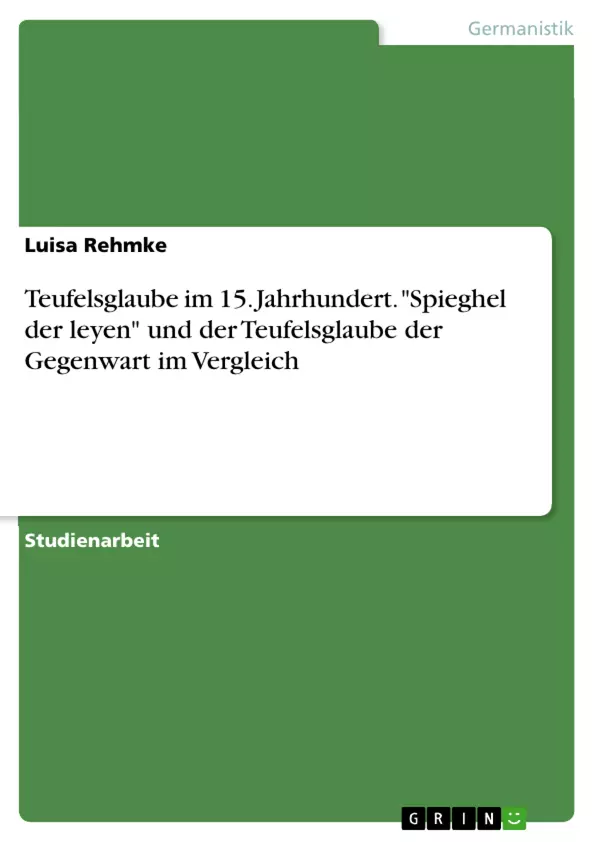„Die schönste List des Teufels ist es, uns zu überzeugen, daß es ihn nicht gibt.“ Hat der Teufel es tatsächlich geschafft, die Menschheit vom Glauben an ihn abzubringen, um uns so leichter zu verführen? Wer glaubt heute noch an den Teufel und wer glaubt überhaupt noch an Gott? Und wie hat es sich mit dem Teufelsglauben im Mittelalter verhalten?
Untersucht wird im Folgenden zum einen der Teufelsglaube und die damit einhergehende Darstellung des Teufels im Mittelalter anhand des 'Spieghel der leyen' von Gherard Buck van Buederick aus dem Jahre 1444, eine mittelniederdeutsche Handschrift, die als Leitfaden für die einfache Gesellschaft, ein gottgefälliges Leben zu führen, dient. Zum anderen wird ebenfalls der Teufelsglaube untersucht, wie er heutzutage in den zwei vorherrschenden Konfessionen, dem Katholizismus und dem Evangelismus, Deutschlands vorliegt. Beide Untersuchungen sollen schließlich unter der Fragestellung, inwiefern das Teufelsbild von vor 500 Jahren dem von heute ähnelt bzw. sich unterscheidet, miteinander verglichen werden. Hierbei stelle ich die These auf, dass der Glaube an den Teufel mit der abnehmenden Bedeutung von Religion in unserer Gesellschaft allmählich verschwand. Es gilt herauszufinden, inwiefern das Leben im 15. Jahrhundert durch den Glauben an den Teufel beeinflusst worden ist und inwiefern es heute noch so ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchung
- Der Teufelsglaube im Mittelalter anhand des 'Spieghel der leyen'
- Der Teufelsglaube in der Gegenwart
- Gegenüberstellung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Teufelsglauben im 15. Jahrhundert anhand des "Spieghel der leyen" und vergleicht ihn mit dem heutigen Teufelsglauben. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung und Wahrnehmung des Teufels über die Jahrhunderte aufzuzeigen und die These zu überprüfen, dass der Glaube an den Teufel mit abnehmender religiöser Bedeutung in der Gesellschaft schwächer geworden ist.
- Darstellung des Teufels im "Spieghel der leyen" und im mittelalterlichen Weltbild
- Der Teufelsglaube in der heutigen katholischen und evangelischen Kirche
- Vergleich der Teufelsbilder aus Mittelalter und Gegenwart
- Einfluss des Teufelsglaubens auf das Leben im 15. Jahrhundert und heute
- Entwicklung des Teufelsbildes von der Bibel bis zur Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Wandel des Teufelsglaubens von Mittelalter bis Gegenwart vor und formuliert die These, dass der Glaube an den Teufel mit der abnehmenden Bedeutung von Religion in unserer Gesellschaft zurückging. Die Arbeit nutzt den "Spieghel der leyen" als repräsentative Quelle für den mittelalterlichen Teufelsglauben und bezieht aktuelle Forschungsergebnisse ein. Die methodische Vorgehensweise – Analyse des "Spieghel der leyen", Untersuchung des heutigen Teufelsglaubens in Katholizismus und Evangelismus, Vergleich beider und abschließende Schlussfolgerung – wird skizziert.
2. Untersuchung - 2.1. Der Teufelsglaube im Mittelalter anhand des 'Spieghel der leyen': Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Teufels im "Spieghel der leyen", einer mittelniederdeutschen Handschrift aus dem Jahr 1444. Es wird der Engelsturz Luzifers als Beispiel für die Sünde des bloßen Gedankens erläutert. Der "Feind" (viant) im Text wird als Quelle menschlichen Leids beschrieben, der durch Täuschung und Blendung, wie im Fall Eva, in die Sünde führt. Der Text verweist auf biblische Stellen, die die Ambivalenz des Teufels verdeutlichen – ursprünglich sowohl für das Gute als auch Böse verantwortlich, entwickelt sich im Laufe der Zeit die Vorstellung eines Gottesgegners, der im Neuen Testament seine volle Rolle erhält.
Schlüsselwörter
Teufelsglaube, Mittelalter, Gegenwart, "Spieghel der leyen", Gherard Buck van Buederick, Luzifer, Satan, Engelsturz, Sünde, Religion, Katholizismus, Evangelismus, Vergleich, Wandel, Bibel, Gottesgegner.
Häufig gestellte Fragen zum "Spieghel der leyen" und dem Wandel des Teufelsglaubens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Wandel des Teufelsglaubens vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Sie analysiert die Darstellung des Teufels im "Spieghel der leyen" (einer mittelniederdeutschen Handschrift aus dem Jahr 1444) und vergleicht sie mit dem heutigen Verständnis des Teufels im Katholizismus und Evangelismus. Das Hauptziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis des Teufels über die Jahrhunderte aufzuzeigen und den Einfluss abnehmender religiöser Bedeutung auf den Teufelsglauben zu untersuchen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die zentrale Quelle ist der "Spieghel der leyen". Zusätzlich werden aktuelle Forschungsergebnisse und die Lehren der katholischen und evangelischen Kirchen zum Thema Teufel herangezogen. Die Arbeit stützt sich auf eine Analyse des Textes, um die mittelalterliche Vorstellung vom Teufel zu rekonstruieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Teufels im "Spieghel der leyen" und im mittelalterlichen Weltbild allgemein. Sie untersucht den heutigen Teufelsglaube in der katholischen und evangelischen Kirche und vergleicht die jeweiligen Teufelsbilder. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss des Teufelsglaubens auf das Leben im 15. Jahrhundert und heute sowie auf der Entwicklung des Teufelsbildes von der Bibel bis in die Gegenwart.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Untersuchungs- und einen Vergleichsteil sowie eine Schlussbetrachtung. Der Untersuchungsteil analysiert den Teufelsglauben im Mittelalter anhand des "Spieghel der leyen" und in der Gegenwart. Der Vergleichsteil setzt die beiden Perspektiven zueinander in Beziehung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor, während die Schlussbetrachtung die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche These wird aufgestellt und überprüft?
Die zentrale These lautet, dass der Glaube an den Teufel mit der abnehmenden Bedeutung von Religion in der Gesellschaft schwächer geworden ist. Diese These wird durch den Vergleich des mittelalterlichen Teufelsglaubens (dargestellt im "Spieghel der leyen") mit dem heutigen Glauben im Katholizismus und Evangelismus überprüft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Teufelsglaube, Mittelalter, Gegenwart, "Spieghel der leyen", Gherard Buck van Buederick, Luzifer, Satan, Engelsturz, Sünde, Religion, Katholizismus, Evangelismus, Vergleich, Wandel, Bibel, Gottesgegner.
Wie wird der Teufel im "Spieghel der leyen" dargestellt?
Der "Spieghel der leyen" beschreibt den Teufel als "Feind" (viant), der durch Täuschung und Blendung, ähnlich wie im Fall Eva, zum menschlichen Leid beiträgt. Der Text erläutert den Engelsturz Luzifers als Beispiel für die Sünde des bloßen Gedankens und verweist auf die biblische Ambivalenz des Teufels, der ursprünglich sowohl für Gut als auch Böse verantwortlich war, bevor er sich im Neuen Testament zum Gottesgegner entwickelt.
- Citar trabajo
- Luisa Rehmke (Autor), 2016, Teufelsglaube im 15. Jahrhundert. "Spieghel der leyen" und der Teufelsglaube der Gegenwart im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354802