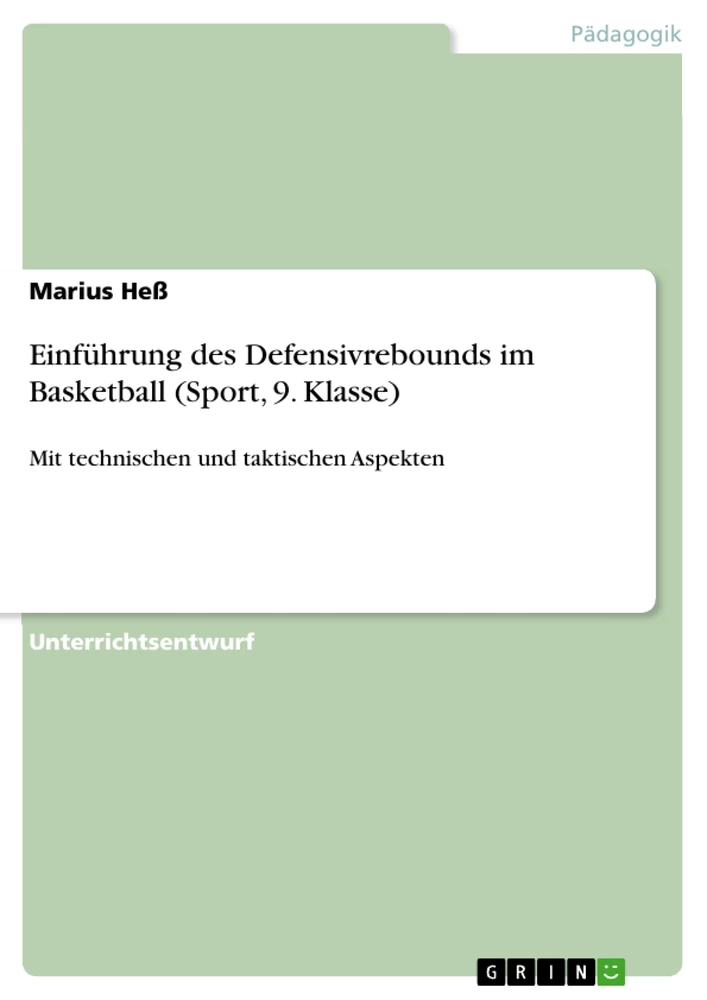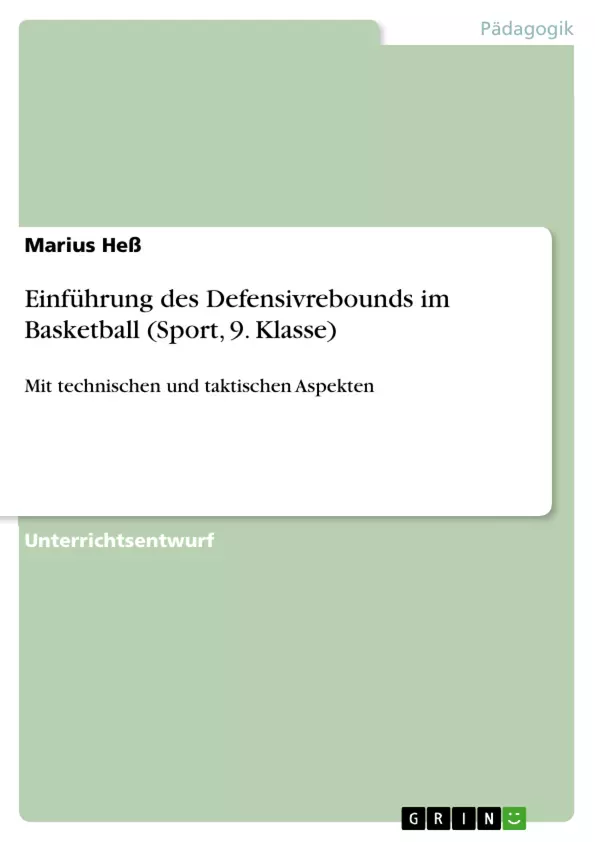Die hier erarbeitete Sportstunde richtet sich an eine neunte Klasse am bayerischen Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe sind meist zwischen 14 und 16 Jahren alt und befinden sich im Übergang von der Entwicklungsphase der Pubeszenz in die der Adoleszenz, richtet man sich nach der Entwicklungspsychologie von Berk (2011) oder auch (Meinel & Schnabel, 2007). Zu Beginn der Adoleszenz sind vor Allem die männlichen Schüler mitten in der Phase der Pubertät, in der „eine Vielzahl biologischer Entwicklungen, die zu einem ausgewachsenen Körper und zur Geschlechtsreife führen“, stattfinden (Berk, 2011). Anders als bei den weiblichen Mitschülerinnen, bei welchen die Pubertät in der Regel ein bis zwei Jahre früher eintritt und damit auch schon früher endet. Diese biologischen Entwicklungen werden im Folgenden in körperliche, kognitive und soziale Aspekte unterteilt, die bei der Konzeption der Stunde berücksichtig werden müssen. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Sachanalyse
- Das Basketballspiel
- Der Rebound
- Technikmerkmale und Bewegungsbeschreibung
- Besonderheit Defensivrebound
- Defensivrebound bei einem Freiwurf
- Bedingungsanalyse
- Entwicklungsstand der Adressaten
- Legitimation des Themas und Lehrplanbezug
- Rahmenbedingungen
- Didaktische Reduktion
- Pädagogische Perspektiven
- Begründung der Auswahl der Perspektiven
- Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern
- Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen
- Verknüpfung der Perspektiven mit dem sportlichen Handlungsfeld
- Disziplinspezifisches Vermittlungskonzept
- Einführung in das Stundenthema
- Aufwärmspiel Freiwurfkönig
- Stationsbetrieb
- Die Spiele „Act fast“ und das Abschlussspiel
- Fazit
- Pädagogische Perspektiven
- Konkretisierung der Ziele und Sequenzplanung
- Begründung der Wahl der Ziele
- Darstellung der Sequenzplanung
- Tabellarischer Stundenentwurf
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Aufbau Stationsbetrieb
- Stationskärtchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit analysiert den Defensivrebound im Basketball, speziell seine technischen und taktischen Aspekte. Dabei werden die relevanten Bewegungsabläufe und die Bedeutung der Spielerpositionierung im Spielkontext erläutert.
- Technikmerkmale und Bewegungsbeschreibung des Rebounds
- Besonderheiten des Defensivrebounds im Vergleich zum offensiven Rebound
- Die Rolle des Ausboxens und der Spielerpositionierung im Defensivrebound
- Didaktische Aspekte der Vermittlung des Defensivrebounds im Schulsport
- Entwicklung einer Unterrichtseinheit zum Defensivrebound für eine neunte Klasse am Gymnasium
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Sachanalyse beginnt mit einer kurzen Beschreibung der Geschichte des Basketballs und der Grundregeln. Anschließend werden die technischen Aspekte des Rebounds, inklusive der Phasen der Vorbereitung, Flugphase und Endphase, detailliert erklärt. Im Fokus des Kapitels stehen die Besonderheiten des Defensivrebounds, insbesondere die Bedeutung des Ausboxens, der Spielerpositionierung und der taktischen Aspekte.
Die Bedingungsanalyse befasst sich mit dem Entwicklungsstand der Adressaten (Schüler der neunten Klasse), der Legitimation des Themas im Lehrplan und den Rahmenbedingungen für die Durchführung der Unterrichtseinheit.
Die didaktische Reduktion erläutert die pädagogischen Perspektiven, die bei der Vermittlung des Defensivrebounds im Schulsport berücksichtigt werden sollten. Diese beinhalten die Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit, die Erweiterung der Bewegungserfahrungen und das Verstehen des Leistens. Der Abschnitt beinhaltet außerdem die Entwicklung eines disziplinspezifischen Vermittlungskonzepts, das eine Einführung in das Stundenthema, verschiedene Übungsformen und ein Abschlussspiel beinhaltet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen des Basketballs, insbesondere den technischen und taktischen Aspekten des Defensivrebounds. Schwerpunkte bilden dabei die Bewegungsbeschreibung, die Positionierung des Spielers im Raum, das Ausboxen und die didaktische Reduktion für die Vermittlung im Schulsport. Des Weiteren spielen die Spielphasen des Basketballspiels und die Entwicklungspsychologie der Zielgruppe eine wichtige Rolle.
- Quote paper
- Marius Heß (Author), 2016, Einführung des Defensivrebounds im Basketball (Sport, 9. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354902