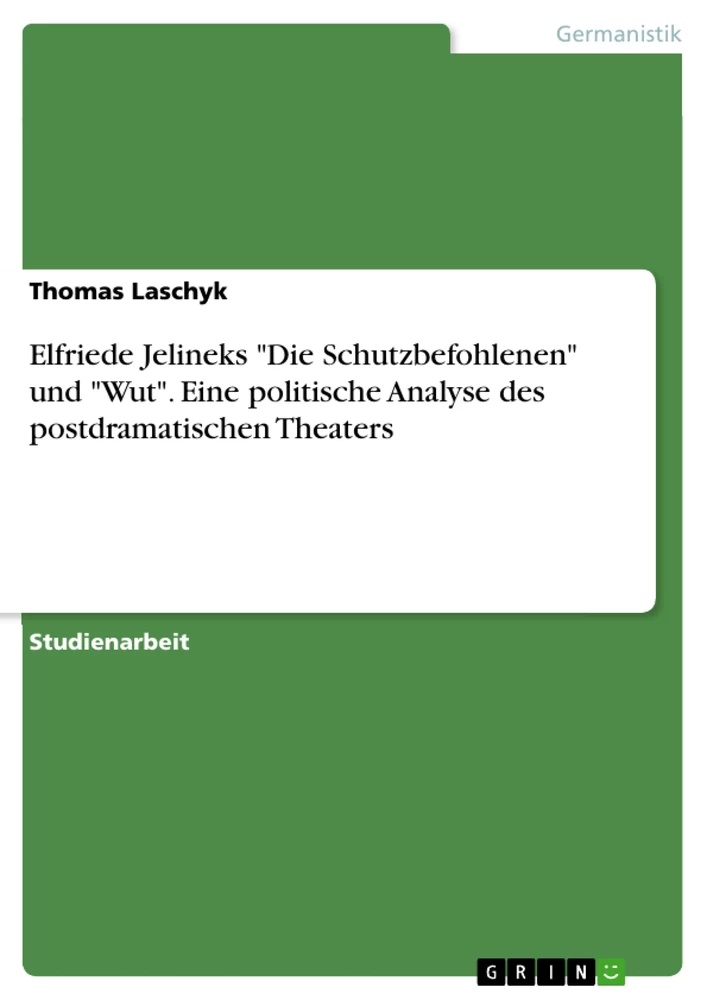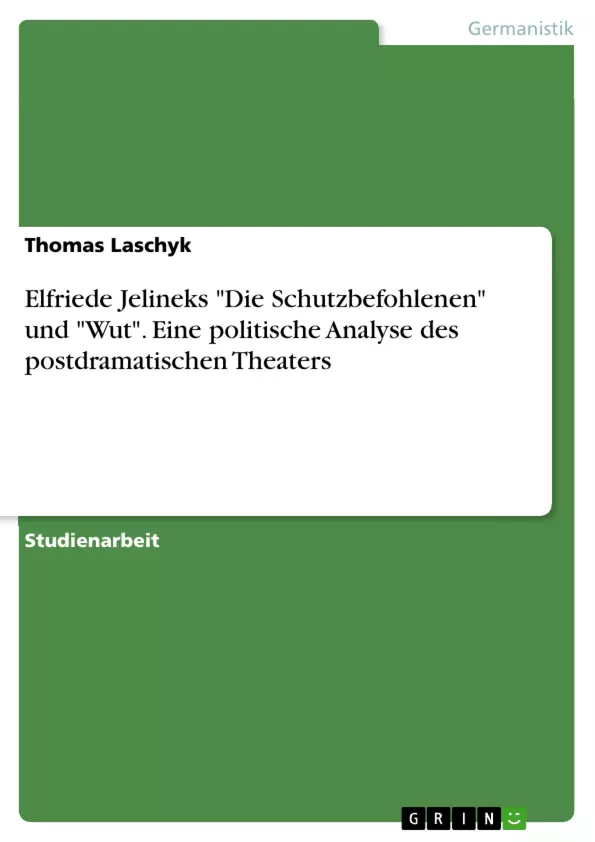Diese Arbeit wird sich der Fragestellung widmen, ob sich das Postdramatische Theater dazu eignet, das Politische zu thematisieren und ob es sich als links-liberaler, politischer Gegendiskurs betrachten lässt. Dazu wird zunächst das Postdramatische Theater definiert und vom Dramatischen abgegrenzt und anschließend analysiert, inwieweit sein Selbstverständnis bereits politisch sein kann. In einem nächsten Schritt werden die Werke „Wut“ und „Die Schutzbefohlenenen“ von der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek zur Untersuchung herangezogen, um zu zeigen, in welchem Maße ein politischer Diskurs existiert und was dies bedeutet.
Politik und politische Meinungsbildungsprozesse befinden sich stets im Wandel und sind immer beeinflusst von den technologischen Möglichkeiten ihrer Zeit. War zunächst die Tageszeitung und das Pamphlet das einflussreichste Medium der Informationsbeschaffung, Meinungsbildung und politischen Auseinandersetzung, so gewannen mit ihrem Auftauchen und ihrer wachsenden (und später wieder sinkenden) Popularität andere Medien wie das Radio, das Fernsehen und jüngst das Internet an Bedeutung. Neben Unterhaltung, Vernetzung und als Arbeitsplatz bietet das World Wide Web auch als unendlich große Datenbank und Informationsquelle den idealen Nährboden für politische Meinungsbildung.
Was bisher auf Stammtische beschränkt geblieben war, wird nun zu „Zirkel(n) der Öffentlichkeitsverweigerung im Netz“ und damit zu einem neuen Raum des Politischen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er Informationen, auch falsche, inzestuös einen abgeschotteten Nährboden liefert, in der sich seine Mitglieder „wechselseitig vertrauenswürdig informieren“ und in ihren Weltbilder lediglich bestätigen, anstatt sie herauszufordern.
Doch gibt es einen Gegenraum zu diesem Populismus? Wie kann der links-liberale politische Gegenentwurf aussehen? Historisch betrachtet diente das Theater bereits als Plattform demokratischer Meinungsäußerung, allen voran muss man hierbei an Brechts episches Theater denken. Ist das Theater ist ein Ort, an welchem ein andersartiger politischer Diskurs stattfinden kann? Kann das kontemporäre Theater dem affirmativen und unkritischen politischem Raum des Internets eine herausfordernde, differenzierende Alternative bieten?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Die neue Rechte und ihr Entfaltungsraum Internet.
- 2. Was ist postdramatisches Theater?...
- 3. Inwieweit ist das postdramatische Theater politisch?...
- 4. Die politische Dimension von Jelineks Werke...
- 4.1. Wut.
- 4.2. Die Schutzbefohlenenen
- 5. Die Grenzen der Postdramatik.
- 6. Der Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob sich das Postdramatische Theater dazu eignet, das Politische zu thematisieren und ob es sich als links-liberaler, politischer Gegendiskurs betrachten lässt. Sie untersucht die Entwicklungen der neuen Rechten im Internet und die Rolle des Theaters im öffentlichen Diskurs.
- Die neue Rechte und ihre Präsenz im Internet
- Das Postdramatische Theater als Form des Gegen-Diskurses
- Die politische Dimension von Elfriede Jelineks Werken
- Performativität und Sprachgebrauch im Postdramatischen Theater
- Die Grenzen des Postdramatischen Theaters im Kontext der politischen Debatte
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss des Internets auf die politische Meinungsbildung und die Entstehung der "neuen Rechten" im digitalen Raum. Es analysiert, wie das Internet als Plattform für politische Gegenöffentlichkeit fungiert und zu einer Verfestigung von Verschwörungstheorien beitragen kann.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird der Begriff des "Postdramatischen Theaters" definiert und von den traditionellen Formen des dramatischen Theaters abgegrenzt. Es werden die charakteristischen Merkmale des Postdramatischen Theaters beschrieben, wie z.B. die Betonung der Performativität, die Dekonstruktion des Textes und die Reflexion auf die eigenen ästhetischen Mittel.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht die politische Dimension des Postdramatischen Theaters. Es wird diskutiert, ob und inwiefern sich diese Theaterform als Instrument des politischen Diskurses nutzen lässt und welche Rolle es im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Populismus spielen kann.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die Werke "Wut" und "Die Schutzbefohlenen" von Elfriede Jelinek, um aufzuzeigen, wie die Autorin politische Themen in ihren Werken verarbeitet und welche Rolle das Postdramatische Theater dabei spielt.
- Kapitel 5: In diesem Kapitel werden die Grenzen des Postdramatischen Theaters im Kontext der politischen Debatte diskutiert. Es wird hinterfragt, ob und inwiefern die Theaterform in der Lage ist, dem digitalen Raum und seinen Herausforderungen gerecht zu werden und eine wirkungsvolle Form des politischen Gegendiskurses zu bieten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Postdramatisches Theater, Politische Meinungsbildung, Neue Rechte, Internet, Gegenöffentlichkeit, Performativität, Elfriede Jelinek, "Wut", "Die Schutzbefohlenen", Fremdenfeindlichkeit, Populismus, Öffentlicher Diskurs, Politischer Gegendiskurs.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet postdramatisches Theater?
Es löst sich von der Vorherrschaft des dramatischen Textes und betont stattdessen Performativität, die Dekonstruktion von Inhalten und die Reflexion über ästhetische Mittel.
Warum ist Elfriede Jelineks Werk für diese Analyse relevant?
Jelinek nutzt postdramatische Techniken, um tagespolitische Themen wie Fremdenfeindlichkeit und Populismus radikal zu hinterfragen und sprachlich zu dekonstruieren.
Wie thematisiert das Stück „Wut“ die Neue Rechte?
Die Arbeit analysiert, wie Jelinek die Wut-Diskurse im Internet und die Radikalisierung in digitalen Echo-Kammern auf die Bühne bringt.
Worum geht es in „Die Schutzbefohlenen“?
Das Werk setzt sich mit der europäischen Flüchtlingspolitik und dem Schicksal von Asylsuchenden auseinander, wobei es klassische Texte (wie Aischylos) mit moderner Realität verknüpft.
Kann Theater ein wirksamer Gegendiskurs zum Internet-Populismus sein?
Die Arbeit diskutiert, ob das Theater als physischer Raum der Differenzierung eine Alternative zur unkritischen Bestätigung von Weltbildern im Netz bieten kann.
- Arbeit zitieren
- Thomas Laschyk (Autor:in), 2016, Elfriede Jelineks "Die Schutzbefohlenen" und "Wut". Eine politische Analyse des postdramatischen Theaters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355020