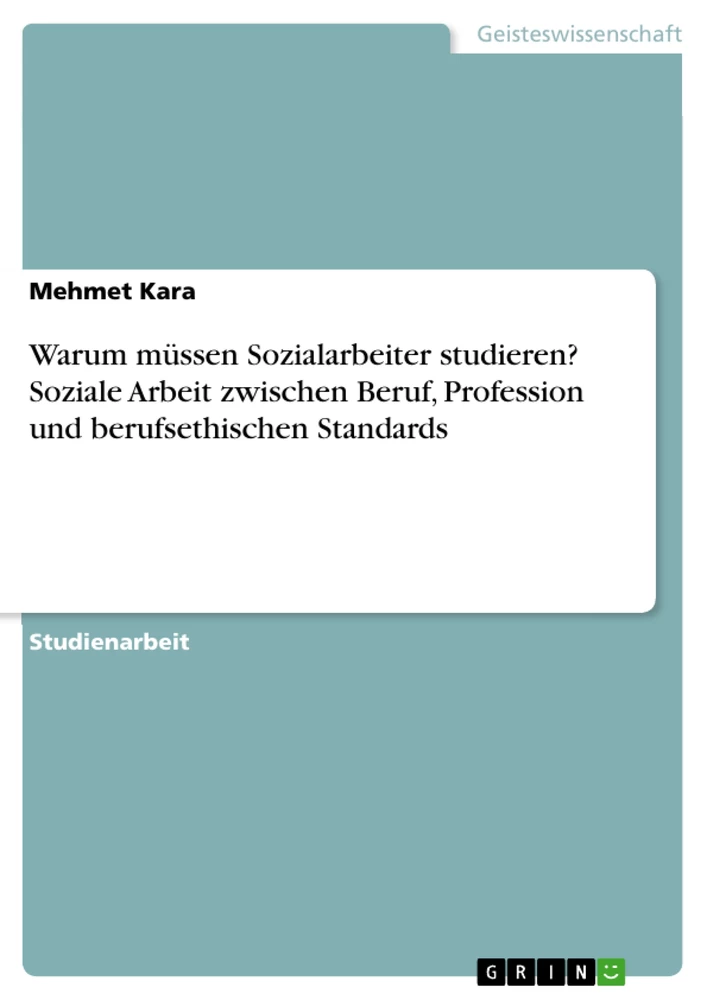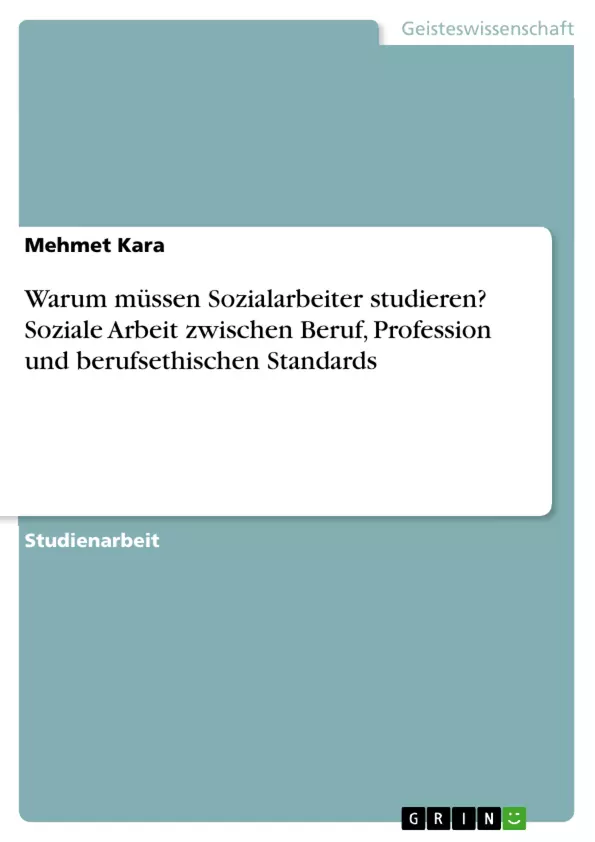In dieser Seminararbeit wird zunächst auf das Verständnis Sozialer Arbeit als Beruf einerseits und Profession andererseits eingegangen. Sodann erfolgen eine Verortung und eine Einschätzung, welche Rolle die Ethik für die Soziale Arbeit einnimmt. Mittels einer Skizzierung berufsethischer Prinzipien des DBSH erfolgt zum Schluss eine Abwägung, inwiefern gesetzte ethische Standards dem sozialarbeiterischen Berufsalltag und den Akteuren als Orientierung dienen können.
Angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bekommen vermutlich häufig zu hören, weshalb sie überhaupt Soziale Arbeit studierten, da diese Tätigkeiten von jedem ausgeübt werden könnte und keines Studiums bedürfe. Es ist eine weit verbreitete Perspektive von Menschen auf die Soziale Arbeit, für die es geradezu überflüssig erscheint, das Fach an einer Hochschule auf akademischer Ebene zu studieren. Dabei ist gerade dieser Aspekt – worauf während der Arbeit noch eingegangen wird – sowohl in der historischen Verberuflichung der Sozialen Arbeit wesentlich als auch für die andauernde Professionsdebatte Sozialer Arbeit elementar. Ebenso von großer Bedeutung ist seither der ethische Charakter der Sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Begriffsanalytische Betrachtung von Sozialer Arbeit und Profession
- 1.1 Soziale Arbeit
- 1.2 Profession
- 2. Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Beruf und Profession
- 2.1 Soziale Arbeit als Beruf
- 2.2 Soziale Arbeit als Profession
- 3. Soziale Arbeit und Ethik
- 3.1 Ethisches Wissen und Ethik in der Sozialen Arbeit
- 3.2 Berufsethik in der Sozialen Arbeit
- 3.2.1 Menschenrechte
- 3.2.2 Soziale Gerechtigkeit
- 3.3 Berufsethische Prinzipien des DBSH
- 4. Ethische Leitbilder – Eine Orientierung für die Fachkräfte Sozialer Arbeit?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Verständnis von Sozialer Arbeit als Beruf und Profession. Ziel ist es, die Rolle der Ethik in der Sozialen Arbeit zu beleuchten und zu analysieren, inwiefern ethische Standards im Berufsalltag der Fachkräfte als Orientierung dienen können.
- Die Unterscheidung zwischen Sozialer Arbeit als Beruf und Profession
- Die Bedeutung ethischen Wissens und ethischer Prinzipien in der Sozialen Arbeit
- Die berufsethischen Prinzipien des DBSH als Orientierung für Fachkräfte
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit von ihren Anfängen bis zur heutigen Professionalisierung
- Der säkulare Charakter der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer begriffsanalytischen Betrachtung von Sozialer Arbeit und Profession. Es werden die unterschiedlichen Bedeutungen und Dimensionen der beiden Begriffe erläutert. Kapitel 2 untersucht die Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Beruf und Profession. Dabei werden die historischen Entwicklungen und die zentralen Merkmale der Sozialen Arbeit als Beruf hervorgehoben. Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Ethik in der Sozialen Arbeit diskutiert. Es werden ethische Prinzipien und ihre Relevanz für die Praxis der Sozialen Arbeit vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich ethischen Leitbildern und deren Funktion als Orientierung für Fachkräfte.
Schlüsselwörter (Keywords)
Soziale Arbeit, Profession, Beruf, Ethik, Berufsethik, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, DBSH, Leitbilder, Orientierung, Fachkräfte, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Studium für die Soziale Arbeit notwendig?
Das Studium ist elementar für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Es vermittelt das notwendige theoretische Wissen und ethische Standards, die über eine rein handwerkliche Tätigkeit hinausgehen.
Was ist der Unterschied zwischen Beruf und Profession in der Sozialen Arbeit?
Während "Beruf" die allgemeine Erwerbstätigkeit beschreibt, bezieht sich "Profession" auf einen akademisierten Status mit spezifischen Fachstandards, Autonomie und einer fundierten Berufsethik.
Welche Rolle spielt die Ethik in der Sozialen Arbeit?
Ethik dient als zentraler Orientierungsrahmen. Sie hilft Fachkräften, in komplexen Situationen zwischen Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit abzuwägen.
Was sind die berufsethischen Prinzipien des DBSH?
Der DBSH (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit) definiert Prinzipien, die auf Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit basieren und den Fachkräften als Leitfaden für ihr tägliches Handeln dienen.
Was bedeutet der säkulare Charakter der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt die Entwicklung der Sozialen Arbeit weg von rein religiös motivierter Wohltätigkeit hin zu einer staatlich und wissenschaftlich fundierten gesellschaftlichen Aufgabe.
- Quote paper
- Mehmet Kara (Author), 2016, Warum müssen Sozialarbeiter studieren? Soziale Arbeit zwischen Beruf, Profession und berufsethischen Standards, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355494