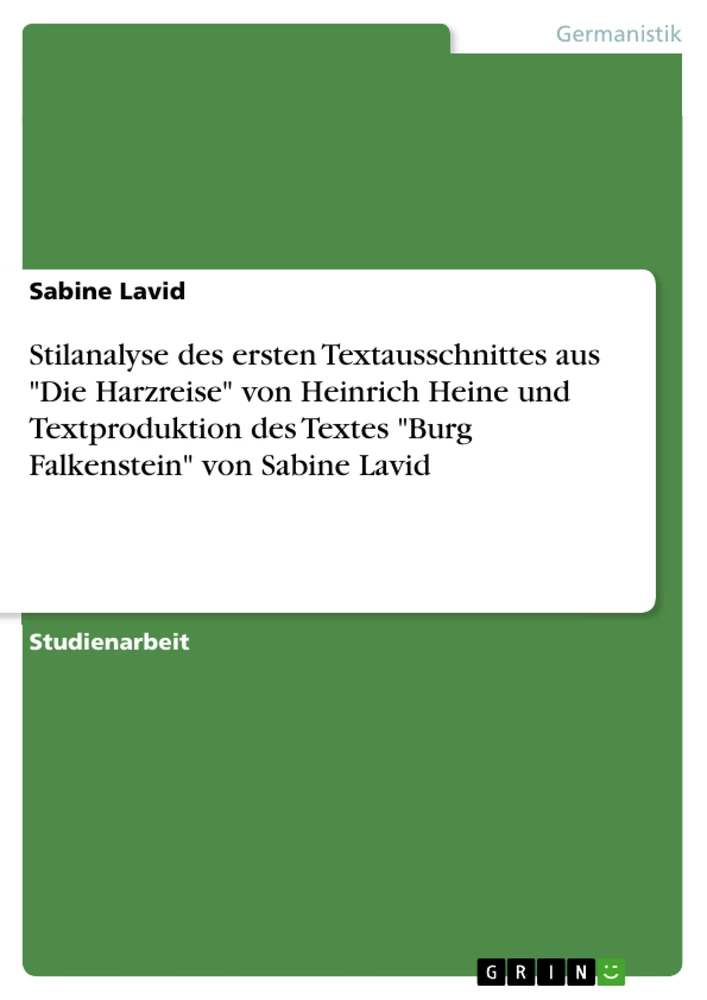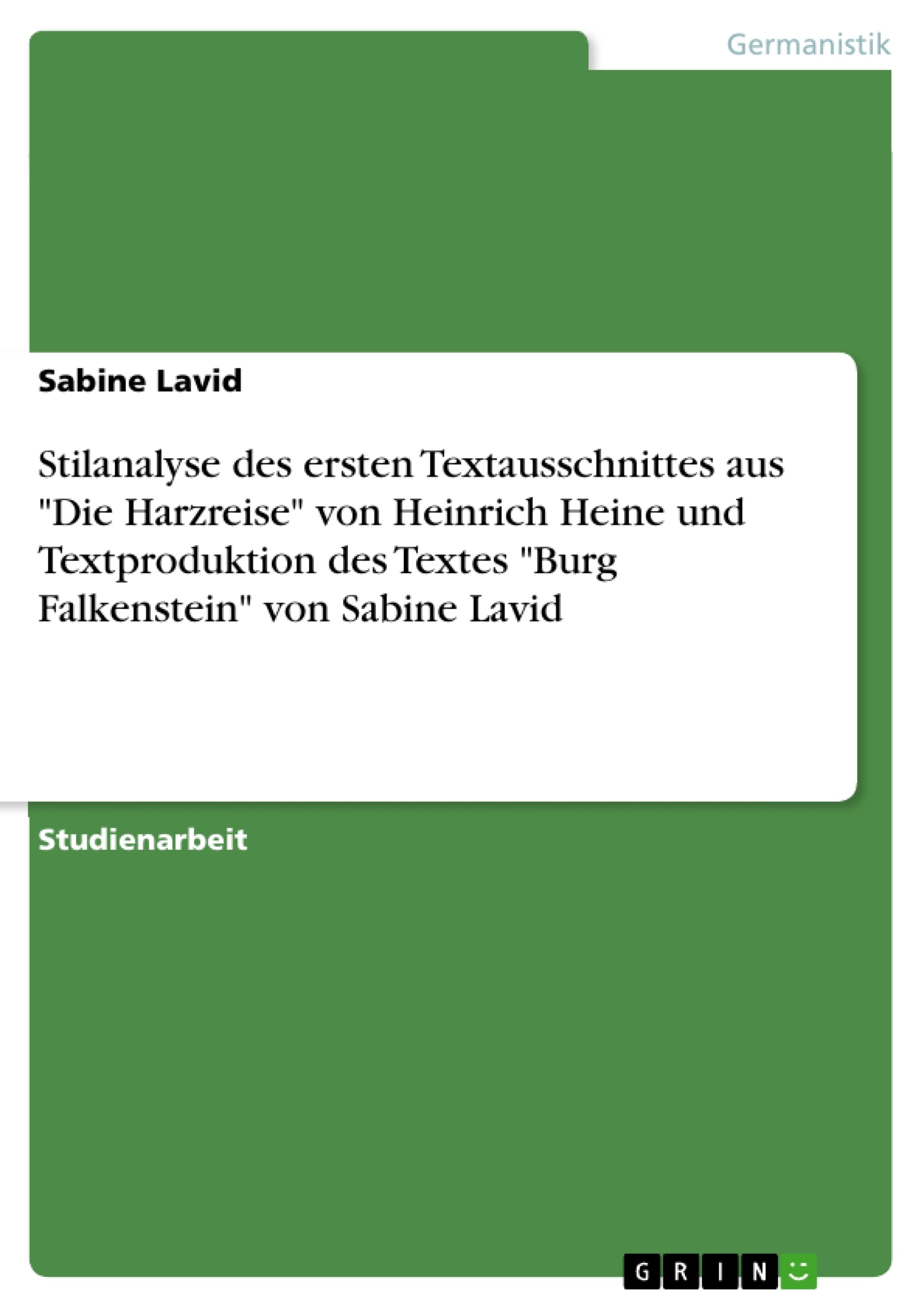Der zu analysierende Textausschnitt Nr. 2 wurde von Heinrich Heine verfasst und, laut Textunterschrift, im 3. Band ab der Seite 22 der Textsammlung "Werke und Briefe in zehn Bänden" im Jahre 1972 veröffentlicht.
Bei dem zu analysierenden Basistext handelt es sich um den Anfang von Heines Reisebericht "Die Harzreise" aus dem Jahre 1824. Der Text wurde in der Epoche der Spätromantik geschrieben, die etwa den Zeitraum von 1816 bis 1848 umfasst. Historisch belegt ist, dass Heines Wanderung von Göttingen über den Harz nach Ilseburg in die Zeit fällt, in der Heine von der Georg-August Universität konsiliiert war. Somit ist es wahrscheinlich, dass die Erfahrungen, die Heine in Göttingen machte, in den Text eingeflossen sind.
In meinem Assignment werde ich jedoch weder auf die persönlichen Hintergründe des Text-Urhebers noch auf die zeitpolitischen Gegebenheiten weiter eingehen können, sondern eine textimmanente Stilanalyse durchführen. Zunächst werde ich eine Strukturanalyse des Textes durchführen, um im Hauptteil die verwendeten rhetorischen Mittel aufzudecken. Bei besonders auffälligen oder häufig verwendeten Elementen werde ich diese auf ihre Unterstützung des Textinhaltes überprüfen.
Im Anschluss erfolgt die Übertragung der von Heine verwendeten Stilmerkmale auf den von mir verfassten Text, „Burg Falkenstein“. Im Fazit fasse ich meine Ergebnisse kurz zusammen und setze mich kritisch mit meiner Analysemethode auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Strukturanalyse
- Texteinordnung, Textsorte, Haupt- und Unterthemen, Entfaltung und Perspektive
- Kohäsion und Kohärenz
- Stilanalyse
- Stilzug, Sprachebene und Sprachauffälligkeiten
- Satzgliedstellung; Hypotaxen, Parataxen, Inversion, Parallelismus, Anapher und Epipher
- Satz- und Wortfiguren; Akkumulation, Hyperbel, Litotes, Anaklouth und Antithese
- Bilder; Personifikation und Symbol
- Rhetorische Strategien; Ironie, Spott und Sarkasmus
- Textproduktion "Burg Falkenstein"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Assignment befasst sich mit der Stilanalyse eines Textauszugs aus Heinrich Heines "Die Harzreise". Ziel ist es, die stilistischen Mittel des Autors zu identifizieren und zu analysieren, um anschließend diese Erkenntnisse auf die eigene Textproduktion "Burg Falkenstein" zu übertragen.
- Analyse von Heines Stilmerkmalen im Textausschnitt
- Identifizierung rhetorischer Mittel und deren Funktion im Text
- Übertragung der stilistischen Elemente auf die eigene Textproduktion
- Kritische Auseinandersetzung mit der Analysemethode
Zusammenfassung der Kapitel
Der Textausschnitt aus "Die Harzreise" schildert den Abschied des Protagonisten von der Stadt Göttingen. Dabei werden die Stadt selbst, ihre Bewohner und die sozialen Verhältnisse beschrieben. Der Text ist in fünf Abschnitte gegliedert, die jeweils eigene Unterthemen behandeln.
Der erste Abschnitt beschreibt Göttingen als Ausgangspunkt der Reise. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Herkunft der Göttinger Bewohner. Der dritte Abschnitt stellt die vier Stände Göttingens vor. Der vierte Abschnitt befasst sich mit dem Widerlegungsversuch eines lokalen Vorurteils. Der fünfte Abschnitt beginnt mit dem Aufbruch aus Göttingen.
Schlüsselwörter
Stilanalyse, Textproduktion, Heinrich Heine, "Die Harzreise", Rhetorische Mittel, Stilmerkmale, "Burg Falkenstein", Kohäsion, Kohärenz, Sprachebene, Satzfiguren, Bilder, Ironie, Spott, Sarkasmus.
- Citar trabajo
- Sabine Lavid (Autor), 2014, Stilanalyse des ersten Textausschnittes aus "Die Harzreise" von Heinrich Heine und Textproduktion des Textes "Burg Falkenstein" von Sabine Lavid, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355808