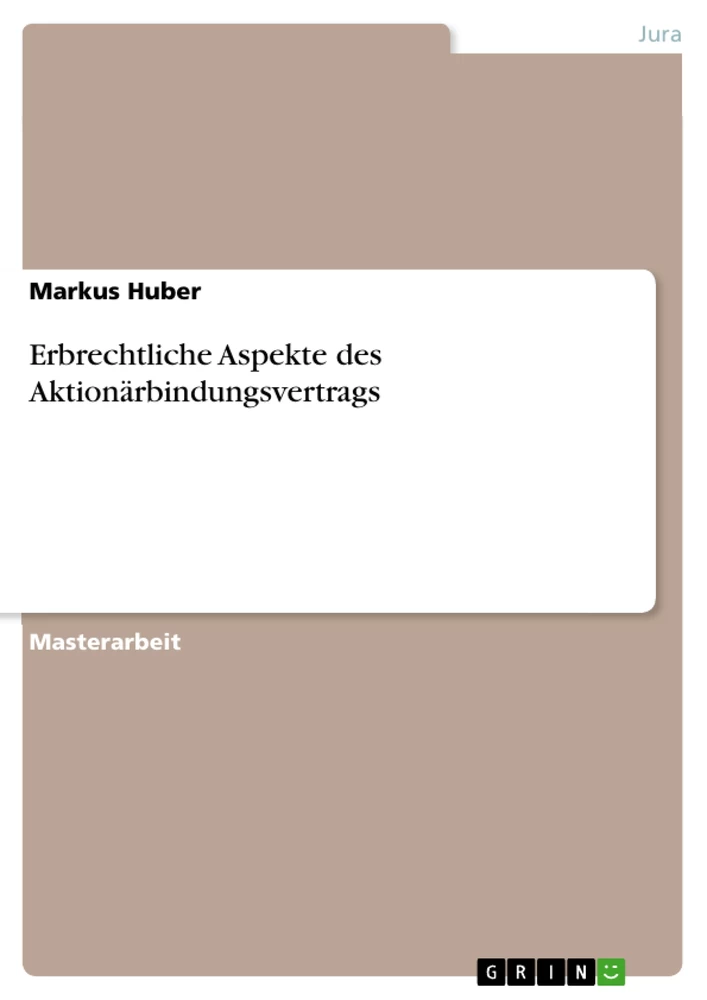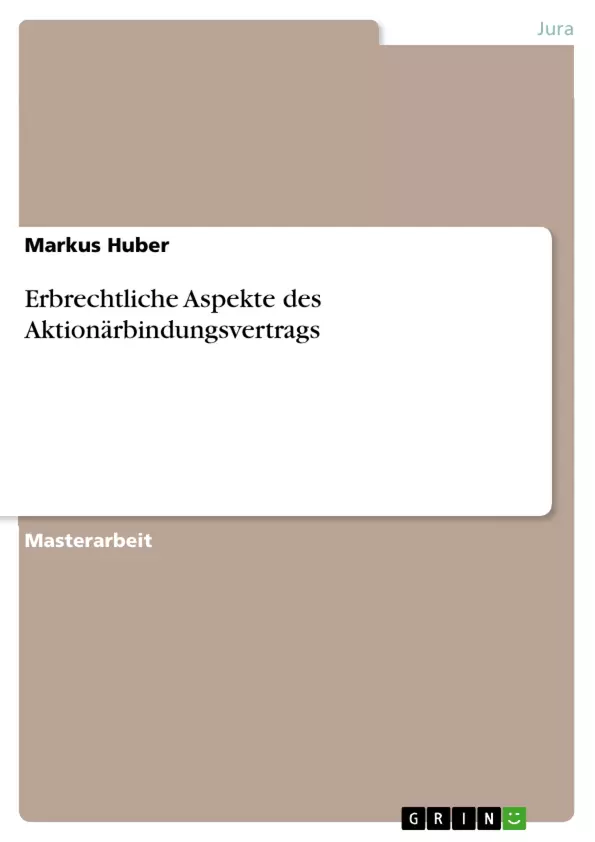Der Begriff des Aktionärbindungsvertrages trägt den Widerspruch in sich und dies nicht nur, weil seine Wortteile unterschiedliche sprachliche Herkunftsgeschichten aufweisen. Der Ambivalenz zwischen dem Aktionär – das Sinnbild für den freiheitlich handelnden, kapitalistisch orientierten Homo oeconomicus – und der Bindung, die eine Beziehung zwischen mehreren menschlichen Wesen voraussetzt, folgt im Wortlaut das Symbol für die selbstverantwortlich handelnde Person schlechthin: der Vertrag.
Schwerpunktmässig befasst sich die vorliegende Arbeit mit den Berührungspunkten zwischen dem Aktionärbindungsvertrag und dem Erbrecht. Dabei wird besonderes Gewicht auf den gesellschaftsrechtlich ausgestalteten Aktionärbindungsvertrag gelegt, das sogenannte „Aktionärskonsortium“, da dieses in der Rechtspraxis gegenüber dem schuldrechtlich ausgestalteten Aktionärbindungsvertrag häufigeren Niederschlag findet. Es werden die verschiedenen Themenbereiche Aktienrecht, Erbrecht, Persönlichkeitsrecht und nicht zuletzt auch Vertragsrecht angeschnitten und vertieft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Ausscheiden eines Vertragspartners durch Tod
- Wirkungen bei schuldrechtlich ausgestalteten ABV
- Im Allgemeinen
- Besonderheiten bei Vermächtnis
- Unbeschwertes Vermächtnis
- Vermächtnis und Bedingung
- Vermächtnis und Auflage
- Wirkungen bei gesellschaftsrechtlich ausgestalteten ABV
- Fortsetzung oder Auflösung des gesellschaftsrechtlich ausgestalteten ABV
- Eintritts- und Nachfolgeklausel
- Eintrittsklausel
- Nachfolgeklausel
- Änderung des Gesellschafterbestandes
- Fortführung der Gesellschaft unter den verbleibenden Gesellschaftern
- Auflösung der Gesellschaft (von Gesetzes wegen oder durch Übereinkunft)
- „Eintritt“ einer Erbengemeinschaft in den ABV
- Auswirkungen auf Stimmbindungsabsprachen
- Auswirkungen auf Kaufs-, Rückkaufs- und Vorkaufsrechte
- Materielle Schranken und Persönlichkeitsschutz
- Dauer der Bindung
- Unbefristete Gesellschaft und Gesellschaft auf Lebenszeit
- Gesellschaften mit unbestimmter Mindestdauer
- Befristete Gesellschaft
- Inhaltliche Intensität der Bindung
- Persönliche Betroffenheit
- Wirtschaftliche Einschränkung
- Grad der Fremdbestimmtheit
- Persönliche Vorteile
- Gestaltungsmittel des Erblassers
- Erbverträge
- Letztwillige Verfügung
- Auflage und Bedingung
- Pflichtteilsschutz
- Positive Teilungsvorschrift
- Teilungsaufschub
- Materielle Schranken
- Willensvollstreckung
- Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit den erbrechtlichen Aspekten des Aktionärbindungsvertrags. Ziel ist es, die rechtlichen Auswirkungen des Todes eines Vertragspartners auf den Aktionärbindungsvertrag zu analysieren und Gestaltungsmöglichkeiten für den Erblasser aufzuzeigen.
- Rechtliche Folgen des Todes eines Vertragspartners für den Aktionärbindungsvertrag
- Gestaltungsmöglichkeiten für den Erblasser im Hinblick auf den Aktionärbindungsvertrag
- Materielle Schranken und Persönlichkeitsschutz im Zusammenhang mit Aktionärbindungsverträgen
- Auswirkungen auf Stimmbindungsabsprachen und Kaufsrechte
- Eintritt einer Erbengemeinschaft in den Aktionärbindungsvertrag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht zunächst die rechtlichen Folgen des Todes eines Vertragspartners für den Aktionärbindungsvertrag, sowohl im schuldrechtlichen als auch im gesellschaftsrechtlichen Kontext. Dabei werden die Auswirkungen auf Eintritts- und Nachfolgeklauseln sowie auf die Auflösung der Gesellschaft beleuchtet. Im weiteren Verlauf werden die Auswirkungen des Todes auf Stimmbindungsabsprachen und Kaufsrechte analysiert. Die Arbeit beschäftigt sich außerdem mit den materiellen Schranken und dem Persönlichkeitsschutz im Zusammenhang mit Aktionärbindungsverträgen, insbesondere mit der Dauer und der inhaltlichen Intensität der Bindung. Schließlich werden Gestaltungsmöglichkeiten für den Erblasser im Hinblick auf den Aktionärbindungsvertrag aufgezeigt, wie beispielsweise die Verwendung von Erbverträgen und letztwilligen Verfügungen.
Schlüsselwörter
Aktionärbindungsvertrag, Erbrecht, Tod, Gesellschaftsrecht, Erblasser, Gestaltungsmöglichkeiten, Stimmbindungsabsprachen, Kaufsrechte, Materielle Schranken, Persönlichkeitsschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Aktionärbindungsvertrag (ABV)?
Ein ABV ist eine Vereinbarung zwischen Aktionären, die über die statutarischen Bestimmungen hinaus Rechte und Pflichten, wie z.B. Stimmbindungen, festlegt.
Was passiert mit einem ABV beim Tod eines Aktionärs?
Dies hängt von der Ausgestaltung ab; oft treten Erben in den Vertrag ein, sofern keine Nachfolge- oder Auflösungsklauseln etwas anderes regeln.
Was ist der Unterschied zwischen schuldrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen ABV?
Schuldrechtliche ABV binden nur die Vertragspartner persönlich, während gesellschaftsrechtliche ABV (Konsortien) oft festere Strukturen und Nachfolgeregelungen haben.
Wie können Erblasser ihre Aktienbeteiligung testamentarisch absichern?
Durch Erbverträge, Auflagen oder Bedingungen in letztwilligen Verfügungen, um die Bindung an den ABV auch nach dem Tod sicherzustellen.
Gibt es zeitliche Schranken für die Bindung in einem ABV?
Ja, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes darf die Bindungsdauer nicht übermäßig lang sein, um die wirtschaftliche Freiheit der Erben nicht ungebührlich einzuschränken.
- Arbeit zitieren
- Markus Huber (Autor:in), 2011, Erbrechtliche Aspekte des Aktionärbindungsvertrags, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355992