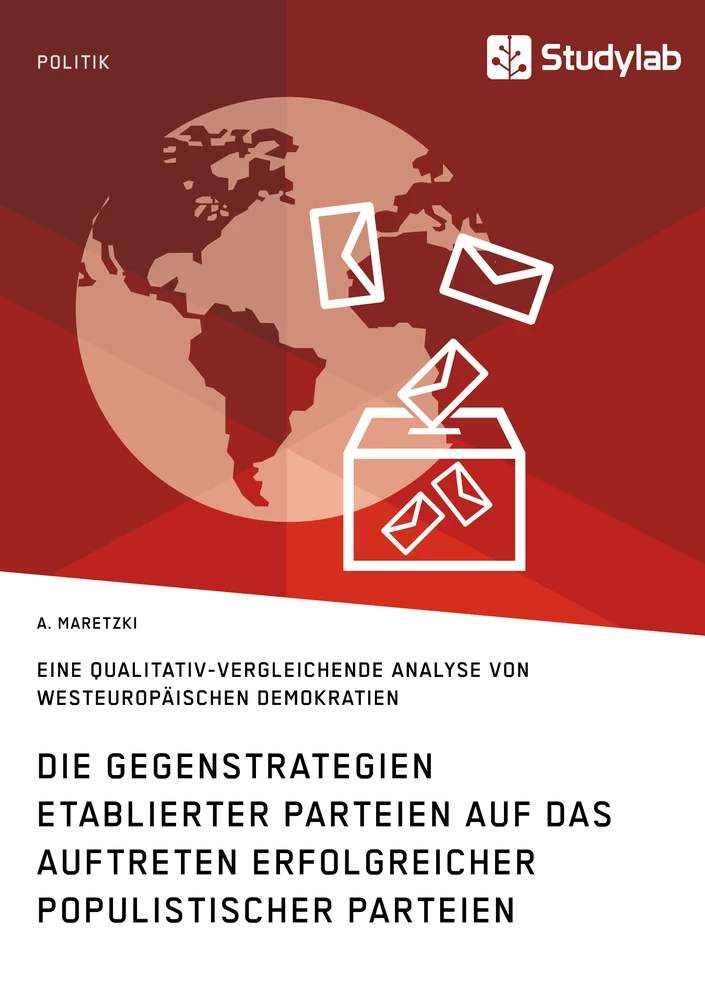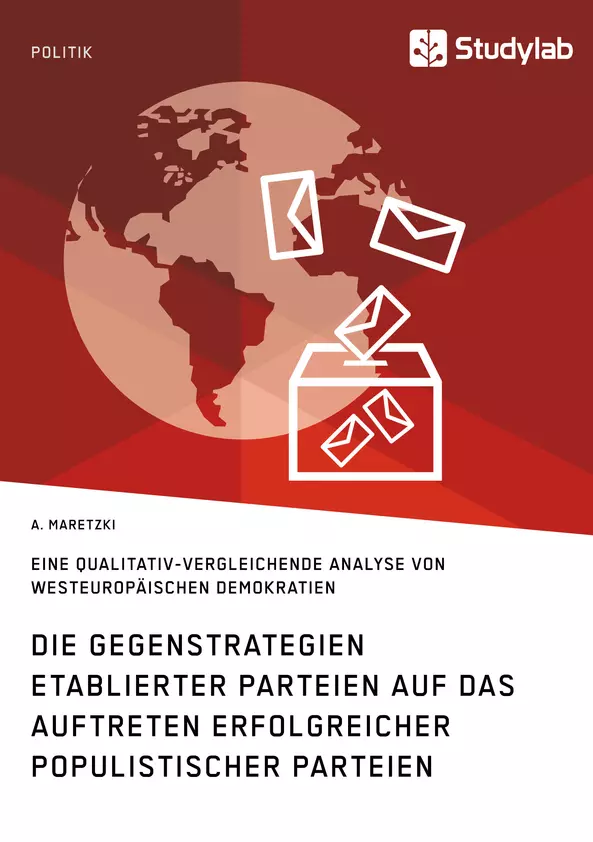An immer mehr europäischen Regierungen sind Gruppen von europäischen Rechtspopulisten beteiligt, die sich ambivalent zur liberalen Demokratie positionieren. Über kurz oder lang stellt sich die Frage nach dem „richtigen“ Umgang mit diesen Gruppen.
Diverse Einzelfallstudien legen nahe, dass keine „one-size-fits-all“-Strategie zur Eindämmung der populistischen Akteure existiert, sondern dass die Wahl und die Effektivität von Gegenstrategien vom spezifischen politischen und sozialen Kontext abhängig sind. In diesem Buch wird daher gefragt: Mittels welcher Faktoren lässt sich die Variation hinsichtlich der Wahl der jeweiligen Gegenstrategie(n) der etablierten Parteien gegenüber erfolgreichen populistischen Akteuren in Belgien, Frankreich und Österreich erklären?
Hierbei werden sowohl historische und institutionelle Faktoren, die minimal range-Koalitionstheorie als auch der bisher noch nicht systematisch empirisch überprüfte Erklärungsfaktor der Art des dominanten Demokratieverständnisses innerhalb des Elektorats in den Blick genommen.
Aus dem Inhalt:
- (Rechts-)Populismus;
- Extremismus;
- Demokratie;
- Front National;
- Freiheitliche Partei Österreichs
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Konzeptspezifikation
- 2.1 (Rechts-) Populismus
- 2.2 Populismus und Extremismus
- 2.3 Gründe für den Einsatz von Gegenstrategien
- 2.4 Gegenstrategien
- 3 Fallauswahl und Forschungsdesign
- 4 Theoretischer Rahmen + Operationalisierung
- 4.1 Historische Erfahrungen mit Extremismus
- 4.2 Grad der in der Verfassung verankerten Militanz
- 4.3 Fragmentierungs- und Segmentierungsgrad
- 4.4 Rationale Koalitionsbildung
- 4.5 Dominantes Demokratieverständnis im Mitte-Rechts-Elektorat
- 5 Kontext + deskriptive Darstellung der eingesetzten Gegenstrategien
- 5.1 Vlaams Blok (Vlaams Belang)
- 5.2 Front National
- 5.3 Freiheitliche Partei Österreichs
- 6 Empirisch-vergleichende Analyse
- 6.1 Historische Erfahrungen mit Extremismus
- 6.2 Grad der in der Verfassung verankerten Militanz
- 6.3 Fragmentierungs- und Segmentierungsgrad
- 6.4 Rationale Koalitionsbildung
- 6.5 Dominantes Demokratieverständnis im Mitte-Rechts-Elektorat
- 7 Fazit und Ausblick
- 8 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Variation der Gegenstrategien etablierter Parteien gegenüber erfolgreichen radikal-rechtspopulistischen Akteuren in Belgien, Frankreich und Österreich. Sie analysiert die Faktoren, die diese Variation bedingen, indem sie historische, institutionelle Faktoren, die minimal range Koalitionstheorie und das dominante Demokratieverständnis innerhalb des Elektorats betrachtet. Das zentrale Ziel ist die Identifizierung theoretischer Muster, die für die vergleichende Forschung nutzbar gemacht werden können.
- Variation der Gegenstrategien etablierter Parteien gegenüber radikal-rechtspopulistischen Akteuren
- Einfluss historischer und institutioneller Faktoren
- Rolle der minimal range Koalitionstheorie
- Bedeutung des dominanten Demokratieverständnisses im Elektorat
- Identifizierung theoretischer Muster für die vergleichende Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gegenstrategien etablierter Parteien gegenüber populistischen Akteuren ein und stellt die Forschungsfrage und Zielsetzung der Arbeit dar. Das Kapitel "Konzeptspezifikation" definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, wie (Rechts-)Populismus, Populismus und Extremismus sowie die Gründe für den Einsatz von Gegenstrategien und die verschiedenen Arten von Gegenstrategien. Die Fallauswahl und das Forschungsdesign werden im dritten Kapitel erläutert. Der "Theoretische Rahmen + Operationalisierung" stellt die wichtigsten theoretischen Ansätze vor, die für die Analyse der Gegenstrategien relevant sind. Dazu gehören historische Erfahrungen mit Extremismus, der Grad der in der Verfassung verankerten Militanz, der Fragmentierungs- und Segmentierungsgrad, die rationale Koalitionsbildung und das dominante Demokratieverständnis im Mitte-Rechts-Elektorat. Im fünften Kapitel werden die konkreten Fälle Belgien, Frankreich und Österreich mit ihren jeweiligen populistischen Akteuren und den eingesetzten Gegenstrategien vorgestellt. Die empirisch-vergleichende Analyse im sechsten Kapitel untersucht die Anwendung der theoretischen Ansätze auf die drei Fallbeispiele und analysiert die Variation der Gegenstrategien anhand der spezifischen Faktoren. Das Fazit und der Ausblick resümieren die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit und geben Hinweise auf zukünftige Forschungsrichtungen.
Schlüsselwörter
Gegenstrategien, etablierte Parteien, radikal-rechtspopulistische Akteure, Belgien, Frankreich, Österreich, historische Erfahrungen, institutionelle Faktoren, minimal range Koalitionstheorie, dominantes Demokratieverständnis, Elektorat, vergleichende Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagieren etablierte Parteien auf Rechtspopulismus?
Etablierte Parteien nutzen verschiedene Gegenstrategien, die von Ausgrenzung (Cordon Sanitaire) bis hin zu inhaltlicher Adaption oder Koalitionsbildung reichen.
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Die Arbeit analysiert die Situation und die Gegenstrategien in Belgien (Vlaams Belang), Frankreich (Front National) und Österreich (FPÖ).
Welche Rolle spielt die „wehrhafte Demokratie“?
Der Grad der in der Verfassung verankerten Militanz (wehrhafte Demokratie) beeinflusst, welche rechtlichen und politischen Mittel gegen populistische Akteure eingesetzt werden können.
Warum gibt es keine einheitliche Strategie gegen Populisten?
Die Wahl der Strategie hängt stark vom spezifischen politischen Kontext, historischen Erfahrungen mit Extremismus und dem Demokratieverständnis der Wähler ab.
Was besagt die Koalitionstheorie in diesem Zusammenhang?
Die Theorie der rationalen Koalitionsbildung untersucht, unter welchen Bedingungen etablierte Parteien bereit sind, mit Populisten zusammenzuarbeiten, um Regierungsmehrheiten zu sichern.
- Quote paper
- A. Maretzki (Author), 2017, Die Gegenstrategien etablierter Parteien auf das Auftreten erfolgreicher populistischer Parteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356099