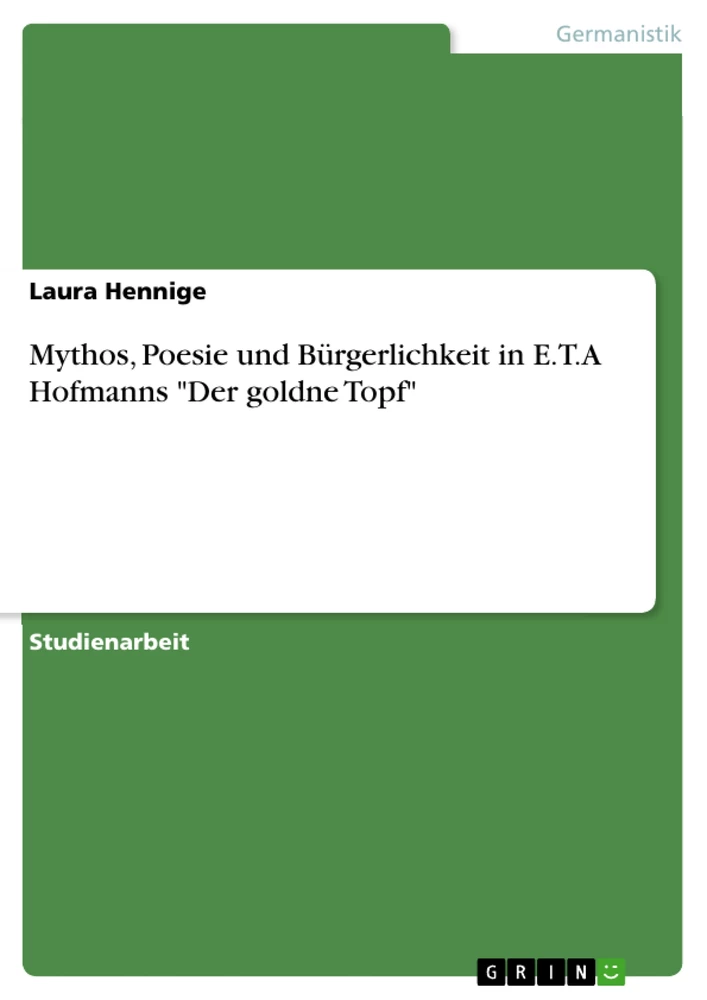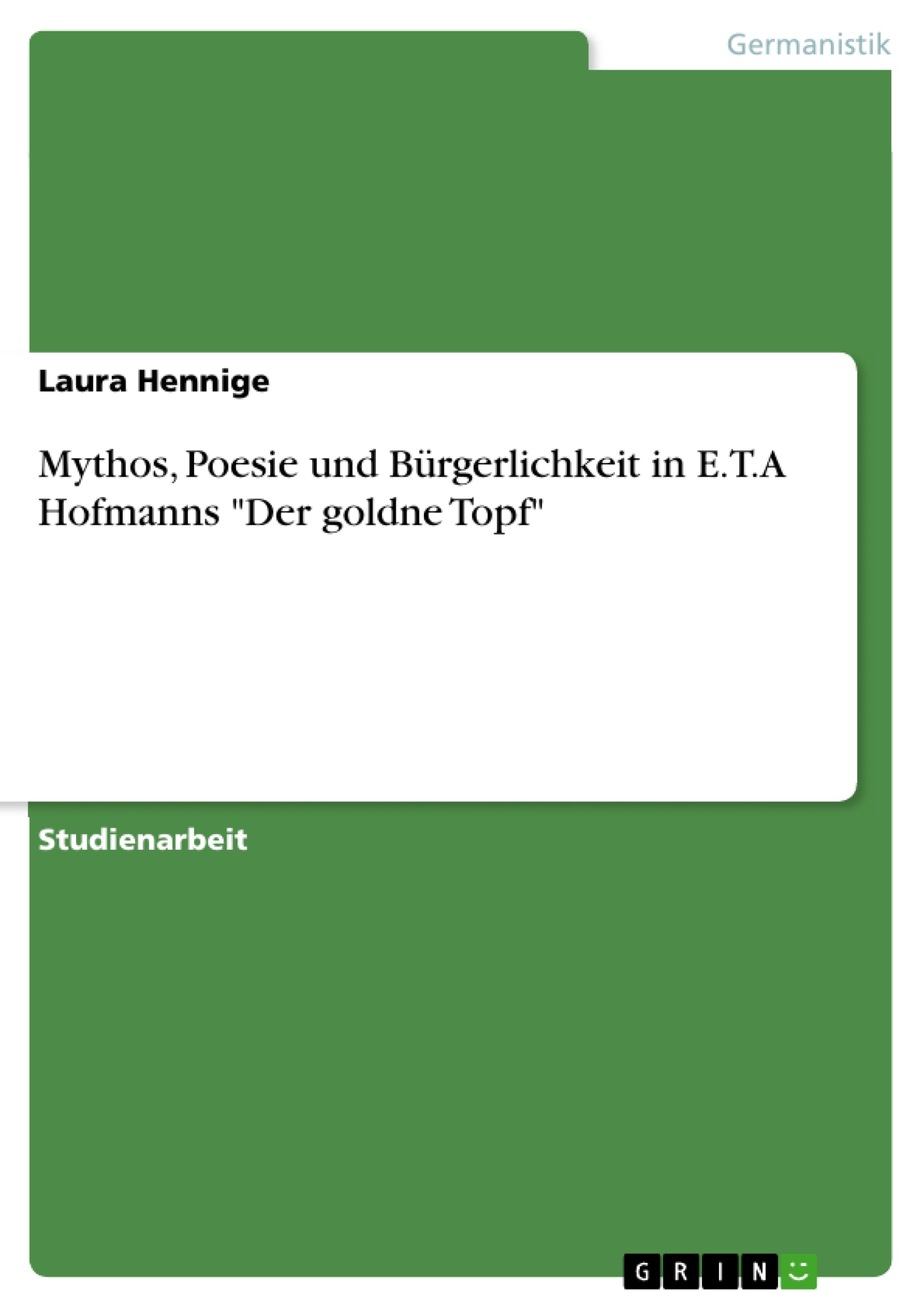„Ein Märchen aus der neuen Zeit“, das verkündet der Untertitel des 1814 veröffentlichten Märchens Der goldne Topf von E.T.A Hoffmann. Auf mehrere Arten ist dieses Märchen lesbar. Man ist sich nicht sicher, ob sich die Hauptpersonen wirklich in einer wunderbaren Welt befinden oder ob alles nur Einbildung ist. Sicher ist nur, die Geschichte spielt in Dresden - und wie viel Wunderbares kann einem da schon wiederfahren?
In dieser Arbeit soll geklärt werden, wie man mit dem Werk umgehen soll, was erforderlich ist, um zu verstehen, wie er sich zur Romantik stellt und welche Motive er verwendet, um dem Leser seine Sicht deutlich zu machen. Zunächst wird das Werk selbst betrachtet, eine kurze Inhaltsübersicht gibt einen Einblick in das Geschehen, außerdem werden die wichtigsten Personen und ihre Funktion im Märchen genannt und der Aufbau wird analysiert.
In einer weiteren Untersuchung soll, auch anhand von anderen Texten, das Problem Poesie und Mythos betrachtet werden. Hierzu wird Friedrich Schlegels Rede über die Poesie gegenübergestellt. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, inwiefern das Thema Mythos als Problem der Sprache, der Poesie und vorallem der Bürgerlichkeit angesehen werden kann und ob die Mythologie in der Gesellschaft überhaupt eine Chance hat zu existieren. Schlegel verlangt nach Poesie und Mythologie, sieht hier aber keine Vereinbarkeit mit dem bürgerlichen Leben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autor
- Werk
- Inhaltsübersicht
- Personen
- Aufbau
- Interpretation
- Mythos, Poesie und Bürgerlichkeit
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit E.T.A. Hoffmanns Märchen „Der goldne Topf“ und untersucht dessen Vielschichtigkeit, insbesondere in Bezug auf die Themen Mythos, Poesie und Bürgerlichkeit. Ziel ist es, die besonderen Merkmale des Werkes zu beleuchten und Hoffmanns Stellung zur Romantik zu erforschen.
- Die Verbindung von Realismus und Fantastik in der Darstellung der Stadt Dresden
- Die Rolle von Mythologie und Poesie in der bürgerlichen Gesellschaft
- Die Ambivalenz des Verhältnisses von Mensch und Natur
- Die Bedeutung von Träumen und Visionen für die Figuren
- Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Konventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Märchen „Der goldne Topf“ vor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Im zweiten Kapitel wird ein kurzer Überblick über E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk gegeben. Das dritte Kapitel behandelt das Märchen selbst, analysiert die Inhaltsübersicht, stellt die wichtigsten Personen und ihre Funktion vor und untersucht den Aufbau des Werkes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Romantik, insbesondere Mythos, Poesie und Bürgerlichkeit. Weitere wichtige Begriffe sind: Fantastik, Realismus, Träume, Visionen, gesellschaftliche Normen, Konventionen, Kunst und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Hoffmanns „Der goldne Topf“?
Es wird als „Märchen aus der neuen Zeit“ bezeichnet und verknüpft die reale Welt Dresdens mit einer fantastischen, wunderbaren Welt.
Welche Rolle spielt die Bürgerlichkeit im Werk?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen der bürgerlichen Welt (Normen, Konventionen) und der Welt der Poesie und des Mythos, in die der Protagonist Anselmus eintaucht.
Wie steht E.T.A. Hoffmann zur Romantik?
Hoffmann nutzt romantische Motive wie Träume und Visionen, um die Ambivalenz zwischen Mensch und Natur sowie Kunst und Gesellschaft darzustellen.
Was ist Friedrich Schlegels Bezug zu diesem Thema?
Schlegels „Rede über die Poesie“ wird herangezogen, um zu klären, ob Mythologie und bürgerliches Leben laut romantischer Theorie überhaupt vereinbar sind.
Ist die Wunderwelt im Märchen real oder Einbildung?
Das Werk lässt diese Frage bewusst offen und spielt mit der Vielschichtigkeit der Wahrnehmung der Hauptpersonen.
- Citar trabajo
- Laura Hennige (Autor), 2013, Mythos, Poesie und Bürgerlichkeit in E.T.A Hofmanns "Der goldne Topf", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356448