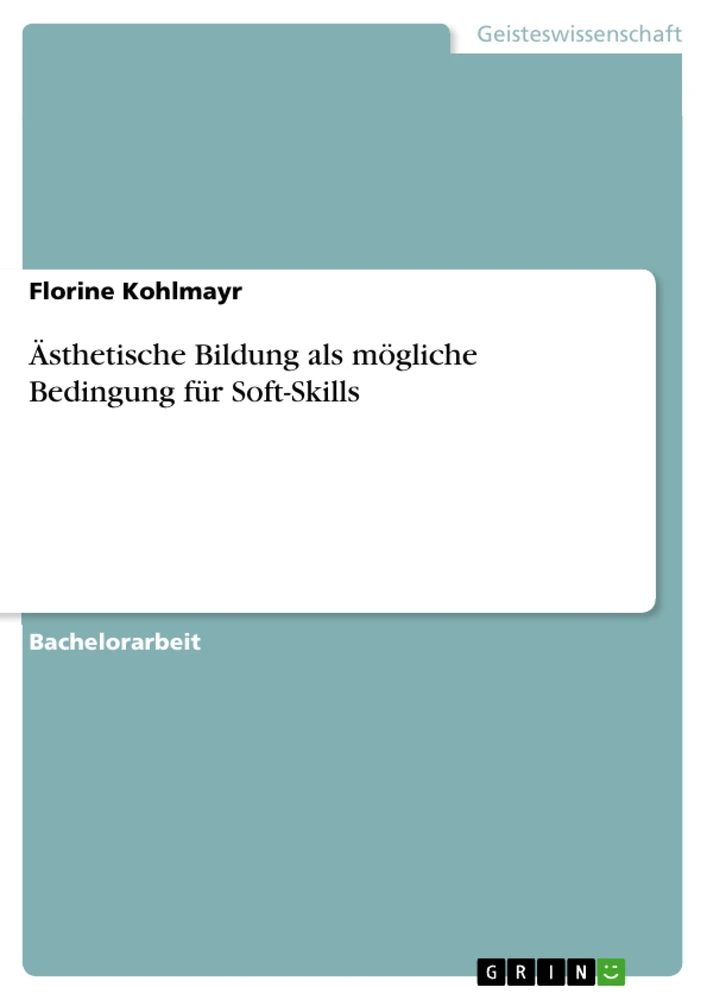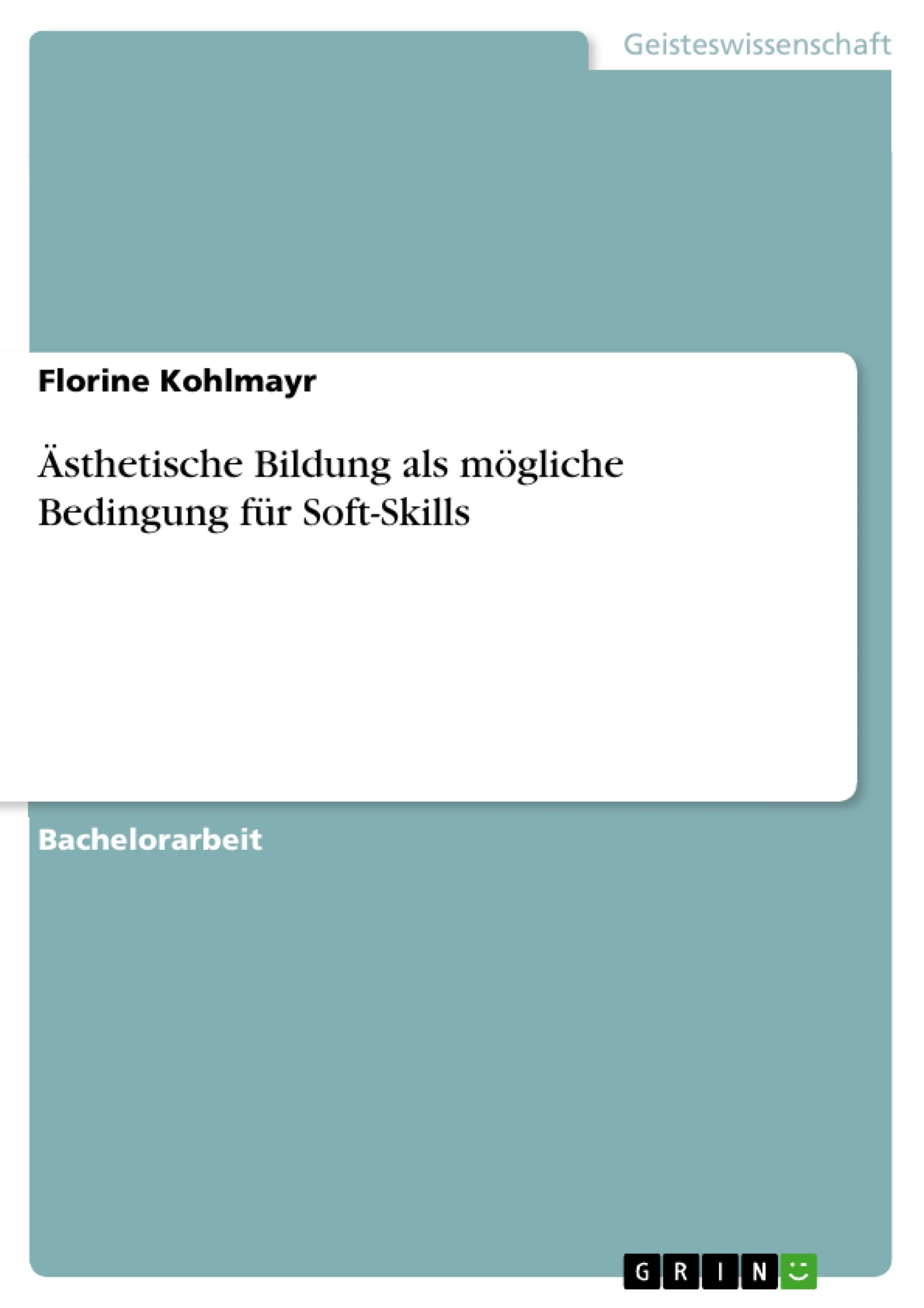Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, eine Argumentation zu führen, die aufzeigt, dass in der Ästhetischen Bildung eine mögliche Bedingung für den Erwerb von Soft-Skills liegt. Unter einer möglichen Bedingung wird hier eine realisierbare Bedingung verstanden. Es soll gezeigt werden, dass Soft-Skills, wie soziale Kommunikationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, und Selbstständigkeit durch ästhetische Bildung gefördert werden können.
Eine These dieser Arbeit ist, dass sogenannte Soft-Skills immer mehr an Bedeutung gewinnen und Bildungsinhalte und Methoden dementsprechend angepasst werden müssen. Deshalb soll eine Verschränkung aufgezeigt werden, die ökonomische Interessen, durch den Erwerb von benötigten Soft-Skills, mit den Ideen der Ästhetischen Bildung in Verbindung bringt.
Zunächst wird in dieser Arbeit eine ökonomische bzw. soziologische Perspektive aufgezeigt, die den Wandel in der Arbeitswelt skizziert, um zu verdeutlichen, wie sich Anforderungen und Qualifikationen in ihr verändert haben. Daraus werden Schlussfolgerungen gezogen, welche Fähigkeiten auf dem jetzigen und zukünftigen Arbeitsmarkt gebraucht werden. In einem weiteren Schritt soll sich der Ästhetischen Bildung genähert werden, indem zuerst der Bildungsbegriff näher erläutert wird und untersucht wird, welchen Stellungswert Wissen im 21. Jahrhundert einnimmt.
Danach wird auf den Diskurs von Ästhetik eingegangen, um herauszustellen, inwiefern ein Bildungspotenzial in ihr steckt. Es werden theoretische Gedanken aus Anthropologie, Philosophie, Pädagogik und bildungstheoretischen Ansätzen gesammelt, die sich mit ästhetischer Bildung auseinandersetzen. Drittens wird eine neurowissenschaftliche Perspektive aufgezeigt, um die Wirkung von ästhetischen Bildungsprozessen durch neueste Erkenntnisse in der Hirnforschung zu untermauern und zusätzlich zu legitimieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Bildung als Investition
- 2. Soft-Skills
- 2.1. Der Begriff der Soft-Skills
- 2.2. Der Wandel in der Arbeitswelt
- 2.3. Qualifikationen von ArbeitnehmerInnen
- 2.4. Kategorisierung von Soft-Skills
- 2.5. Begriffsbestimmungen der ausgewählten Soft-Skills
- 2.5.1. Soft-Skill: Innovationsfähigkeit
- 2.5.2. Soft-Skill: Kommunikationsfähigkeit
- 2.5.3. Soft-Skill: Eigenständigkeit
- 2.6. Schlussfolgerungen
- 3. Bildung
- 3.1. Der Begriff der Bildung
- 3.2. Bildung in der Wissensgesellschaft
- 4. Diskurse des Ästhetischen
- 4.1. Die begrifflichen Ebenen
- 4.2. Ästhetik und Bildung
- 4.3. Ästhetik zwischen Ratio und Sinnlichkeit
- 4.3.1. Kant
- 4.3.2. Baumgarten
- 4.4. Ästhetik und Aisthesis
- 5. Ästhetische Bildung
- 5.1. Anthropologische Grundlagen der Ästhetischen Bildung
- 5.2. Rationalität und Sinnlichkeit als Einheit
- 5.3. Ästhetische Bildung nach Mollenhauer
- 5.4. Ästhetische Bildung und Kunst
- 5.5. Zusammenfassung
- 5.6. Ziele und Möglichkeiten Ästhetischer Bildung
- 6. Kompetenzorientierung im Fach Kunst
- 7. Legitimationen für Ästhetische Bildungsprozesse
- 7.1. Neurowissenschaften und nachhaltiges Lernen
- 7.2. Evaluation und Messproblematiken
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, dass ästhetische Bildung eine mögliche Bedingung für den Erwerb von Soft Skills darstellt. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Wandel der Arbeitswelt, dem Bedarf an Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und Eigenständigkeit, und dem Potential ästhetischer Bildung, diese Fähigkeiten zu fördern. Die Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der ökonomische, soziologische, pädagogische und neurowissenschaftliche Perspektiven integriert.
- Der Bedarf an Soft Skills im Kontext des Wandels der Arbeitswelt
- Der Begriff und die Bedeutung von ästhetischer Bildung
- Der Zusammenhang zwischen ästhetischer Bildung und dem Erwerb von Soft Skills
- Neurowissenschaftliche Perspektiven auf die Wirkung ästhetischer Bildung
- Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation ästhetischer Bildungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Bildung als Investition: Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Bildung, wirtschaftlicher Entwicklung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit her. Sie argumentiert, dass die Wirtschaft Schlüsselkompetenzen benötigt, die durch Bildung vermittelt werden müssen, wobei Soft Skills zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Arbeit fokussiert auf die These, dass ästhetische Bildung eine mögliche Bedingung für den Erwerb solcher Soft Skills darstellt.
2. Soft-Skills: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Soft Skills" und analysiert den Wandel in der Arbeitswelt, der zu einem erhöhten Bedarf an diesen Fähigkeiten geführt hat. Es kategorisiert verschiedene Soft Skills und beschreibt detailliert ausgewählte Beispiele, wie Innovationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Eigenständigkeit. Schlussfolgerungen dieses Kapitels unterstreichen die Bedeutung von Soft Skills für die zukünftige Arbeitswelt.
3. Bildung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Bildung und ihrer Rolle in der Wissensgesellschaft. Es analysiert den Stellenwert von Wissen im 21. Jahrhundert und legt den Grundstein für die spätere Diskussion über das Bildungspotential der Ästhetik.
4. Diskurse des Ästhetischen: Dieses Kapitel beleuchtet den Diskurs um den Begriff der Ästhetik, untersucht verschiedene begriffliche Ebenen und erörtert den Zusammenhang zwischen Ästhetik und Bildung. Es bezieht sich auf philosophische Positionen, insbesondere Kant und Baumgarten, um die Beziehung zwischen Ratio und Sinnlichkeit im Kontext der Ästhetik zu verdeutlichen.
5. Ästhetische Bildung: Dieses Kapitel befasst sich mit den anthropologischen Grundlagen der ästhetischen Bildung, betrachtet die Einheit von Rationalität und Sinnlichkeit und diskutiert verschiedene Ansätze ästhetischer Bildung, unter anderem den Ansatz von Mollenhauer. Der Zusammenhang zwischen ästhetischer Bildung und Kunst wird ebenfalls untersucht.
6. Kompetenzorientierung im Fach Kunst: Dieses Kapitel analysiert, wie Kompetenzen im Fach Kunst vermittelt und gefördert werden können und inwieweit diese mit dem Erwerb von Soft Skills korrelieren. Es befasst sich mit den didaktischen Aspekten der Kunstpädagogik und deren Beitrag zur Entwicklung von Soft Skills.
7. Legitimationen für Ästhetische Bildungsprozesse: Dieses Kapitel untersucht, wie ästhetische Bildungsprozesse legitimiert werden können, u.a. durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse über nachhaltiges Lernen. Es befasst sich auch mit den Herausforderungen und Problematiken im Zusammenhang mit der Evaluation ästhetischer Bildung.
Schlüsselwörter
Ästhetische Bildung, Soft Skills, Innovationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Eigenständigkeit, Wissensgesellschaft, Arbeitsmarkt, Neurowissenschaften, Bildung, Kunst, Kompetenzorientierung, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Ästhetische Bildung und Soft Skills"
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen ästhetischer Bildung und dem Erwerb von Soft Skills. Die zentrale These lautet, dass ästhetische Bildung eine Bedingung für den Erwerb von Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit und Eigenständigkeit sein kann.
Welche Soft Skills werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Innovationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Eigenständigkeit. Diese Soft Skills werden im Detail definiert und im Kontext des Wandels der Arbeitswelt analysiert.
Wie wird der Wandel der Arbeitswelt dargestellt?
Der Wandel der Arbeitswelt wird als ein wichtiger Faktor für den steigenden Bedarf an Soft Skills dargestellt. Die Arbeit beschreibt, wie sich die Anforderungen an Arbeitnehmer*innen verändern und welche Rolle Soft Skills dabei spielen.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und integriert ökonomische, soziologische, pädagogische und neurowissenschaftliche Perspektiven.
Welche Rolle spielt die Ästhetik in dieser Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den Diskurs um den Begriff der Ästhetik, untersucht verschiedene begriffliche Ebenen und erörtert den Zusammenhang zwischen Ästhetik und Bildung. Philosophische Positionen, insbesondere von Kant und Baumgarten, werden zur Verdeutlichung der Beziehung zwischen Ratio und Sinnlichkeit im Kontext der Ästhetik herangezogen.
Wie wird ästhetische Bildung definiert und verstanden?
Die Arbeit befasst sich mit den anthropologischen Grundlagen der ästhetischen Bildung, betrachtet die Einheit von Rationalität und Sinnlichkeit und diskutiert verschiedene Ansätze ästhetischer Bildung, unter anderem den Ansatz von Mollenhauer. Der Zusammenhang zwischen ästhetischer Bildung und Kunst wird ebenfalls untersucht.
Welche Bedeutung haben die Neurowissenschaften in diesem Kontext?
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse über nachhaltiges Lernen werden herangezogen, um ästhetische Bildungsprozesse zu legitimieren und deren Wirkung zu belegen.
Wie werden die Ergebnisse der Arbeit evaluiert?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen und Problematiken im Zusammenhang mit der Evaluation ästhetischer Bildung und geht auf mögliche Messproblematiken ein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Soft Skills, Bildung, Diskurse des Ästhetischen, Ästhetische Bildung, Kompetenzorientierung im Fach Kunst, Legitimationen für Ästhetische Bildungsprozesse und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ästhetische Bildung, Soft Skills, Innovationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Eigenständigkeit, Wissensgesellschaft, Arbeitsmarkt, Neurowissenschaften, Bildung, Kunst, Kompetenzorientierung, Evaluation.
- Quote paper
- Florine Kohlmayr (Author), 2016, Ästhetische Bildung als mögliche Bedingung für Soft-Skills, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356567