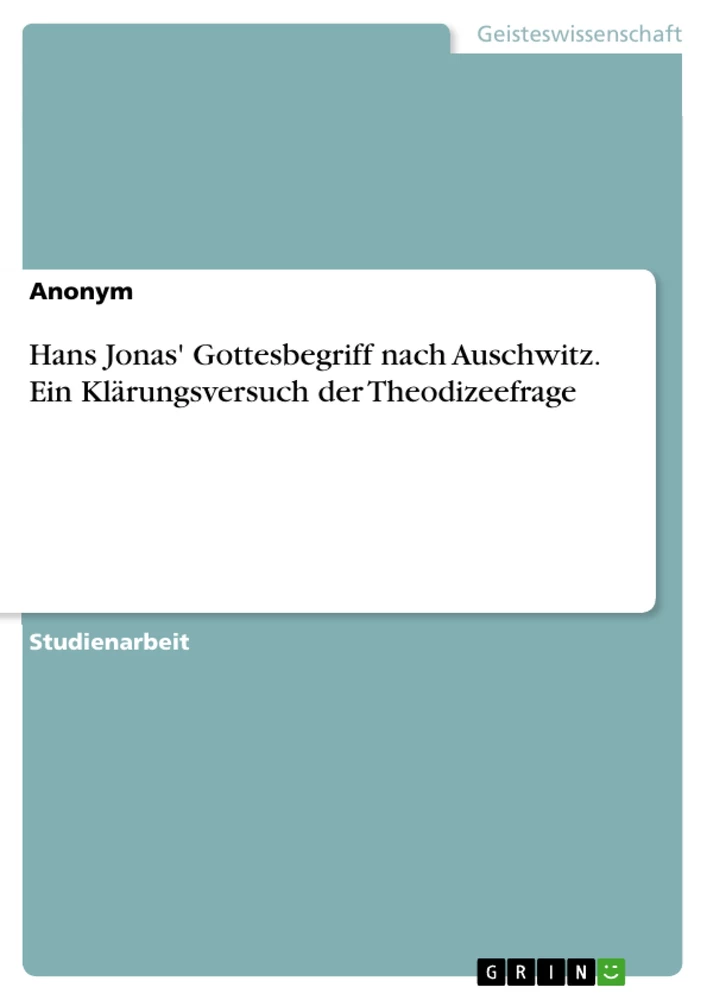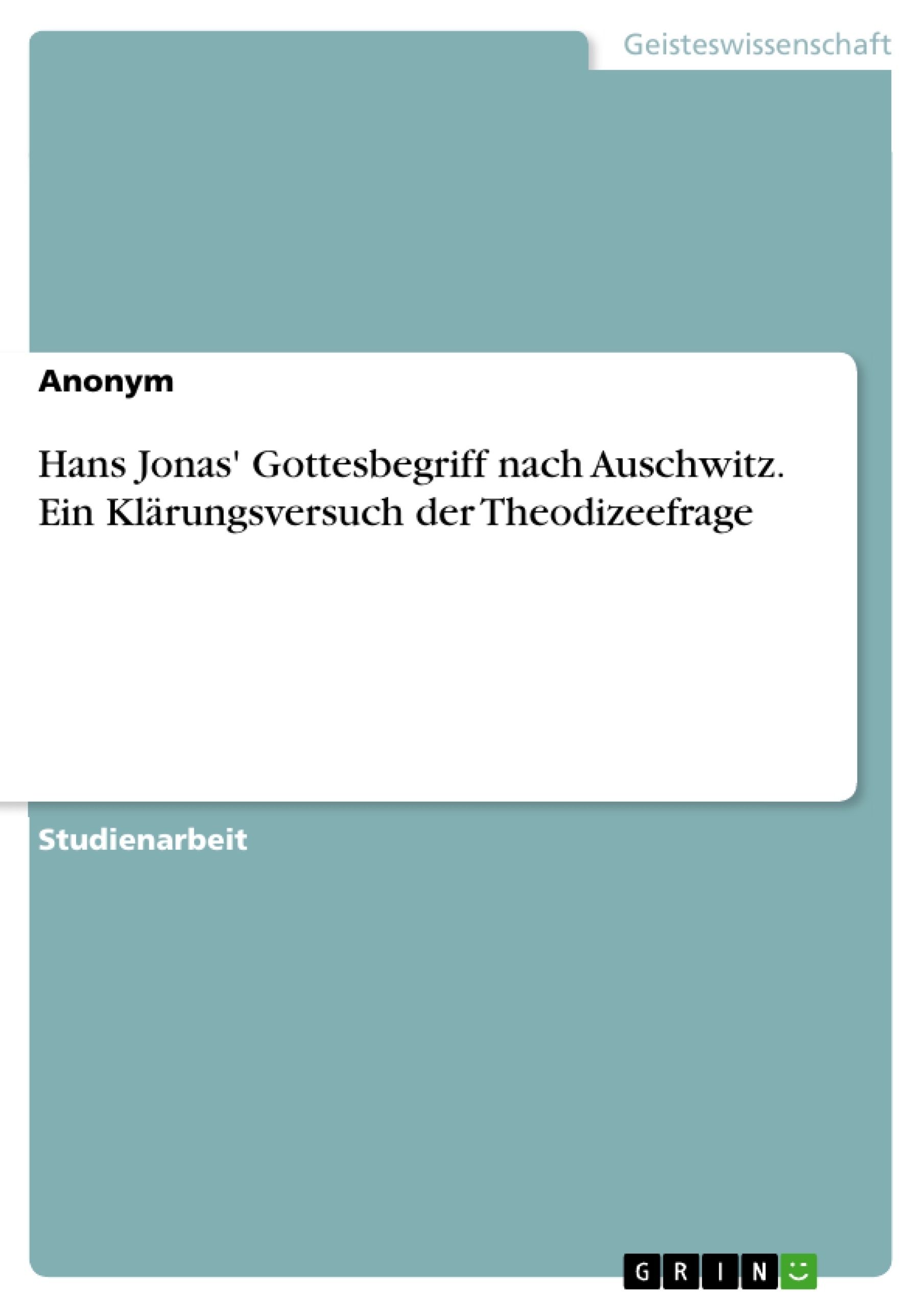Die Hausarbeit erläutert den Gottesbegriff von Hans Jonas nach den Geschehnissen in Auschwitz und beleuchtet diesen kritisch. Zuerst wird sich der Autor mit Auschwitz beschäftigen und wofür dieser Begriff heute steht. Anschließend wird die Theodizeefrage definiert und genauer beleuchtet. Zentrum der Ausarbeitung bildet die Rede von Hans Jonas. Nach einer kurzen Vorstellung von Jonas werden die Inhalte seines Vortrages erläutert und abschließend kritisch analysiert.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte kam es immer wieder zu Katastrophen, Kriegen und Hungersnöten. Aktuell wird die Welt durch Terror und Angst bedroht, Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht aus ihrer Heimat. Die Frage nach dem Leid in der Welt und wie ein Gott diese zulassen kann, beschäftigt die Menschen dadurch schon immer. Die Religionen haben im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Theorien entworfen, wie diese scheinbar widersprüchlichen Dinge in Einklang gebracht werden können. Der Versuch einer Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids in der Welt wird mit dem Begriff der Theodizee umschrieben.
Durch die Geschehnisse des 2.Weltkrieges erreichten diese Überlegungen jedoch eine neue Stufe. Eine weitere Steigerung des Leids und der Gewalt, die die Menschen ratlos zurücklässt. Auschwitz steht wie kein zweites Bild für diese grausame Zeit. Dem Hass der Nationalsozialisten fielen nicht nur Millionen von Juden zum Opfer. Jedoch gerade für sie, das von Gott auserwählte Volk, entsteht hier ein Konflikt, der unlösbar erscheint. Welcher Gott kann so etwas zulassen? Noch dazu bei seinem auserwählten Volk?
Hans Jonas, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, war selbst Jude und persönlich von den Ereignissen betroffen. Er beschäftigte sich mit diesen Fragen, da er seinen Glauben an Gott nicht aufgeben wollte. In einer Festrede zur Verleihung des Dr.-Leopold-Lucas-Preises der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen im Jahre 1984 ging er dem Gottesbegriff nach Auschwitz nach. Schon rein begrifflich lässt sich hier ein Bruch erkennen, zwischen der Zeit vor Auschwitz und danach. Die Ereignisse haben bei ihm offensichtlich zu einem Überdenken des Gottesbildes geführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auschwitz als Symbol für den Holocaust
- Die Theodizeefrage
- Hans Jonas
- Der Gottesbegriff nach Auschwitz
- Die Rede
- Der selbsterdachte Mythos
- Konsequenzen für das Gottesbild
- Analyse
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Hans Jonas' Gottesbegriff nach Auschwitz und untersucht, wie die Ereignisse des Holocaust den Philosophen zu einer Neubewertung des Gottesbildes führten. Die Arbeit beleuchtet, wie Jonas die Theodizeefrage, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids in der Welt, im Kontext des Holocaust neu denkt.
- Der Einfluss des Holocaust auf das Gottesbild
- Die Theodizeefrage im Kontext von Auschwitz
- Jonas' Analyse des Gottesbegriffs nach Auschwitz
- Konsequenzen für das Verständnis von Gottes Allmacht und Güte
- Die Bedeutung von Leid und Verantwortung im Gottesbild
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Theodizeefrage im Kontext der Menschheitsgeschichte vor und erklärt, wie die Ereignisse des 2. Weltkriegs und insbesondere Auschwitz eine neue Dimension des Leids und der Gewalt offenbarten. Das zweite Kapitel beleuchtet Auschwitz als Symbol für den Holocaust und beschreibt die systematische Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten. Im dritten Kapitel wird die Theodizeefrage definiert und die unterschiedlichen Lösungsansätze, die im Laufe der Geschichte entwickelt wurden, erläutert. Das vierte Kapitel stellt Hans Jonas kurz vor und führt in seine Rede zum Gottesbegriff nach Auschwitz ein. Das fünfte Kapitel analysiert die Inhalte von Jonas' Rede, in der er die Konsequenzen des Holocaust für das Gottesbild untersucht. Die Arbeit endet mit einer kritischen Analyse von Jonas' Argumentation.
Schlüsselwörter
Theodizee, Holocaust, Auschwitz, Hans Jonas, Gottesbegriff, Leid, Verantwortung, Allmacht, Güte, Mythos, Religion, Philosophie
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht Hans Jonas in Bezug auf Auschwitz?
Hans Jonas untersucht die Notwendigkeit, den Gottesbegriff nach den Gräueltaten von Auschwitz neu zu definieren, da das traditionelle Gottesbild unzureichend erscheint.
Was bedeutet die „Theodizeefrage“ in diesem Kontext?
Die Theodizeefrage befasst sich mit der Rechtfertigung eines allmächtigen und gütigen Gottes angesichts des massiven Leids in der Welt, wie es der Holocaust darstellt.
Welche Konsequenzen zieht Jonas für das Gottesbild?
In seiner Rede entwickelt Jonas einen „selbsterdachten Mythos“, der Konsequenzen für das Verständnis von Gottes Allmacht hat und die menschliche Verantwortung betont.
Warum ist Auschwitz ein Wendepunkt für die Philosophie?
Auschwitz steht für eine neue Stufe von Gewalt und Leid, die herkömmliche religiöse Erklärungsmodelle an ihre Grenzen bringt und einen radikalen Bruch in der Denktradition markiert.
Wer war Hans Jonas?
Hans Jonas war einer der bedeutendsten jüdischen Philosophen des 20. Jahrhunderts und persönlich von den Ereignissen des Holocaust betroffen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Hans Jonas' Gottesbegriff nach Auschwitz. Ein Klärungsversuch der Theodizeefrage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356578