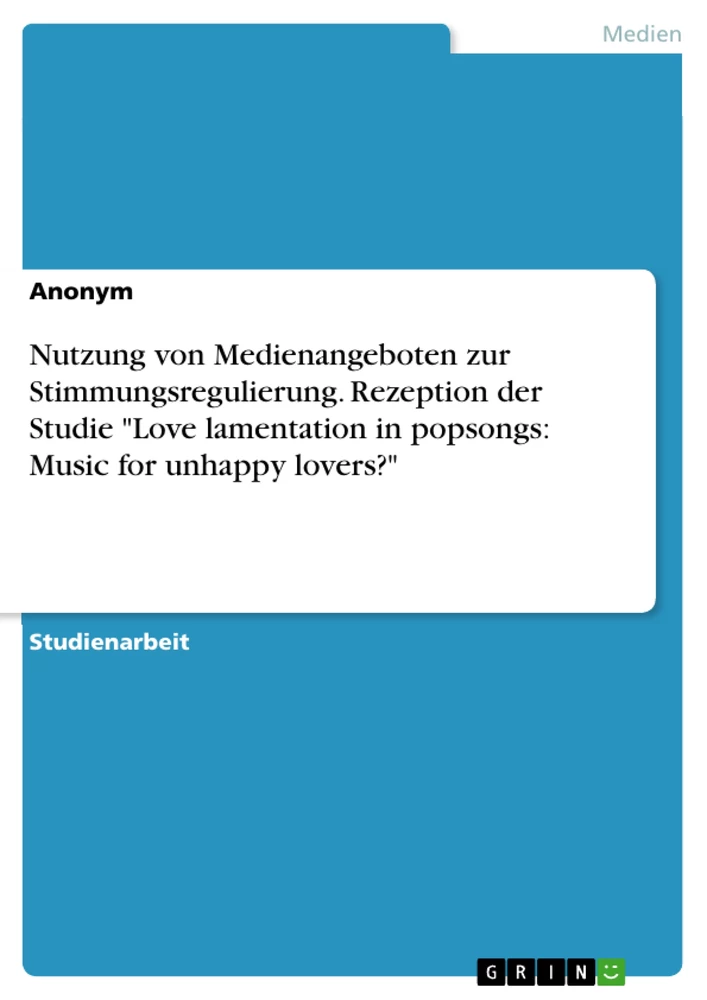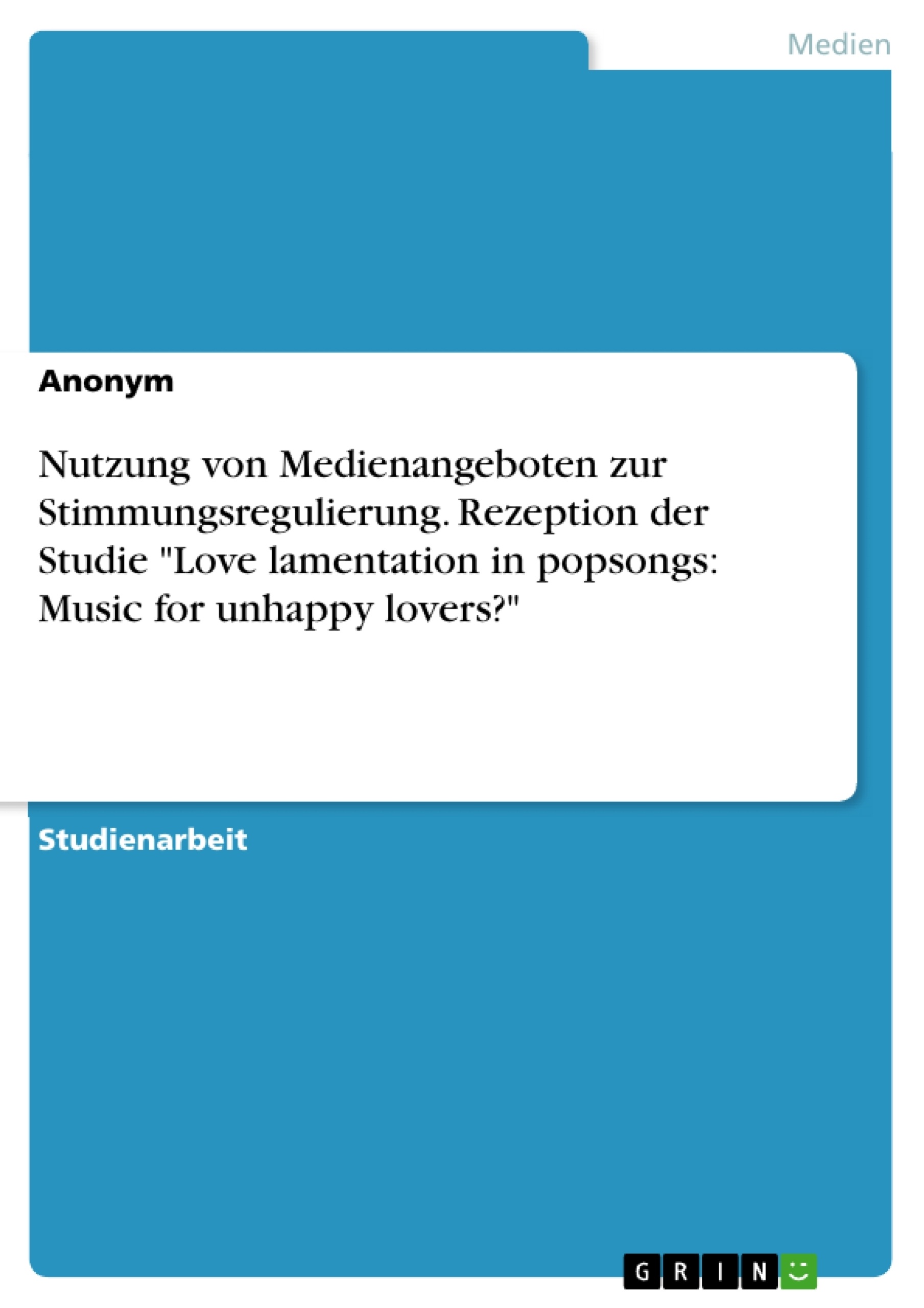Im Fokus steht die Studie „Love-lamentation in popsongs: Music for unhappy lovers?“ von Silvia Knobloch, Kerstin Weisbach und Dolf Zillmann aus dem Jahr 2004. Anhand dieser Studie wird diskutiert, inwieweit Medienangebote, insbesondere Lovesongs, Einfluss auf die Stimmung der Rezipienten nehmen und aus welcher Motivation heraus Selektionsentscheidungen getroffen werden.
Im ersten Kapitel wird näher auf den theoretischen Hintergrund der Rezeptionsforschung eingegangen. Im nächsten Kapitel soll dann der genaue Gegenstand der Mood-Management-Theorie definiert werden. Anschließend werden die Ergebnisse, sowohl der amerikanischen „Love-lamentation“-Studie als auch der deutschen Vergleichsstudie aufgezeigt und einer kritischen Analyse unterzogen. Vor dem Hintergrund der „Love-lamentation“-Studie wird in einem abschließenden Fazit die Anwendungstauglichkeit der Mood-Management-Theorie reflektiert.
Wenn beachtet wird, dass unser Handeln in den meisten Fällen von unserer Stimmung abhängig ist, stellt sich die Frage, inwieweit die Medienangebote zur Stimmungsregulierung beitragen. In welchem Maß beeinflusst die Medienwirkung den Entscheidungsprozess bei der Wahl des Mediums und/oder des Programms?
Musik spielt bei audiovisuellen Medien eine beträchtliche Rolle. Letztendlich entfalten beispielsweise mitreißende Szenen in Filmen erst durch ihre Musik ihre eigentliche Wirkung. Ist es nicht so, dass der Zuschauer bei einem Horror-Szenario oft stumm schaltet, damit die Anspannung nicht so groß ist? Ist es nicht so, dass wir nur aufgrund der Musik schon erahnen können, ob in der nächsten Szene etwas Aufregendes, Lustiges, Unheimliches oder Schönes passieren wird? Dass die Musik eine Wirkung auf den Rezipienten hat, steht außer Frage. Doch inwieweit nimmt hier der Rezipient, wie oftmals angenommen, eine passive Rolle ein? Wenn es zum Beispiel ums Musikhören geht, hat der Rezipient einen Einfluss darauf, welche Musik er hört. Wieso können wir uns beispielsweise einige Lieder immer wieder anhören? Es geht also nicht mehr darum, was die Medien mit uns machen, sondern darum, was wir mit den Medien machen. Denn auch dieser Teil gehört zur Medienwirkungsforschung und lässt sich der Mediennutzung zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Ansätze der Rezeptionsforschung
- Die Mood-Management-Theorie
- Vorgängerstudien
- Studie Love Lamentation in Popsongs
- Zur Studie: Love Lamentation in Popsongs: Music for unhappy Lovers?
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Studie „Love-Lamentation in Popsongs – Music for unhappy Lovers?\" von Silvia Knobloch, Kerstin Weisbach und Dolf Zillmann aus dem Jahr 2004. Ziel ist es zu untersuchen, inwieweit Medienangebote, insbesondere Lovesongs, Einfluss auf die Stimmung der Rezipienten nehmen und aus welcher Motivation heraus Selektionsentscheidungen getroffen werden.
- Die Rolle von Musik in der Stimmungsregulierung
- Die Mood-Management-Theorie und ihre Anwendung auf die Medienrezeption
- Die Ergebnisse der „Love-Lamentation-Studie“ und ihre Bedeutung für die Rezeptionsforschung
- Die Motivationen hinter der Auswahl von Medieninhalten
- Die Rezeption von Musik im Kontext von Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und beleuchtet die Frage, inwieweit Medienangebote zur Stimmungsregulierung beitragen. Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der Rezeptionsforschung, insbesondere mit dem Uses-and-Gratification-Approach und der Mood-Management-Theorie. Kapitel 3 analysiert die Ergebnisse der „Love-Lamentation-Studie“ und zeigt auf, wie Lovesongs die Stimmung der Rezipienten beeinflussen. Das Fazit reflektiert die Anwendungstauglichkeit der Mood-Management-Theorie im Kontext der Studie.
Schlüsselwörter
Mood-Management-Theorie, Medienrezeption, Lovesongs, Stimmungsregulierung, Selektionsentscheidungen, Rezeptionsforschung, Uses-and-Gratification-Approach, „Love-Lamentation-Studie“
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Studie „Love-lamentation in popsongs“?
Die Studie untersucht, warum unglücklich verliebte Menschen oft traurige Liebeslieder hören und wie dies zur Stimmungsregulierung beiträgt.
Was besagt die Mood-Management-Theorie?
Sie besagt, dass Menschen Medieninhalte gezielt auswählen, um negative Stimmungen abzubauen oder positive Stimmungen zu verstärken oder beizubehalten.
Hören unglückliche Menschen nur fröhliche Musik?
Nein, die Studie zeigt, dass oft Musik gewählt wird, die der aktuellen Stimmung entspricht (Mood-Congruency), was paradoxerweise bei der Verarbeitung von Gefühlen helfen kann.
Welche Rolle spielt die Musikwirkung in Filmen?
Musik verstärkt die emotionale Wirkung von Szenen massiv und hilft dem Rezipienten, die Atmosphäre (z.B. Spannung oder Trauer) unmittelbar zu erfassen.
Sind Mediennutzer bei der Stimmungsregulierung passiv?
Im Gegenteil: Der Rezipient nimmt eine aktive Rolle ein, indem er gezielt entscheidet, welches Medium oder Programm er nutzt, um seinen emotionalen Zustand zu beeinflussen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Nutzung von Medienangeboten zur Stimmungsregulierung. Rezeption der Studie "Love lamentation in popsongs: Music for unhappy lovers?", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356584