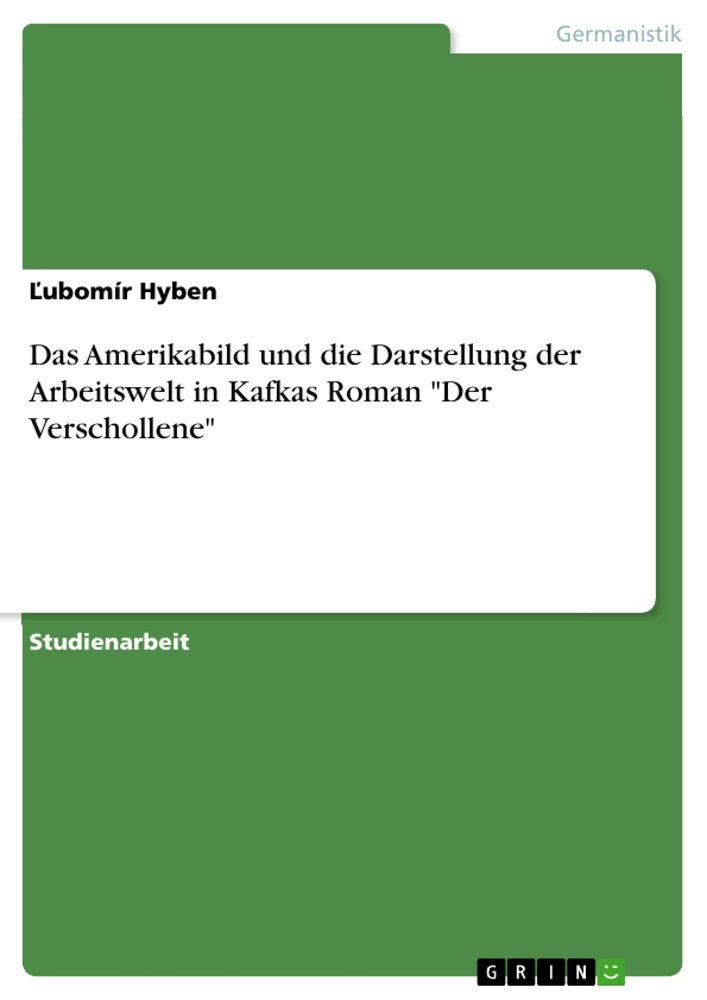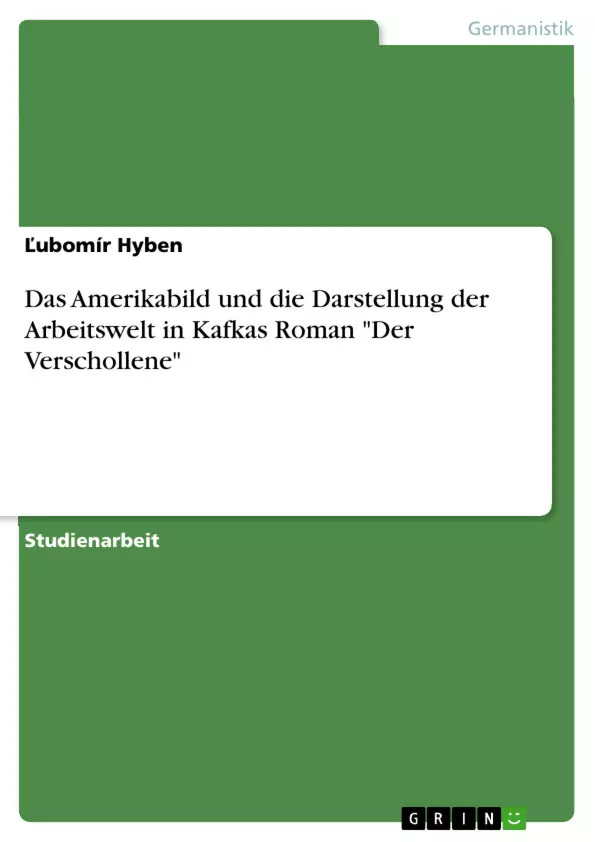Im ersten Teil dieser Arbeit wird auf die Gattungsproblematik eingegangen, indem der Begriff Bildungsroman im Zusammenhang mit Franz Kafkas Roman "Der Verschollene" näher erläutert wird. Hierbei geht es um zwei unterschiedliche Auslegungen des Romans und die damit verbundene Gattungszuordnung, die genauer analysiert werden soll.
Im zweiten Teil der Arbeit wird dann das Bild der Vereinigten Staaten in "Der Verschollene" analysiert. Zudem soll die Darstellung der Arbeitswelt und die mit ihr zusammenhängenden Aspekte, wie ihre Hierarchie, ihre Form und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft im Roman untersucht werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Figuren des Romans und ihr Handeln analysiert. Es soll erläutert werden, wie die amerikanische Gesellschaft im Kontrast zu derjenigen in Europa dargestellt wird, was als positiv oder negativ wahrgenommen wird und welche Aspekte Kafka kritisch beurteilt. Letztendlich soll die Frage beantwortet werden, welche Auswirkungen diese andere Arbeitswelt auf die Figur Karl Rossmanns hat und wie sie zu deuten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Gattungsproblematik
- Amerikabild und Arbeitswelt
- Menschen und Hierarchie
- Technik und Räume
- Onkels Firma
- Hotel Occidental
- Unterschiede zwischen den Arbeitswelten
- Sozialkritik und soziale Verhältnisse
- Gerichtswelt, Tugenden und Werte
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Bild Amerikas in Franz Kafkas unvollendetem Roman „Der Verschollene“. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Arbeitswelt und der Analyse von Motiven, die im Roman vorgeführt werden. Dabei werden zwei unterschiedliche Arbeitswelten, die Speditionsfirma des Onkels und das Hotel Occidental, verglichen. Außerdem werden amerikanische Werte und Tugenden untersucht. Die Arbeit versucht die Frage zu beantworten, wie Kafka mit dem Amerikabild arbeitet und was durch seine Darstellung dem Leser vermittelt werden soll.
- Das Amerikabild in Kafkas „Der Verschollene“
- Die Darstellung der Arbeitswelt in Amerika
- Vergleich verschiedener Arbeitswelten
- Amerikanische Werte und Tugenden
- Kafkas kritische Auseinandersetzung mit der amerikanischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in das Thema der Auswanderung als literarisches Motiv ein und stellt die Relevanz des Themas in verschiedenen Epochen und literarischen Werken dar. Es beleuchtet die Gründe für die Auswanderungswelle aus Europa im 19. Jahrhundert und die Rolle des Mythos Amerika. Der Fokus liegt auf Franz Kafkas Interesse am Thema Amerika, das sich bereits in seinen Tagebüchern zeigt. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: den ersten Teil, der sich mit der Gattungsproblematik und der Interpretation von Kafkas Werk befasst, und den zweiten Teil, der das Amerikabild und die Darstellung der Arbeitswelt in „Der Verschollene“ analysiert.
Die Gattungsproblematik befasst sich mit der Einordnung von Kafkas Werk in die Gattung des Bildungsromans. Es werden verschiedene Interpretationen des Romans und die damit verbundene Gattungszuordnung analysiert, um die Gründe für die jeweilige Zuordnung zu verstehen.
Der zweite Teil der Arbeit analysiert das Bild der Vereinigten Staaten in „Der Verschollene“. Es werden die Arbeitswelt und die mit ihr verbundenen Aspekte untersucht, darunter die Hierarchie, die Form und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Analyse umfasst auch die Figuren und ihr Handeln und untersucht, wie die amerikanische Gesellschaft im Kontrast zu derjenigen in Europa dargestellt wird. Es werden die positiven und negativen Aspekte der amerikanischen Gesellschaft und die kritischen Punkte Kafkas beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie dem Mythos Amerika, der Auswanderung, dem Amerikabild, der Arbeitswelt und der Hierarchie. Sie untersucht Kafkas kritische Auseinandersetzung mit der amerikanischen Gesellschaft und deren Auswirkungen auf die Figur Karl Rossmann.
Häufig gestellte Fragen
Welches Bild von Amerika zeichnet Kafka in "Der Verschollene"?
Kafka stellt Amerika als eine Welt extremer Hierarchien, technischer Übermacht und oft undurchschaubarer sozialer Verhältnisse dar, die im starken Kontrast zum alten Europa stehen.
Kann man Kafkas Roman als "Bildungsroman" bezeichnen?
Die Arbeit untersucht diese Gattungsproblematik kritisch. Während klassische Bildungsromane eine positive Entwicklung zeigen, erlebt die Figur Karl Rossmann oft eine Kette von Rückschlägen und Deplatzierungen.
Wie wird die Arbeitswelt im Roman dargestellt?
Die Arbeitswelt wird durch riesige Räume (wie im Hotel Occidental) und strikte, fast maschinenartige Hierarchien charakterisiert, in denen das Individuum leicht unterzugehen droht.
Welche Rolle spielt die Technik in Kafkas Amerikabild?
Technik wird als faszinierend, aber auch bedrohlich dargestellt. Sie prägt die Räume und den Lebensrhythmus der Menschen und verstärkt das Gefühl der Entfremdung des Protagonisten.
Was kritisiert Kafka an der amerikanischen Gesellschaft?
Kafka beleuchtet kritisch die sozialen Verhältnisse, die harte Gerichtswelt und die Oberflächlichkeit bestimmter Werte und Tugenden, die Karl Rossmann bei seinem Versuch der Integration begegnen.
- Quote paper
- Ľubomír Hyben (Author), 2017, Das Amerikabild und die Darstellung der Arbeitswelt in Kafkas Roman "Der Verschollene", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356586