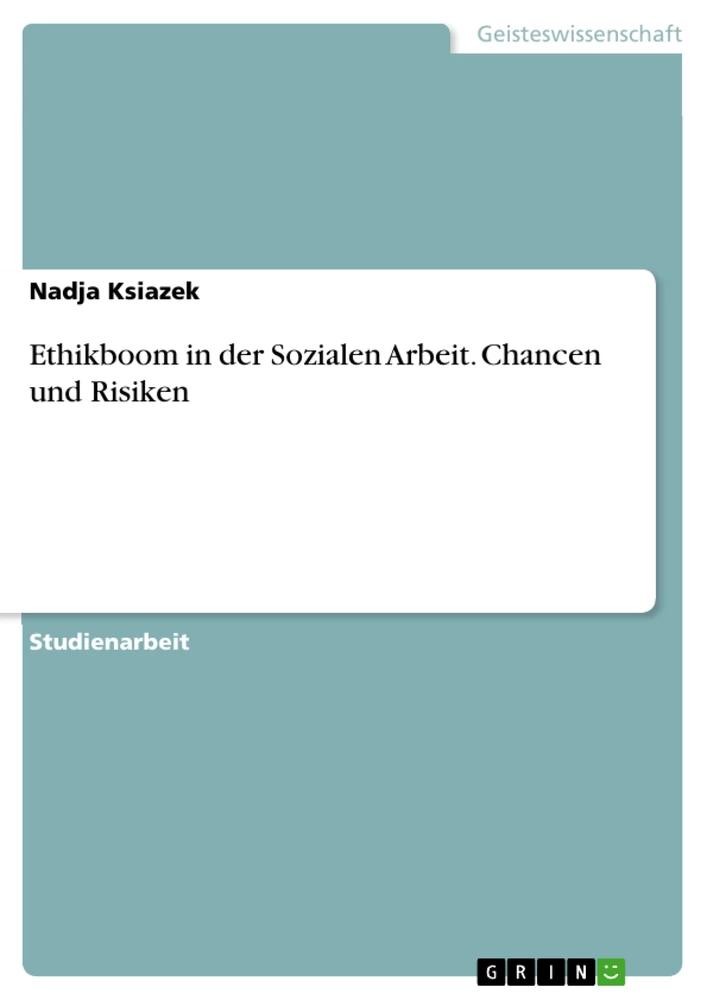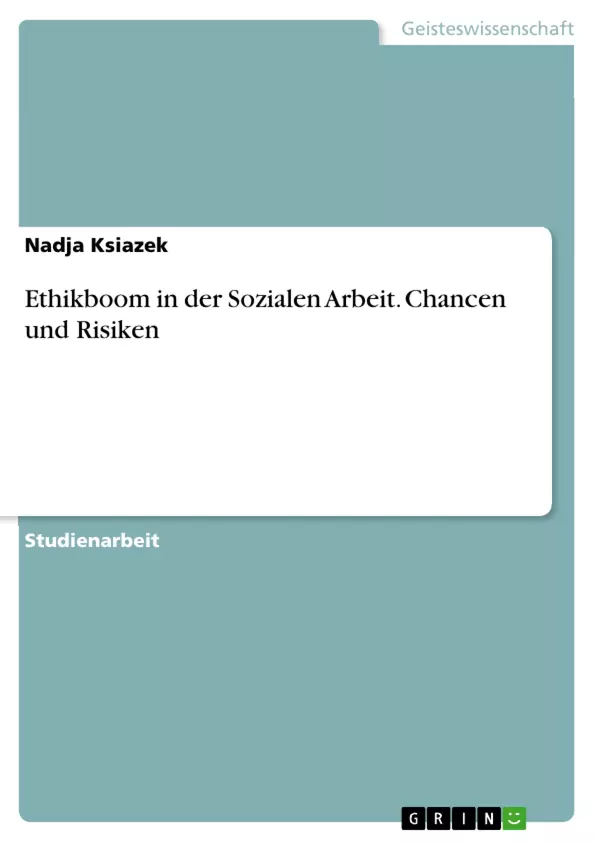Diese Arbeit fragt nach den Chancen und den Konfliktpotentialen durch den Ethikboom in der Sozialen Arbeit, da ethische Fragestellungen nicht nur neue Chancen und Perspektiven ermöglichen, sondern auch ein erhöhtes Risiko innerer Konfliktpotentiale des handelnden Akteurs bedeuten können.
Zunächst geht die Arbeit dafür auf die wesentlichen Begriffe, wie "Ethik", "Moral" und "Sozialpädagogische Berufsethik" ein, um anschließend verschiedene, ausgewählte ethische Ansätze vorzustellen. Ausdrücklich wird im weiteren Verlauf die Entstehung ethischer Konflikte im Zusammenhang mit Gerechtigkeits- und Gleichheitsfragen bemerkt. Die Arbeit soll dabei auch praktisch umsetzbare Handlungsvorschläge liefern, wie ethische Konflikte zu lösen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenbeschreibung
- Begründung der Themenwahl
- Relevanz für die Soziale Arbeit
- Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsdefinitionen
- Ethik
- Moral
- Sozialpädagogische Berufsethik
- (Innerer) Konflikt
- Das Subjekt und seine Vernunft
- Psychoanalytisches Persönlichkeitsmodell nach Freud
- Ethische Positionen
- Diskursethik nach Habermas
- Bedürfnisbezogene Ethik nach Sen und Nussbaum
- Die gewaltfreie Ethik nach Butler
- Praktische Ethik in der Sozialen Arbeit
- Chancen
- Innere Konfliktpotentiale
- Rangordnung ethischer Handlungsprinzipien
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Ethik in der Sozialen Arbeit und die Herausforderungen, die sich aus dem heutigen Ethikboom ergeben. Sie analysiert, wie ethische Reflexionen die Praxis der Sozialen Arbeit bereichern können, aber auch zu inneren Konflikten führen können.
- Die Bedeutung von Ethik und Moral in der Sozialen Arbeit
- Die Herausforderungen des Ethikbooms in der Sozialen Arbeit
- Die ethischen Positionen verschiedener Denker
- Die Auswirkungen von ethischen Konflikten auf die Praxis der Sozialen Arbeit
- Mögliche Handlungsvorschläge zur Bewältigung ethischer Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Ethik in der Sozialen Arbeit ein und erläutert die Relevanz der ethischen Reflexion für die Praxis. Die theoretischen Grundlagen beleuchten die Begriffsbestimmungen von Ethik, Moral und sozialpädagogischer Berufsethik sowie das Subjekt und seine Vernunft im Kontext ethischer Entscheidungsfindung. Die praktische Ethik in der Sozialen Arbeit untersucht die Chancen und Konfliktpotentiale des Ethikbooms und beleuchtet die Rangordnung ethischer Handlungsprinzipien. Die Diskussion analysiert die Fragestellung der Arbeit, ob Chancen oder innere Konfliktpotentiale durch den heutigen Ethikboom in der Sozialen Arbeit überwiegen.
Schlüsselwörter
Ethik, Moral, Sozialpädagogische Berufsethik, ethische Konflikte, Handlungsprinzipien, Diskursethik, Bedürfnisbezogene Ethik, Gewaltfreie Ethik, Soziale Arbeit, Handlungswissenschaft, Trippelmandat, Burnout, Gerechtigkeit, Gleichheit, Selbstbestimmung, Verantwortungsübernahme, Entscheidungsfähigkeit, Kreativität, Personalisation
- Arbeit zitieren
- Nadja Ksiazek (Autor:in), 2017, Ethikboom in der Sozialen Arbeit. Chancen und Risiken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356650