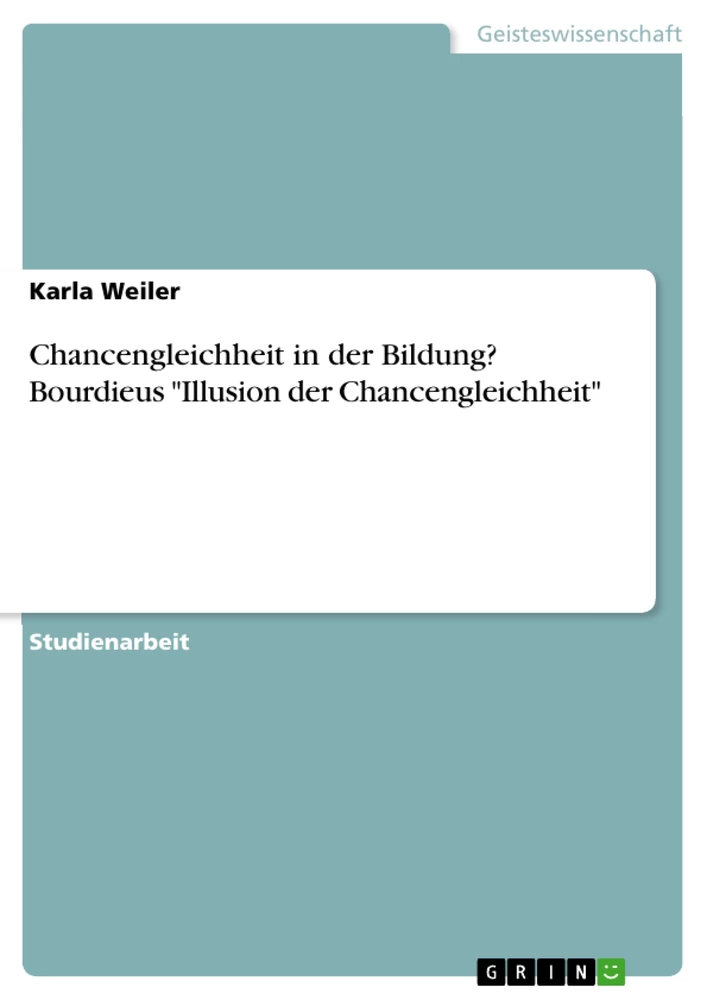In der Arbeit werden die theoretischen Annahmen Bourdieus zum Thema Chancengleichheit in der Bildung betrachtet. Es wird versucht, anhand der wichtigsten Forschungsergebnisse aufzuzeigen, wie Chancenungleichheiten im Bildungssystem entstehen.
Zunächst werden die zentralen, kulturtheoretischen Konzepte von Bourdieus Theorie, wie Habitus, Kapital und Feld, vorgestellt. Danach werden Erklärungsversuche für die Chancenungleichheit, basierend auf Bourdieus Konzept der kulturellen Reproduktion und seiner Illusion der Chancengleichheit, dargestellt. Zuletzt wird anhand der PISA-Studie 2001 der Zusammenhang von Bildungschancen und sozialer Herkunft fokussiert und überprüft, ob Bourdieus Ansatz für eine plausible Erklärung der Bildungsungleichheiten herangezogen werden konnte. Abschließend wird dann festgehalten, wie Chancenungleichheiten entstehen und mit Bourdieu begründet werden können und was Gegenstand einer an Bourdieu angelehnten lösungsorientierten Forschung sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bourdieus Theorie sozialer Ungleichheit - zentrale Aspekte
- Habitus
- Soziale Felder
- Kapital
- Illusion der Chancengleichheit
- Bildungsexpansion
- Chancengleichheit - Chancenungleichheit
- Kulturelle Passung
- PISA Studien und Bezüge zu Bourdieu
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage der Chancengleichheit im Bildungssystem und untersucht, wie Pierre Bourdieus Theorie der sozialen Ungleichheit diese Thematik beleuchtet. Ziel ist es, die zentralen Konzepte von Bourdieus Theorie, wie Habitus, Kapital und Feld, zu erläutern und anhand dieser zu erklären, wie Chancenungleichheiten im Bildungssystem entstehen. Die Arbeit analysiert die Illusion der Chancengleichheit und die Rolle der kulturellen Reproduktion in diesem Kontext. Außerdem wird der Zusammenhang von Bildungschancen und sozialer Herkunft anhand der PISA-Studie 2001 beleuchtet.
- Chancengleichheit im Bildungssystem
- Bourdieus Theorie der sozialen Ungleichheit
- Habitus, Kapital und Feld
- Kulturelle Reproduktion und Illusion der Chancengleichheit
- Zusammenhang von Bildungschancen und sozialer Herkunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Chancengleichheit im Bildungssystem ein und stellt die Relevanz von Bourdieus Theorie in diesem Kontext heraus. Das zweite Kapitel erläutert die zentralen Konzepte von Bourdieus Theorie, wie Habitus, Kapital und Feld, und zeigt, wie diese die soziale Ungleichheit erklären. Das dritte Kapitel beleuchtet die Illusion der Chancengleichheit, die durch die Bildungsexpansion entsteht, und analysiert die Mechanismen der kulturellen Reproduktion. Das vierte Kapitel untersucht den Zusammenhang von Bildungschancen und sozialer Herkunft anhand der PISA-Studie 2001 und beleuchtet die Relevanz von Bourdieus Theorie für die Erklärung von Bildungsungleichheiten.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungssystem, soziale Ungleichheit, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapital, Feld, kulturelle Reproduktion, Illusion der Chancengleichheit, PISA-Studie, Bildungsungleichheiten.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Bourdieu mit der „Illusion der Chancengleichheit“?
Bourdieu argumentiert, dass das Bildungssystem zwar formal allen offen steht, aber durch die Bevorzugung bestimmter kultureller Merkmale die bestehende soziale Ungleichheit lediglich reproduziert.
Was ist das „kulturelle Kapital“?
Es umfasst Wissen, Bildungstitel, aber auch kulturelle Güter und Verhaltensweisen, die in der Familie erworben werden und den Erfolg im Schulsystem maßgeblich bestimmen.
Was bedeutet der Begriff „Habitus“ bei Bourdieu?
Der Habitus ist das System von Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern eines Menschen, das durch seine soziale Herkunft geprägt ist und bestimmt, wie er sich in sozialen Feldern bewegt.
Wie hängen PISA-Studien und Bourdieus Theorien zusammen?
Die PISA-Ergebnisse bestätigen Bourdieus Ansatz, indem sie zeigen, dass in Deutschland der Bildungserfolg extrem stark von der sozialen Herkunft und dem familiären Kapital abhängt.
Was ist „kulturelle Passung“ im Schulsystem?
Schulen fordern oft einen Habitus und ein kulturelles Kapital ein, das dem des Bildungsbürgertums entspricht. Kinder aus anderen Schichten erleben daher eine mangelnde Passung und scheitern häufiger.
- Arbeit zitieren
- Karla Weiler (Autor:in), 2014, Chancengleichheit in der Bildung? Bourdieus "Illusion der Chancengleichheit", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356688