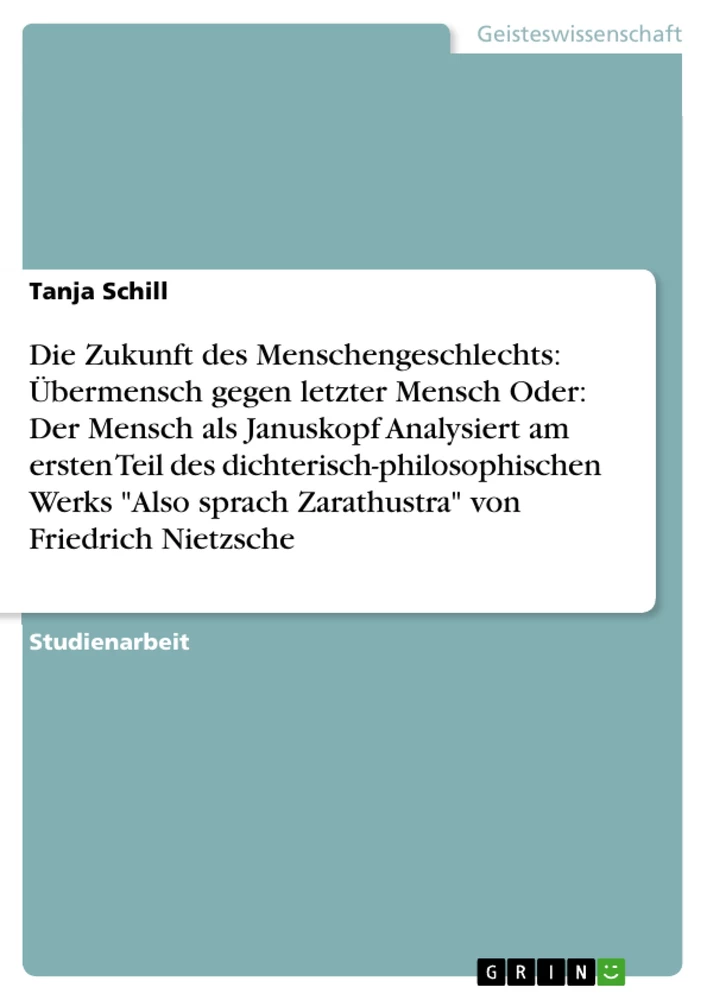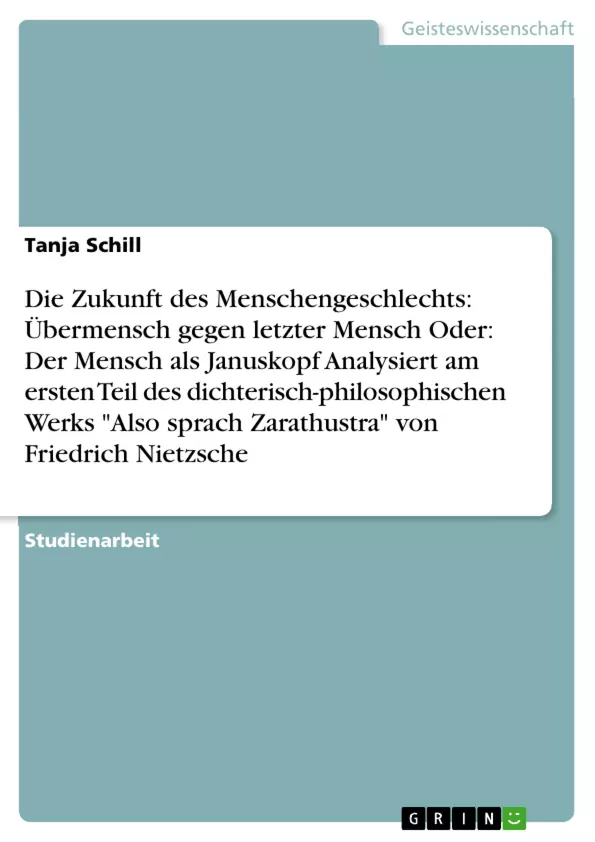Friedrich Nietzsches weltbekanntes und äußerst tiefgründiges dichterisch-philosophisches Werk „Also sprach Zarathustra“ stellt für den Rezipienten eine Herausforderung dar, sich unter anderem gezielt mit den Begriffen Übermensch und letzter Mensch auseinanderzusetzen. Diese beiden Themenkomplexe stellen die Hauptkomponenten dieser Arbeit dar. Nach einer allgemeinen Einführung sollen diese beiden facettenreichen Begriffe zuerst einzeln zerlegt und detailliert analysiert werden, um sie dann in einen größeren Kontext einzubetten und sie als Teil des Ganzen – als Teil von Zarathustras Zukunftsvorstellungen – betrachten zu können. Ziel dieser Interpretation ist es, das Gegensatzpaar Übermensch und letzter Mensch mittels direkten Textbezugs näher zu definieren und dessen möglichen tieferen Sinn offenzulegen. Wichtig anzumerken ist, dass fast ausschließlich am bloßen Text gearbeitet wird, ohne den direkten Einbezug des Autors, etwaiger Parallelitäten zu anderen Werken oder gar zu Teilen der Weltgeschichte wie der Antike. Es geht in erster Linie darum, so textintern und -nahe wie möglich zu arbeiten und nicht darum, so viele versteckte Symbole und Ähnlichkeiten zu Textexternem wie möglich zu finden.
Über die Methodik der Analyse ist zu sagen, dass sie auf der des Sinnverstehens, der Hermeneutik beruht. Es geht vorrangig darum, den Text nicht mehr als reinen Text zu betrachten. Nach den einzelnen Analysen der beiden zentralen Themen werden diese dann in einem zweiten Schritt mittels abschließender Synthese zu einem Ganzen zusammengeführt.
Obwohl die beiden zu behandelnden Themen bereits unzählige Male interpretiert wurden, üben sie eine hohe Faszinationskraft aus. Sie bieten zwar viele unterschiedliche und auf den ersten Blick auch einleuchtende Lektüremöglichkeiten an, hinterlassen jedoch trotzdem den Eindruck, als würden sich ihre Kernaussagen (so es sie gibt) lediglich hinter ihnen verbergen, sodass die Grundgedanken noch nie vollends in Erscheinung treten konnten. Das weckt Interesse an weiteren Untersuchungen. Da es sich bei „Also sprach Zarathustra“ um eine literarische Konstruktion handelt, also ein rein fiktives Bild kreiert wird, sind die Interpretationsmöglichkeiten in ihrer Anzahl fast unbegrenzt. So stellt die Arbeit nur einen Interpretationsversuch, nur eine von vielen möglichen Anschauungsweisen dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Einführung in die Themen Übermensch, Mensch und letzter Mensch - ein grober Umriss der, Vorrede Zarathustras.
- Analysen zum Übermenschen und letzten Menschen..
- Der Übermensch - ,,der ist dieser Blitz, der ist dieser Wahnsinn! —“.
- Der letzte Mensch - ,'Wir haben das Glück erfunden' – sagen die letzten Menschen und blinzeln. —“.
- Versuch einer Synthese - (Wie) Lassen sich Übermensch und letzter Mensch vereinen?.
- Zusammenfassung und Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Konzepte des Übermenschen und des letzten Menschen im ersten Teil von Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“. Ziel ist es, diese beiden facettenreichen Begriffe im Kontext der Zukunftsvorstellungen Zarathustras zu definieren und ihren tieferen Sinn zu ergründen.
- Die Entstehung des Übermenschen aus dem Tod Gottes.
- Die Rolle des Menschen als Brücke zwischen Tier und Übermensch.
- Die Kritik an der vermeintlichen Glückseligkeit des letzten Menschen.
- Die Bedeutung der Willenskraft und Selbstüberwindung für die Menschheitsentwicklung.
- Die Vision einer neuen, übermenschlichen Zukunft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Herausforderungen, die sich aus der Auseinandersetzung mit den Begriffen Übermensch und letzter Mensch ergeben. Sie erläutert die Herangehensweise der Arbeit und betont die Bedeutung des Textbezugs.
Der Hauptteil beginnt mit einer Einführung in die Themen Übermensch, Mensch und letzter Mensch im Kontext der „Vorrede Zarathustras“. Es werden die zentralen Aussagen Zarathustras zur Entstehung des Übermenschen, zur Rolle des Menschen als Übergangswesen und zur Kritik am letzten Menschen dargestellt.
Im Folgenden werden der Übermensch und der letzte Mensch in separaten Kapiteln analysiert. Es werden die zentralen Merkmale beider Konzepte herausgearbeitet und ihre Bedeutung im Kontext der Zukunftsvorstellungen Zarathustras erläutert.
Abschließend wird versucht, die beiden Konzepte in einer Synthese zusammenzuführen. Es wird erörtert, wie sich Übermensch und letzter Mensch als Teile eines größeren Ganzen verstehen lassen.
Schlüsselwörter
Übermensch, letzter Mensch, „Also sprach Zarathustra“, Friedrich Nietzsche, Zukunftsvorstellungen, Willenskraft, Selbstüberwindung, Tod Gottes, Menschheitsentwicklung, Philosophie, Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Begriffe in Nietzsches „Also sprach Zarathustra“?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Gegensatzpaar „Übermensch“ und „letzter Mensch“ sowie auf die Rolle des Menschen als Übergangswesen.
Wie definiert Nietzsche den „letzten Menschen“?
Der letzte Mensch steht für eine stagnierende Menschheit, die das „Glück erfunden“ hat, aber keine schöpferische Kraft oder Selbstüberwindung mehr besitzt.
Welche Rolle spielt der „Tod Gottes“ für den Übermenschen?
Die Arbeit analysiert, wie die Entstehung des Übermenschen als notwendige Konsequenz aus dem Tod Gottes und dem damit verbundenen Ende alter Werte hervorgeht.
Welche Methodik wird in dieser philosophischen Analyse angewandt?
Die Analyse basiert auf der Hermeneutik (dem Sinnverstehen) und arbeitet streng textnah am ersten Teil des Werkes, ohne externe historische Bezüge einzubeziehen.
Was ist das Ziel der Synthese am Ende der Arbeit?
Die Synthese versucht zu klären, ob und wie sich die gegensätzlichen Konzepte des Übermenschen und des letzten Menschen als Teile von Zarathustras Zukunftsvision vereinen lassen.
- Quote paper
- Tanja Schill (Author), 2016, Die Zukunft des Menschengeschlechts: Übermensch gegen letzter Mensch Oder: Der Mensch als Januskopf Analysiert am ersten Teil des dichterisch-philosophischen Werks "Also sprach Zarathustra" von Friedrich Nietzsche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356746