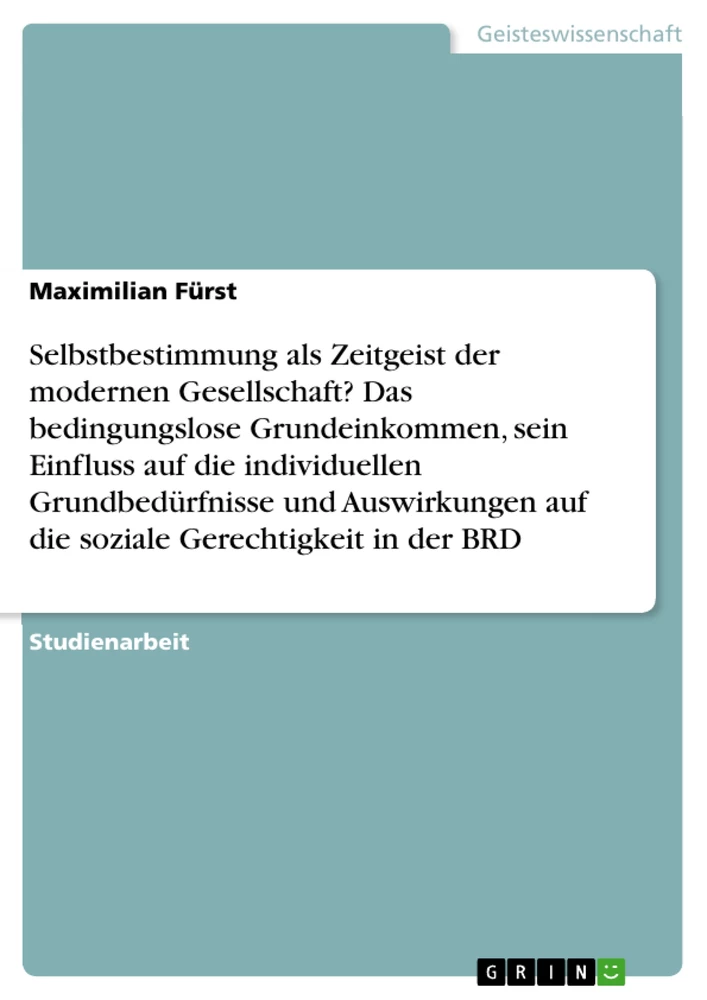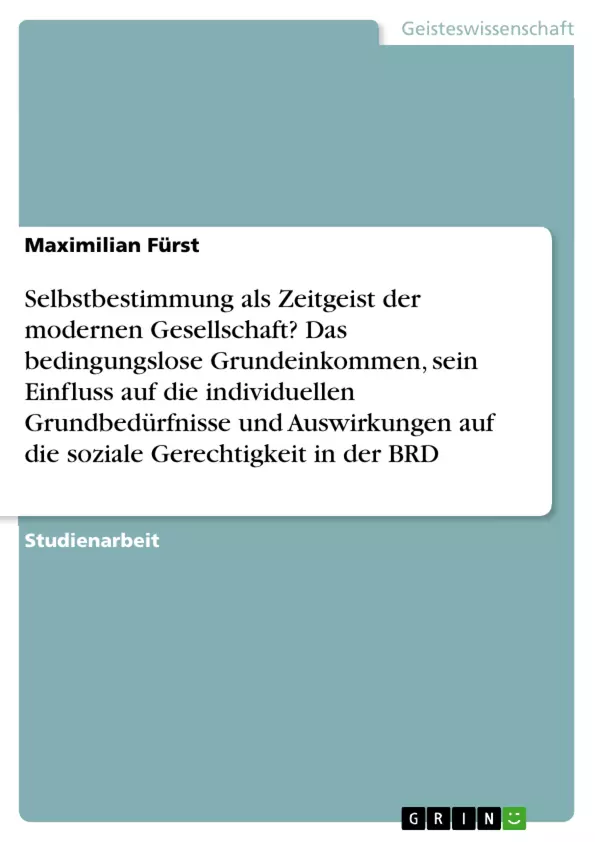Dieser Arbeit liegt die Fragestellung zu Grunde, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen unser Verständnis für die Grundbedürfnisse des Individuums in der BRD und dessen Auswirkungen auf die soziale Gerechtigkeit beeinflussen würde.
Dafür ist es unabdingbar, als erstes die Bedürfnisse eines Bürgers der BRD zu bestimmen. Diese Bedürfnisse richten sich nach ganzheitlichen Vorstellungen eines menschenwürdigen Lebens und umschließen daher nicht nur den Minimalbedarf der Existenz. Im nächsten Teil (3. Status Quo) soll die derzeitige Situation mit ihren Vor- und Nachteilen beleuchten werden. Des Weiteren stellt dieser auch eine andere Meinung zum Thema der Bedürfnisse des Menschen dar. Anschließend wird eine Theorie von Gerechtigkeit erläutert, auf die sich auch ein BGE beziehen könnte. Das BGE und seine Gerechtigkeitsvorstellungen wird im fünften Teil als Alternative vorgestellt. Das Fazit soll von den überwiegenden positiven Seiten des BGE überzeugen und die sich zuspitzenden Schwachstellen unseres jetzigen Systems zusammenfassen. Diese Ausführungen sollen dabei nicht übersehen, wie schwierig die derzeitige Umsetzbarkeit eines solchen Systems erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedürfnisse nach Maslow
- Status Quo
- Gerechtigkeit nach Rawls
- Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE)
- Das BGE-Definition
- Das BGE bewertet nach Maslow und Rawls
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf das Verständnis der Grundbedürfnisse des Individuums in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und dessen Folgen für die soziale Gerechtigkeit.
- Die Bedürfnisse des Menschen und deren Hierarchie nach Maslow
- Der aktuelle Stand der sozialen Gerechtigkeit in der BRD
- Die Theorie der Gerechtigkeit nach Rawls
- Das BGE als Alternative zur bestehenden Sozialstruktur
- Potenzielle Auswirkungen des BGE auf die Grundbedürfnisse und die soziale Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um das BGE in verschiedenen Ländern vor und führt die Fragestellung der Arbeit ein. Kapitel 2 beleuchtet die Bedürfnispyramide von Maslow und erläutert die hierarchische Anordnung der menschlichen Bedürfnisse. Kapitel 3 analysiert den Status Quo der sozialen Gerechtigkeit in der BRD und diskutiert die Vor- und Nachteile des bestehenden Systems. Kapitel 4 stellt die Theorie der Gerechtigkeit nach Rawls vor und analysiert die Grundprinzipien seiner Gerechtigkeitsvorstellungen. Kapitel 5 widmet sich dem BGE, definiert den Begriff und bewertet das Konzept anhand der Theorien von Maslow und Rawls.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Grundbedürfnisse, Soziale Gerechtigkeit, Maslow, Rawls, Bedürfnispyramide, Status Quo, BRD, Sozialstaat, Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Startchancengerechtigkeit, Existenzminimum, Arbeitsmarkt, Automatisierung, Individualismus, Freiheit, Kritik, Zukunft
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst ein BGE das Verständnis von Grundbedürfnissen?
Die Arbeit untersucht, wie ein BGE über das bloße Existenzminimum hinaus ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und die individuelle Selbstbestimmung fördern kann.
Welche Rolle spielt die Bedürfnispyramide nach Maslow?
Maslows Theorie dient als Grundlage, um zu bewerten, wie ein BGE sowohl physiologische Grundbedürfnisse als auch höhere Bedürfnisse wie Sicherheit und Selbstverwirklichung absichert.
Was besagt die Gerechtigkeitstheorie von Rawls im Kontext des BGE?
Rawls' Theorie wird herangezogen, um zu prüfen, ob ein BGE zur sozialen Gerechtigkeit beiträgt, indem es insbesondere die Situation der am wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft verbessert.
Was sind die Hauptkritikpunkte an der Umsetzung eines BGE?
Die Arbeit diskutiert die schwierige finanzielle Umsetzbarkeit und die möglichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie die traditionelle Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit.
Welche Vorteile bietet das BGE gegenüber dem aktuellen System?
Es wird argumentiert, dass ein BGE bürokratische Hürden abbaut, die Startchancengerechtigkeit erhöht und Individuen mehr Freiheit in einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt bietet.
- Quote paper
- Maximilian Fürst (Author), 2016, Selbstbestimmung als Zeitgeist der modernen Gesellschaft? Das bedingungslose Grundeinkommen, sein Einfluss auf die individuellen Grundbedürfnisse und Auswirkungen auf die soziale Gerechtigkeit in der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356794