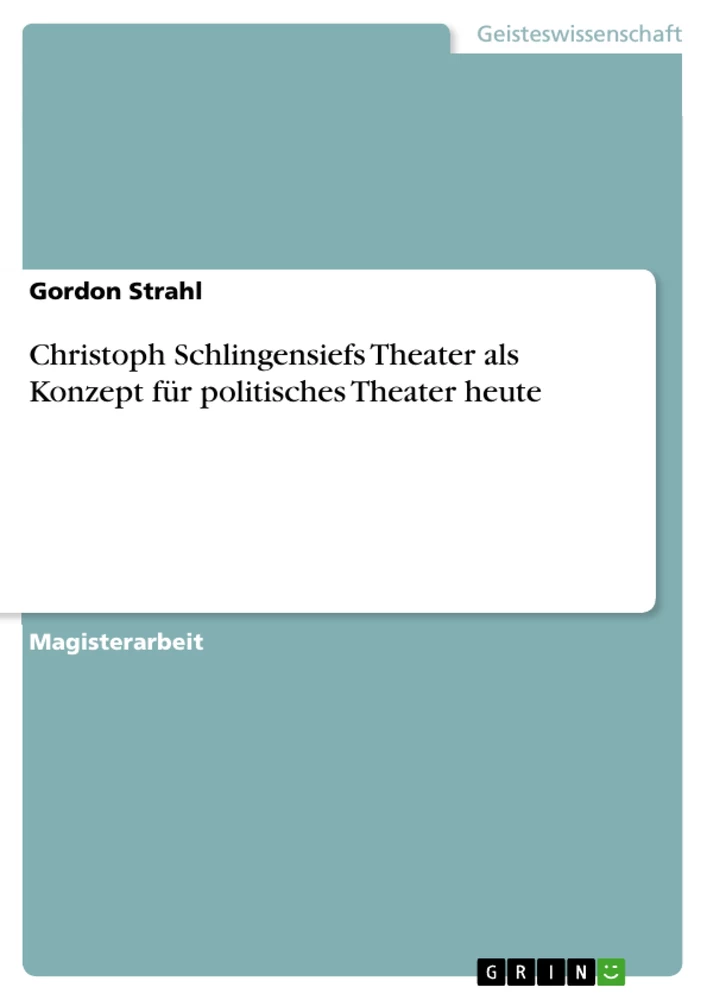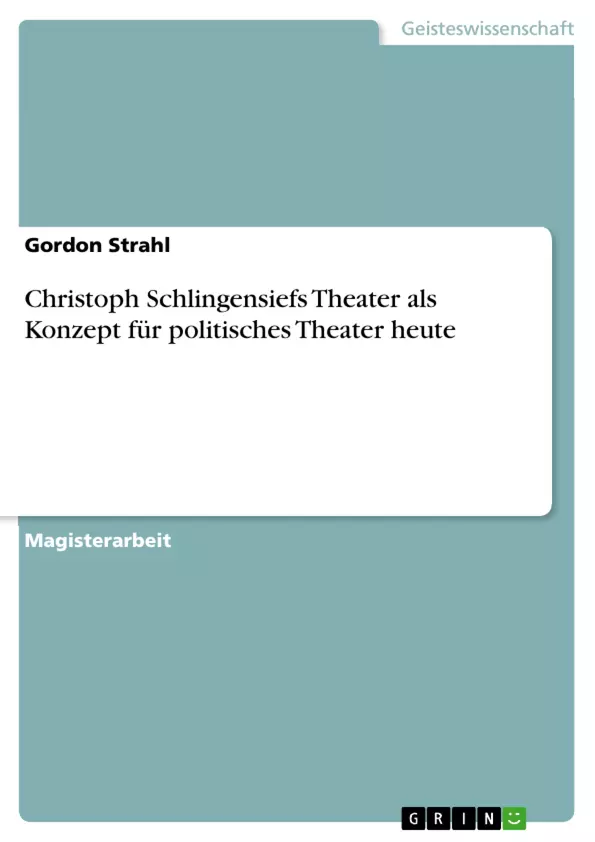„Theater muss politischer werden.“ Diese Forderung stellte der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog während seiner Amtszeit. Der Kritiker, ehemalige Anwalt und Mitglied des Schlingensief-Ensembles Dietrich Kuhlbrodt formulierte diese Forderung für das Parteiprogramm der Schlingensief’schen Kunst-Partei Chance 2000 einfach um in: „Die Politik muss theatraler werden.“ Auch wenn Soziologen, sich auf Erving Goffman berufend, behaupten, dies sei schon längst geschehen, denn jeder Mensch fungiere als Schauspieler, und insbesondere Politiker setzten sich in Szene. Dies ist eine Behauptung, die heute tagtäglich in Nachrichten oder Zeitungen auftauchen kann, ohne einen Aufschrei der Bevölkerung auszulösen. Der Film- und Theaterregisseur Christoph Schlingensief jedoch scheint diesem Phänomen auf den Grund gehen zu wollen. Er greift die Idee auf und nimmt sie wörtlich, gründet zur Bundestagswahl 1998 mit Chance 2000 eine real wählbare Partei, bestehend aus Schauspielern, Künstlern, Arbeitslosen, Behinderten und allen, die Lust haben, mitzuwirken.
Nach einer zusammenfassenden Darstellung der frühen Theaterarbeiten Christoph Schlingensiefs beschreibe ich drei seiner Projekte: Chance 2000, Ausländer raus – Bitte liebt Österreich, Hamlet. Ich lege den Focus auf genau diese Projekte, weil sie einen unmittelbaren Bezug zu politischen Thematiken haben. Dabei wird jeweils die Vermengung der Kunst- und Realitätsebene von besonderer Bedeutung sein. Wie und vor allem zu welchem Zweck inszeniert Schlingensief das Publikum, wie wird der Rezipient zum Darsteller? Auch die Frage, wie und weshalb Schlingensief die mediale Berichterstattung mit einbezieht, darf bei den drei Beispielen nicht unbeachtet bleiben. Denn die große Medienpräsenz, die Schlingensiefs Aktionen auch außerhalb des Feuilletons zuteil wird, trägt sicherlich dazu bei, dass der Journalist Georg Diez behaupten kann, Schlingensief schaffe es, dem Theater das zu geben, „was ihm fast vollständig abhanden gekommen ist: gesellschaftliche Relevanz“3. Abschließend möchte ich untersuchen, wie ihm genau dieses gelingt: Der Kunst eine gesellschaftlich wichtige Position zurückzugeben. Dazu werde ich Schlingensiefs Theaterkonzept den traditionellen Formen des Politischen Theaters gegenüberstellen und darlegen, warum Piscator und Boal für uns bestenfalls museale Qualitäten haben, während Schlingensiefs Aktionen ein tragfähiges Gerüst für Politisches Theater in unserer heutigen Zeit bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politisches Theater
- EPISCHES THEATER
- UNSICHTBARES THEATER
- KUNST UND LEBEN
- Wagners Gesamtkunstwerk
- Beuys Soziale Plastik
- POLITIK ALS INSZENIERUNG
- Das Theater um Christoph Schlingensief
- LEBEN TRIFFT AUF THEATER: 100 JAHRE CDU
- DIE SCHLINGENSIEF-FAMILIE
- ZUSCHAUER WIRD DARSTELLER. ROCKY DUTSCHKE '68
- DER MENSCH ALS MATERIAL: MEIN FILZ, MEIN FETT, MEIN HASE
- VERLASSEN DES KUNST-RAUMS: PASSION IMPOSSIBLE
- Chance 2000
- DIE VERMENGUNG VON KUNST UND POLITIK
- Inszenierung des Publikums
- Uminszenierung des Alltags
- Inszenierung der Medien
- CHANCE 2000 ALS POLITISCHES THEATER
- Ausländer raus - Bitte liebt Österreich
- BIG BROTHER UND DIE INSZENIERUNG VON REALITY-TV
- INSZENIERUNG VON REALITÄT IN SCHLINGENSIEFS „BITTE LIEBT ÖSTERREICH“
- Das Leben als Theater
- Zuschauer als Darsteller/Darsteller als Zuschauer
- Inszenierung in den Medien
- Politiker sind Schauspieler
- BITTE LIEBT ÖSTERREICH: POLITISCHES THEATER?
- Hamlet
- INSZENIERUNGS-EBENEN
- Fiktionale Ebene
- Fiktions-Realitätsebene
- Realitätsebene
- HAMLET: POLITISCHES THEATER?
- Schlingensiefs Theater als neue Form von politischem Theater
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Theater, das sich dem Einnehmen einer politischen Position verweigert, sich überhaupt politisch nennen kann. Sie untersucht den Theatermacher Christoph Schlingensief und seine Inszenierungen, die eine klare Abkehr vom traditionellen Politischen Theater darstellen. Der Text analysiert, wie Schlingensiefs Theaterkonzepte die Vermengung von Kunst und Realitätsebene in den Vordergrund stellen und das Publikum aktiv in das Geschehen einbeziehen.
- Schlingensiefs Auseinandersetzung mit dem Politischen Theater
- Die Vermengung von Kunst und Realität in Schlingensiefs Arbeiten
- Die Rolle des Publikums in Schlingensiefs Inszenierungen
- Die Bedeutung der medialen Berichterstattung für Schlingensiefs Theater
- Schlingensiefs Beitrag zur gesellschaftlichen Relevanz des Theaters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Schlingensiefs Theater eine neue Form von politischem Theater darstellt. Das zweite Kapitel behandelt das traditionelle Politische Theater und die Entwicklungen von Epischem und Unsichtbarem Theater. Es werden auch die Konzepte von Wagners Gesamtkunstwerk und Beuys' Sozialer Plastik vorgestellt, die die Verbindung von Kunst und Leben in den Vordergrund stellen.
Das dritte Kapitel beschreibt Schlingensiefs frühe Theaterarbeiten und analysiert seine Projekte Chance 2000, Ausländer raus - Bitte liebt Österreich und Hamlet. Der Fokus liegt auf der Vermengung von Kunst und Realitätsebene in diesen Arbeiten und der Rolle des Publikums als Darsteller.
Das vierte Kapitel untersucht, wie Schlingensiefs Theater dem traditionellen Politischen Theater gegenübergestellt werden kann und welche Bedeutung ihm für die gesellschaftliche Relevanz des Theaters zukommt.
Schlüsselwörter
Politisches Theater, Christoph Schlingensief, Kunst, Realität, Inszenierung, Publikum, Medien, gesellschaftliche Relevanz, Erwin Piscator, Berthold Brecht, Augusto Boal, Richard Wagner, Joseph Beuys, Chance 2000, Ausländer raus - Bitte liebt Österreich, Hamlet.
- Quote paper
- Gordon Strahl (Author), 2004, Christoph Schlingensiefs Theater als Konzept für politisches Theater heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35690