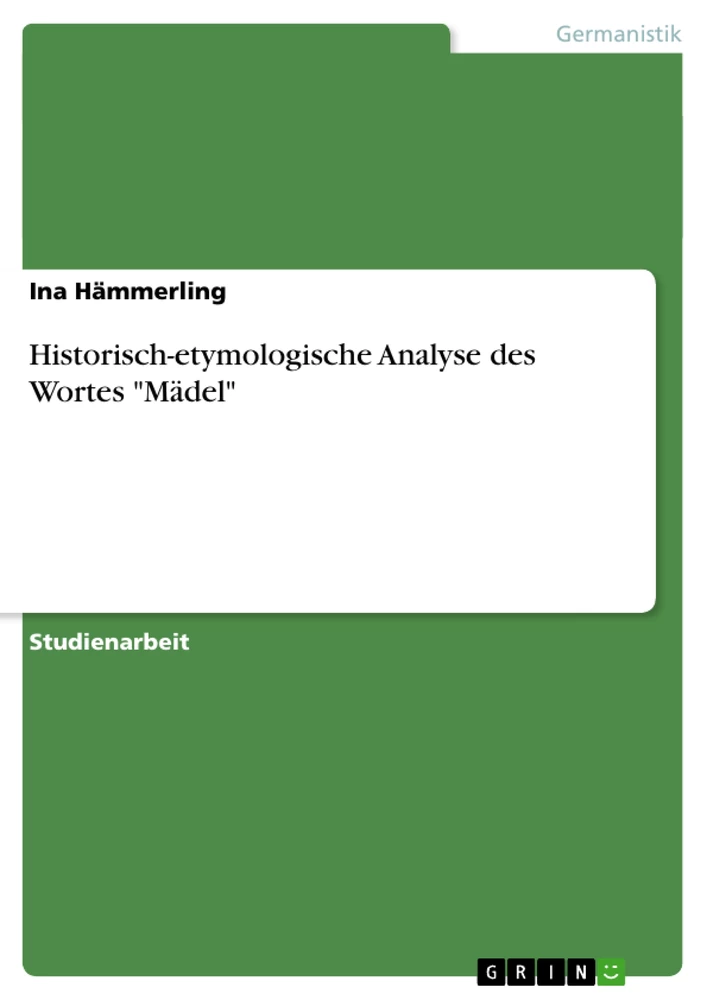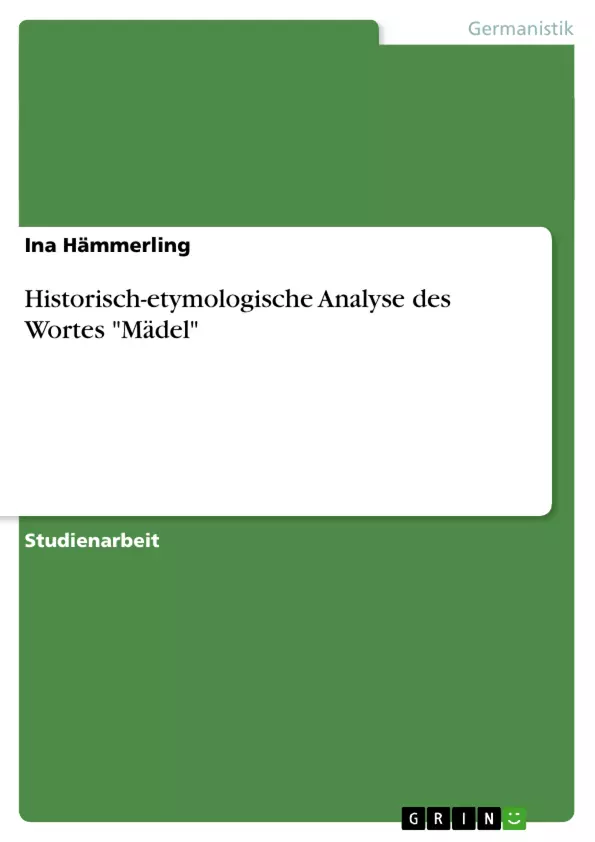Etymologie und Sprachgeschichte stellen einen wichtigen Teil der Sprachwissenschaft dar. Da sie sich mit der Herkunft von Wörtern, deren verschiedenartigen Bedeutungen beschäftigen und zudem verwandte Wörter und Wortbildungen erforschen, bieten sie die Möglichkeit Veränderungen der Wörter bis hin zu ihrer Entstehung zurückverfolgen zu können.
Inwiefern sich ein Wort im Laufe der Jahrhunderte verändern kann, unter anderem in seiner Lautung und Schreibung, soll hier am Beispiel des Wortes Mädel genauer erläutert werden. Zunächst wird also auf den Gebrauch, das System und das Diasystem, mit Schwerpunkt auf dem auftauchenden Pluralproblem, in der Gegenwartssprache eingegangen. Anschließend wird mit Blick auf den Lautwandel, die Entstehung des Wortes Mädel geklärt und anhand von ersten Erwähnungen belegt. Wichtig ist hierbei vor allen Dingen, in welcher Zeit die erste Erwähnung des Wortes Mädel stattfand, da somit fest gestellt werden kann, wie alt es bereits ist. Obwohl Lautung und Schreibung Teil der Grammatik sind, stellen sie hier ein eigenes Kapitel dar, da besonders die Grapheme und Morpheme in den jeweiligen Epochen eine große Rolle spielen. Abschließend werden die unterschiedlichen Bedeutungen und die Verwendung des Wortes Mädel anhand von Textauszügen belegt und abschließend noch genauer erläutert. Der Schwerpunkt soll hier in der Bedeutungsgeschichte des Wortes Mädel liegen, mit speziellem Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus und der Bezeichnung: „Bund Deutscher Mädel“. Ein abschließendes Resümee soll eine kurze Wiederholung und Zusammenfassung geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heutiger Gebrauch
- System und Wortbildung
- Diasystem und Pluralproblem in regionalen Sprachvarianten
- Verwandte Wortformen
- Ursprung des Wortes Mädel
- Erste Erwähnungen
- Entlehnung und Lautwandel
- Bedeutungsgeschichte und Inhalt
- Verwendung vom Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen
- Verwendung im Nationalsozialismus
- Verwendung vom Neuhochdeutschen bis zur Gegenwart
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Wortes "Mädel". Ziel ist es, die Veränderungen in Lautung, Schreibung und Bedeutung des Wortes vom Althochdeutschen bis zur Gegenwart nachzuvollziehen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Pluralproblem und der Verwendung des Wortes im Nationalsozialismus.
- Etymologische Entwicklung des Wortes "Mädel"
- Bedeutungsänderungen im Laufe der Zeit
- Regionale Variationen und das Pluralproblem
- Wortbildung und verwandte Wörter
- Verwendung des Wortes im historischen Kontext, insbesondere im Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung der Etymologiestudie für die Sprachwissenschaft. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Schwerpunkte der Untersuchung des Wortes "Mädel", insbesondere bezüglich seiner Lautentwicklung, Schreibung, Bedeutungsgeschichte und des Pluralproblems in verschiedenen Sprachvarianten. Die Einleitung hebt die Relevanz der ersten Erwähnung des Wortes hervor, um dessen Alter zu bestimmen, und betont die Rolle der Grapheme und Morpheme in den jeweiligen Epochen.
Heutiger Gebrauch: Dieses Kapitel analysiert den gegenwärtigen Gebrauch des Wortes "Mädel", beginnt mit einer orthographischen Beschreibung (Duden) und der Wortbildungsanalyse, die "Mädel" als Simplex mit verschiedenen Ableitungen wie "Blitzmädel", "Jungmädel" und "Prachtmädel" identifiziert. Es wird die Wortbildung als endozentrische Determinativkomposita erläutert und die Ableitungen detailliert untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Pluralproblems mit der Darstellung verschiedener Pluralformen ("-Ø", "-s", "-n") und der Erläuterung der regionalen Sprachvarianten als Ursache dieses Problems. Die verschiedenen Pluralformen werden anhand von Beispielen und Quellen belegt.
Schlüsselwörter
Mädel, Etymologie, Sprachgeschichte, Wortbildung, Pluralproblem, regionale Sprachvarianten, Bedeutungsgeschichte, Nationalsozialismus, Lautwandel, Althochdeutsch, Neuhochdeutsch, Diminutiv.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur sprachwissenschaftlichen Analyse des Wortes "Mädel"
Was ist der Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Wortes "Mädel" von seinen althochdeutschen Ursprüngen bis zur Gegenwart. Der Fokus liegt auf der Veränderung von Lautung, Schreibweise und Bedeutung, mit besonderem Augenmerk auf dem Pluralproblem und der Verwendung des Wortes im Nationalsozialismus.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Analyse umfasst die etymologische Entwicklung, Bedeutungsänderungen im Laufe der Zeit, regionale Variationen und das damit verbundene Pluralproblem, Wortbildung und verwandte Wörter sowie die Verwendung des Wortes in verschiedenen historischen Kontexten, insbesondere im Nationalsozialismus. Die Arbeit beinhaltet auch eine Beschreibung des heutigen Gebrauchs des Wortes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum heutigen Gebrauch des Wortes (inklusive System und Wortbildung, Diasystem und Pluralproblem in regionalen Varianten sowie verwandten Wortformen), ein Kapitel zum Ursprung des Wortes (mit ersten Erwähnungen und Lautwandel), ein Kapitel zur Bedeutungsgeschichte (von Althochdeutsch bis Neuhochdeutsch, inklusive der Verwendung im Nationalsozialismus), und ein Resümee. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit versucht zu klären, wie sich die Bedeutung, Lautung und Schreibweise von "Mädel" im Laufe der Zeit verändert haben, welche regionalen Variationen existieren und wie sich das Pluralproblem erklärt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Verwendung des Wortes im Kontext des Nationalsozialismus.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit basiert auf etymologischen und sprachhistorischen Methoden. Es werden verschiedene Quellen herangezogen, um die Entwicklung des Wortes nachzuvollziehen und regionale Variationen zu belegen. Die Analyse umfasst orthographische Beschreibungen (z.B. nach Duden), Wortbildungsanalysen und die Untersuchung von Beispielen und Quellen, um die verschiedenen Pluralformen zu belegen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mädel, Etymologie, Sprachgeschichte, Wortbildung, Pluralproblem, regionale Sprachvarianten, Bedeutungsgeschichte, Nationalsozialismus, Lautwandel, Althochdeutsch, Neuhochdeutsch, Diminutiv.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende der Sprachwissenschaft, Germanistik und Linguistik, die sich für etymologische Untersuchungen und die historische Entwicklung von Wörtern interessieren. Sie ist auch für alle relevant, die mehr über die Geschichte und den Gebrauch des Wortes "Mädel" erfahren möchten.
- Quote paper
- Ina Hämmerling (Author), 2005, Historisch-etymologische Analyse des Wortes "Mädel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35691