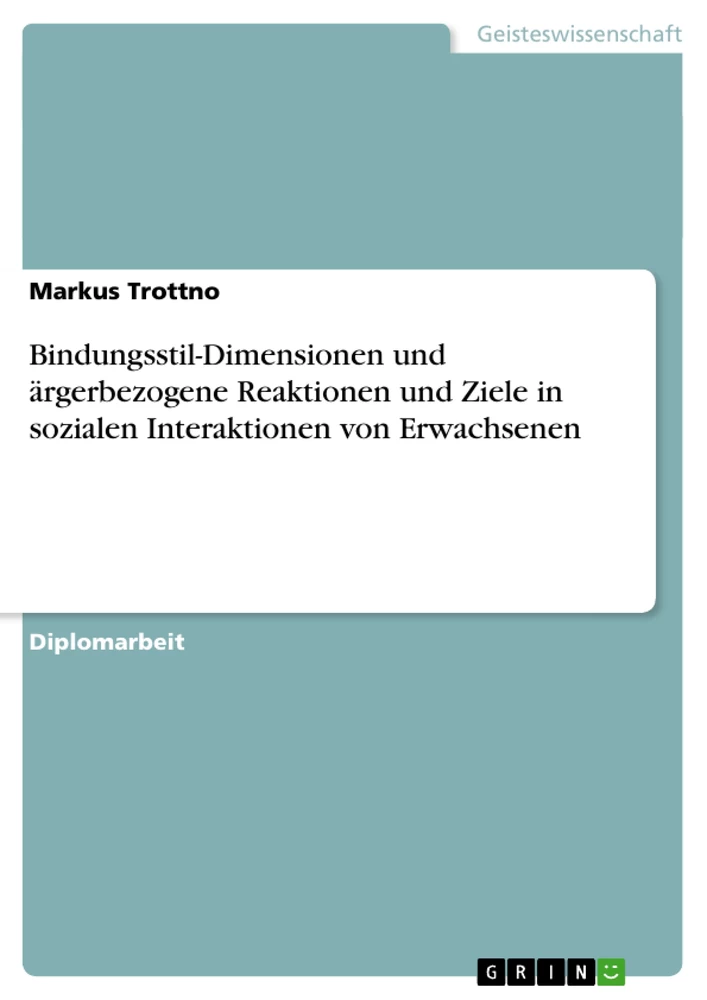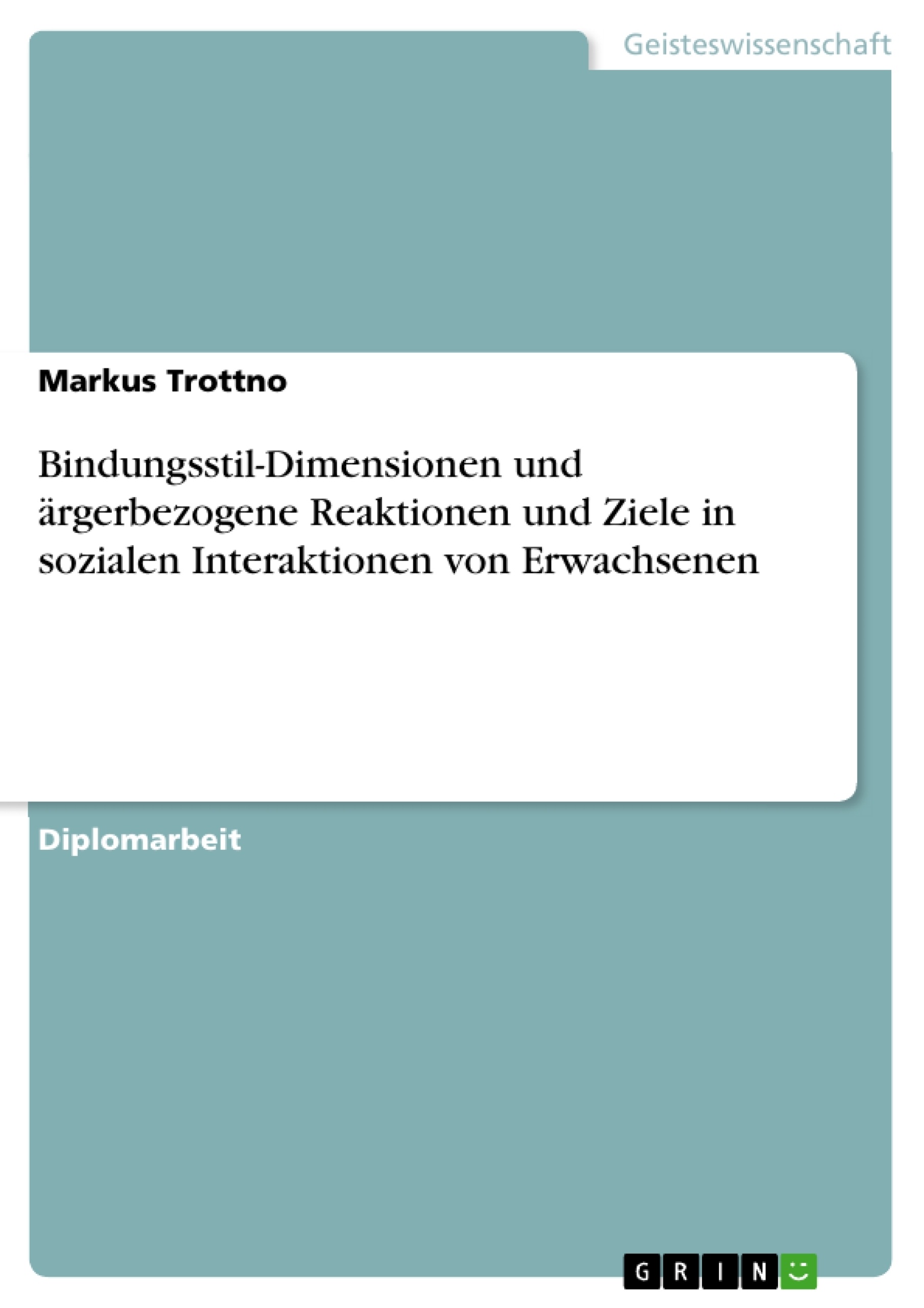Das Bindungsverhalten zwischen Mutter und Kind bzw. zwischen der Bindungsperson und dem Kind, wurde in vielen Studien und Forschungsarbeiten eingehend untersucht (vgl. dazu Ainsworth, Blehar, Waters, E. & Wall, 1978; Bowlby, 1975, 1976, 1983, 1985, 1995, 2001; Hazan & Shaver, 1987; Bartholomew, 1990; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Die immer wieder auftauchenden Fragen lauten: Wie entsteht das Band der Bindung zwischen Kind und seiner Bindungsperson, wie entwickeln sich die sog. inneren Arbeitsmodelle der Bindung - die Partnerschaft zwischen Mutter und Kind und wie äußert sich diese Bindungserfahrung im Erwachsenenalter - z.B. in sozialen Interaktionen? Wegweisend sind dabei die Arbeiten von John Bowlby. Mit der Entwicklung der Bindungstheorie, der kontinuierlichen Erweiterung seiner Forschung, seinem psychoanalytischen und ethologischen Blickwinkel, gelang ihm ein Grundmodell, das die Reichhaltigkeit der menschlichen Beziehungsmuster auf eine fundamentale Grundstruktur zurückführt, ohne sich dabei dem Vorwurf der Simplifikation auszusetzen. Das Erbe der Evolution ist in uns wirksam und wir kommen auf die Welt mit einem aktivierungsfähigen Bindungsverhaltenssystem, das aber nicht nach andauernder Aktivierung drängt, sondern in bestimmten Situationen eine zufriedenstellende Reaktion der Umwelt, genauer der Bindungsperson verlangt, um dadurch deaktiviert zu werden. Andauernde Aktivation spiegelt das Unvermögen der Umwelt wieder diese Aufgabe zu leisten. Die Grundmuster der Bindungserfahrung werden manifest in inneren Arbeitsmodellen und bleiben ein Leben lang stabil, sie bestimmen das Handeln des Erwachsenen mit – sie sind mit Bowlby’s Worten umweltstabil. Das bedeutet nicht, dass das Individuum keine Möglichkeit besitzt diese Modelle dahingehend zu verändern, dass es veränderte Handlungsmuster zeigen kann. Wie sonst könnten wir dann lernen z.B. mit frühen traumatischen Ereignissen umzugehen oder durch die Erkenntnis neue Denkstrukturen nutzen? Wenn aber dieses Arbeitmodelle so grundlegend und überdauernd sind, sei es in ihrer „Urform“ oder bereits modifiziert, dann interessiert zudem die Frage, wie sie die Handlung eines erwachsenen Menschen mitbestimmen. In dieser Arbeit liegt der Forschungsschwerpunkt insbesondere auf dem Zusammenspiel von Bindungsdimensionen - Angst vor Verlust - Bowlby: [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Bindungstheorie von John Bowlby
- 2.1 Der theoretische und experimentelle Hintergrund der Bindungstheorie
- 2.1.1 Einleitung
- 2.1.2 Das Instinktverhalten
- 2.2 Das Verhaltenssystem
- 2.2.1 Adaption, Anpassung, Angepasstheit, Umwelt der Angepasstheit
- 2.2.2 Angepasstwerden und der Prozess der Anpassung
- 2.2.3 Die Umwelt der evolutionären Angepasstheit
- 2.2.4 Instinktverhalten und dessen Vermittlung durch Verhaltenssysteme
- 2.2.5 Exkurs: Affekt, Gefühl und Emotion
- 2.2.6 Prozesse, die durch Gefühlsempfindungen erfasst werden
- 2.2.7 Die Einteilung interpretierten Inputs in Kategorien
- 2.3 Bindungsverhalten
- 2.3.1 Das Wachstum des Bindungsverhaltens im Verlauf der ersten Lebensjahre: Phasen der Entwicklung
- 2.3.2 Der weitere Verlauf des Bindungsverhaltens beim Menschen: Zusammenfassung und Ausblick
- 2.3.3 Die Funktion des Bindungsverhaltens
- 2.3.4 Bindung vermittelnde Verhaltensformen und ihre Organisation beim Menschen
- 2.3.5 Aktivierung und Beendigung von zielkorrigierten Systemen, die Bindungsverhalten vermitteln
- 2.3.6 Die Veränderungen mit zunehmenden Alter
- 2.1 Der theoretische und experimentelle Hintergrund der Bindungstheorie
- III. Bindungsstile im Erwachsenenalter und ihre Dimensionen: Messung des Konstruktes „Bindung“
- IV. Aspekte der Bindungsentwicklung
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Die Bedeutung der Emotionen für die Entwicklung und Organisation des Bindungsverhaltenssystems
- 4.3 Weitere Aspekte der Bindungsentwicklung
- 4.4 Bindungstypen (nach Ainsworth et al., 1978 und Main, 1995)
- 4.5 Emotionale Ausdrucksmuster der Bindungstypen
- 4.6 Physiologisches Modell der Stressbewältigung (Bewältigungsmodell)
- V. Emotionsregulationsmodelle: Der aktuelle Forschungsstand
- 5.1 Modelle
- 5.1.1 Das sieben Ebenenmodell von Thompson
- 5.1.2 Ist Emotionsregulation gleich Coping?
- 5.1.3 Bridges und Grolnick: Unterscheidung zwischen Emotionsregulation und Coping
- 5.2 Interaktive Regulationsstrategien als Entwicklungsfaktor
- 5.3 Von der interpsychischen zur intrapsychischen Emotionsregulation: Vier Phasen
- 5.5 Emotionsregulation im Jugendalter
- 5.5.1 Einleitung
- 5.5.2 Bewertung, Reaktion und Ziel
- 5.1 Modelle
- VI. Emotionsregulation: Ärger
- 6.1 Die Emotion Ärger
- 6.1.1 Einleitung
- 6.2 Die bewertende Einschätzung der Situation
- 6.2.1 Der Ansatz von Scherer
- 6.2.2 Der Ansatz von Lazarus und Smith
- 6.2.3 Der Ansatz von Averill
- 6.3 Formen der Ärgerreaktion und zielgerichteter Ärger
- 6.3.1 Einleitung: Ausdruck und Reaktion
- 6.3.2 Exkurs: Empirische Studien zur Ärgerreaktion und zielgerichtetem Ärger: Averill und Nell
- 6.3.2.1 Ärgerreaktionen
- 6.3.2.2 Zielgerichteter Ärger
- 6.3.3 Zielgerichteter Ärger: Die Bewältigungsziele nach Weber
- 6.3.4 Fazit: Zielgerichtete Ärgerreaktionen
- 6.1 Die Emotion Ärger
- VII. Hypothesenbildung
- 7.1 Ungerichtete Hypothesen nach den Kategorien sichere vs. unsichere Bindungsrepräsentation
- 7.1.1 Die sichere Bindungsrepräsentation
- 7.1.2 Unsichere Bindungsrepräsentation
- 7.2 Gerichtete Hypothesen
- 7.2.1 Überkategorial
- 7.2.2 Sichere Bindungsrepräsentation
- 7.2.3 Ängstliche Bindungsrepräsentation
- 7.2.4 Ängstlich-vermeidend gebundene Personen
- 7.2.5 Der vermeidende Bindungsstil
- 7.1 Ungerichtete Hypothesen nach den Kategorien sichere vs. unsichere Bindungsrepräsentation
- VIII. Methode
- 8.1 Stichproben
- 8.1.1 Hauptstichprobe
- 8.1.2 Nebenstichprobe (Vorteststichprobe)
- 8.2 Eingesetzte Verfahren
- 8.2.1.1 Einleitung
- 8.2.1.2 Der BinFB
- 8.2.1.3 Exkurs: Kategoriale oder dimensionale Messung?
- 8.3 Die Anwendung des BinFB
- 8.4 Ärgerbezogene Reaktionen und Ziele (AERZ)
- 8.4.1 Einleitung
- 8.4.2 Die Anwendung des AERZ
- 8.4.2.1 Die sechs Ärgerreaktionsskalen
- 8.4.2.2 Ärgerbezogene Verhaltensziele
- 8.4.3 Teststatistische Kennwerte der Skalen
- 8.5 Testverfahren
- 8.1 Stichproben
- IX. Ergebnisse
- 9.1 Deskriptive Maßzahlen der Stichprobe
- 9.2 Effektive Reaktionen
- 9.2.1 ANOVA (Konfidenzintervall 95%)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindungsstil und ärgerbezogenen Reaktionen und Zielen in sozialen Interaktionen von Erwachsenen. Ziel ist es, die Einflüsse unterschiedlicher Bindungsmuster auf die Emotionsregulation, insbesondere im Kontext von Ärger, zu analysieren.
- Bindungstheorie nach Bowlby und deren Anwendung auf das Erwachsenenalter
- Emotionsregulationsmodelle und deren aktuelle Forschung
- Zusammenhang zwischen Bindungsstil und Ärgerreaktionen
- Untersuchung verschiedener Strategien der Ärgerbewältigung
- Empirische Überprüfung der Hypothesen mittels Fragebögen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Bindungsstil und ärgerbezogenen Reaktionen. Sie begründet die Relevanz der Thematik und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
II. Die Bindungstheorie von John Bowlby: Dieses Kapitel stellt die Bindungstheorie von John Bowlby vor, beginnt mit den theoretischen und experimentellen Grundlagen und erläutert die zentralen Konzepte wie das Bindungsverhaltenssystem, dessen Entwicklungsphasen und die Funktion des Bindungsverhaltens im Laufe des Lebens. Der Fokus liegt auf der adaptiven Funktion von Bindung und der Rolle von Instinkten und Verhaltenssystemen.
III. Bindungsstile im Erwachsenenalter und ihre Dimensionen: Messung des Konstruktes „Bindung“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Operationalisierung des Bindungskonstruktes im Erwachsenenalter. Es werden verschiedene Bindungsstile und ihre Messmethoden vorgestellt, um die Grundlage für die empirische Untersuchung im späteren Teil der Arbeit zu schaffen.
IV. Aspekte der Bindungsentwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Bindungsentwicklung, insbesondere die Bedeutung von Emotionen für die Entwicklung und Organisation des Bindungsverhaltenssystems. Es werden verschiedene Bindungstypen nach Ainsworth et al. und Main vorgestellt und deren emotionale Ausdrucksmuster sowie physiologische Stressbewältigungsmodelle diskutiert.
V. Emotionsregulationsmodelle: Der aktuelle Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Emotionsregulationsmodellen. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt und verglichen, insbesondere der Unterschied zwischen Emotionsregulation und Coping wird thematisiert. Die Entwicklung inter- und intrapsychischer Regulationsstrategien wird ebenfalls behandelt.
VI. Emotionsregulation: Ärger: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Emotion Ärger und dessen Regulationsstrategien. Es werden verschiedene Ansätze zur Bewertung von Situationen (Scherer, Lazarus und Smith, Averill) und deren Auswirkungen auf die Ärgerreaktion und zielgerichteten Ärger analysiert. Empirische Studien werden herangezogen um den Zusammenhang zwischen verschiedenen Ärgerreaktionen und den dahinterstehenden Zielen zu beleuchten.
VII. Hypothesenbildung: In diesem Kapitel werden die Hypothesen formuliert, die im empirischen Teil der Arbeit getestet werden. Die Hypothesen beziehen sich auf den Zusammenhang zwischen sicheren und unsicheren Bindungsrepräsentationen und verschiedenen ärgerbezogenen Reaktionen und Zielen.
VIII. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, einschließlich der Stichprobenbeschreibung, der verwendeten Messinstrumente (Bindungsfragebogen, AERZ) und der statistischen Analyseverfahren.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bindungsstil, Emotionsregulation, Ärger, Ärgerbewältigung, soziale Interaktionen, Erwachsenenalter, Empirische Studie, Fragebögen, Bindungsrepräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Bindungsstil und ärgerbezogene Reaktionen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindungsstil und ärgerbezogenen Reaktionen und Zielen in sozialen Interaktionen von Erwachsenen. Das zentrale Ziel ist die Analyse des Einflusses verschiedener Bindungsmuster auf die Emotionsregulation, insbesondere im Kontext von Ärger.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Bindungstheorie von John Bowlby, einschließlich der Konzepte des Bindungsverhaltenssystems, der Entwicklungsphasen des Bindungsverhaltens und der verschiedenen Bindungsstile im Erwachsenenalter. Zusätzlich werden aktuelle Emotionsregulationsmodelle und deren Forschungsstand diskutiert, um den Zusammenhang zwischen Bindung und Ärgerregulation zu beleuchten.
Welche Aspekte der Bindungstheorie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den theoretischen und experimentellen Hintergrund der Bindungstheorie, das Bindungsverhaltenssystem mit seinen adaptiven Funktionen, die Entwicklung des Bindungsverhaltens über die Lebensspanne, verschiedene Bindungsstile im Erwachsenenalter und deren Messung, sowie Aspekte der Bindungsentwicklung und die Rolle von Emotionen dabei.
Wie werden Emotionsregulationsmodelle in die Arbeit integriert?
Die Arbeit präsentiert einen Überblick über aktuelle Emotionsregulationsmodelle, vergleicht verschiedene Ansätze und diskutiert den Unterschied zwischen Emotionsregulation und Coping. Die Entwicklung inter- und intrapsychischer Regulationsstrategien wird ebenfalls behandelt und im Kontext der Ärgerregulation angewendet.
Wie wird die Emotion Ärger in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Emotion Ärger und deren Regulationsstrategien. Es werden verschiedene Ansätze zur Bewertung von Situationen (Scherer, Lazarus und Smith, Averill) und deren Auswirkungen auf Ärgerreaktionen und zielgerichteten Ärger untersucht. Empirische Studien beleuchten den Zusammenhang zwischen verschiedenen Ärgerreaktionen und den zugrundeliegenden Zielen.
Welche Hypothesen werden in der Arbeit aufgestellt und getestet?
Die Arbeit formuliert Hypothesen über den Zusammenhang zwischen sicheren und unsicheren Bindungsrepräsentationen und verschiedenen ärgerbezogenen Reaktionen und Zielen. Diese Hypothesen werden im empirischen Teil der Arbeit mithilfe von Fragebögen getestet.
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung und -analyse verwendet?
Die empirische Untersuchung verwendet Fragebögen zur Erfassung von Bindungsstilen (Bindungsfragebogen - BinFB) und ärgerbezogenen Reaktionen und Zielen (AERZ). Die Datenanalyse umfasst deskriptive Statistiken und ANOVA-Tests (mit Konfidenzintervall von 95%). Die Stichprobe wird detailliert beschrieben, einschließlich einer Hauptstichprobe und einer Vorteststichprobe.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen deskriptive Maßzahlen der Stichprobe und Analysen zu effektiven Reaktionen auf Ärger im Kontext verschiedener Bindungsstile. Die Ergebnisse der ANOVA-Tests werden präsentiert und interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Bindungstheorie, Bindungsstil, Emotionsregulation, Ärger, Ärgerbewältigung, soziale Interaktionen, Erwachsenenalter, Empirische Studie, Fragebögen, Bindungsrepräsentation.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ist im ersten Abschnitt der HTML-Datei enthalten.
- Citation du texte
- Markus Trottno (Auteur), 2004, Bindungsstil-Dimensionen und ärgerbezogene Reaktionen und Ziele in sozialen Interaktionen von Erwachsenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35707