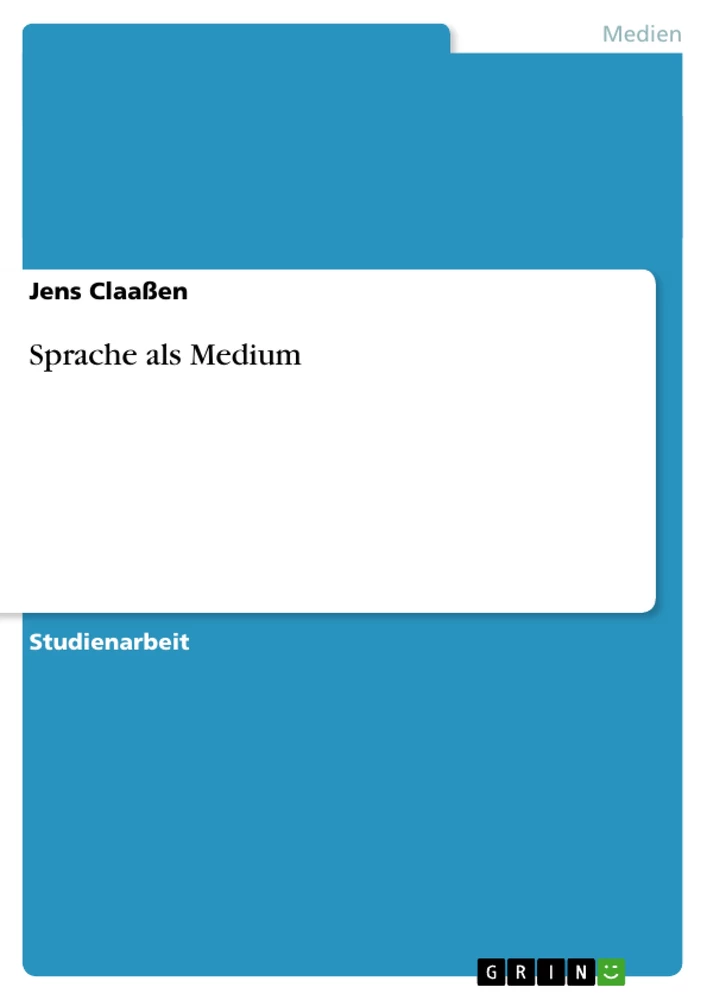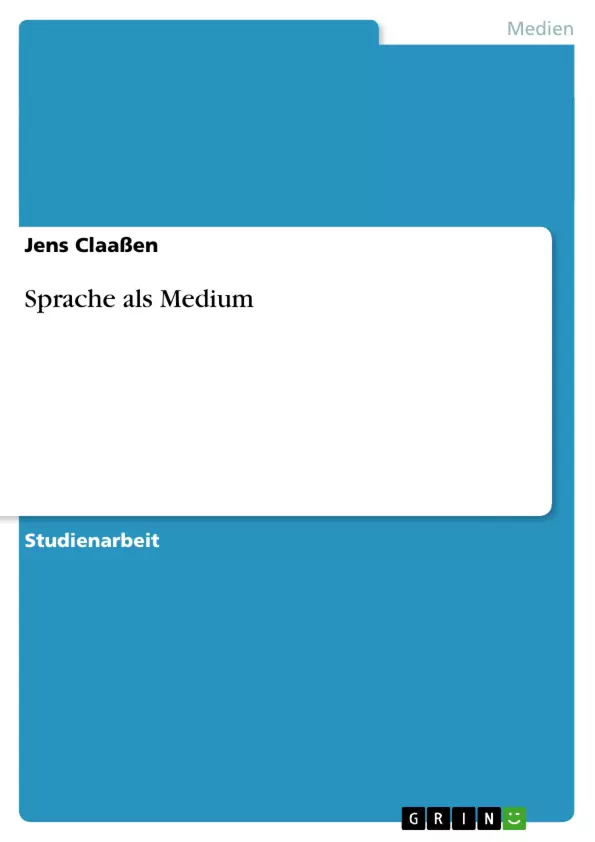Wird man danach gefragt, was Medien sind, dann werden einem wohl zunächst die verschiedenen Massenkommunikationsmittel einfallen, die so eng mit unserem Leben verflochten sind, dass wir nur noch schwer ohne sie sein können. Man wird an audiovisuelle Medien, an akustische Medien, Printmedien oder die neuen Medien denken und dabei doch zugleich der ursprünglichen Verkörperung von Medialität wenig Beachtung schenken; nämlich der von Sprache in ihrem alltäglichen Vollzug des Sprechens, der oralen Sprache. Diese Ignoranz gegenüber der Medialität von Sprache, die sich insbesondere auch in der neueren Sprachwissenschaft abzeichnet, basiert nach Ludwig Jäger letztlich auf einem eingeschränkten Kommunikationsverständnis, auf einem Verständnis, dass Kommunikation auf den bloßen Transport bereits vorhandener Information reduziert.
Im Verlauf dieser Arbeit werde ich versuchen zu zeigen, warum ein solches Verständnis dem Medium Sprache nicht gerecht werden kann. Die Ausführungen Ludwig Wittgensteins, der in seiner Spätphilosophie als einflussreicher Gegner des Transportmodells auftritt, werden sich für mein Vorhaben als besonders hilfreich erweisen. Denn mit seiner Konzeption verschiedener sozialer Sprachspiele überwindet Wittgenstein die traditionelle Vorstellung einer verdinglichenden Sprachauffassung, in der die vielfältigen Funktionen der Sprache zugunsten der des Benennens ausgeblendet werden. Diese Sprachauffassung wird von Wittgenstein vor allem anhand seiner Argumentationen bezüglich Regelfolgen und Privatsprache systematisch begründet, ich werde mich also auf die hierfür relevanten Passagen seiner Philosophischen Untersuchungen konzentrieren.
Hat man schließlich die beschränkte Vorstellung einer kognitivistisch geprägten Sprachwissenschaft überwunden, dann muss man sich auch den Besonderheiten sprachlicher Medialität zuwenden. Wie hängen Sprache und Denken zusammen, wenn Sprache nicht auf den bloßen Transport bereits vorhandener Gedanken reduziert werden kann? Um auch diese Frage hinreichend zu beantworten, werde ich die vorliegende Arbeit mit einem Ausblick auf die Ergebnisse Ludwig Jägers beschließen, der in seinem Aufsatz zur Sprache als Medium des Geistes näher auf das Abhängigkeitsverhältnis von Sprache und Denken eingeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sprachvergessenheit der Medientheorie
- Die Medialitätsvergessenheit der Sprachtheorie
- Der Medienbegriff
- Zum Sprachverständnis Ludwig Wittgensteins
- Regeln und Regelfolgen
- Die private Sprache
- Empfindungen
- Das E-Spiel
- Das Medium des Geistes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Medialität von Sprache und analysiert, wie sie von der Medientheorie und Sprachtheorie oft vernachlässigt wird. Der Text argumentiert, dass ein begrenztes Kommunikationsverständnis, das Kommunikation auf den bloßen Transport von Information reduziert, die Rolle von Sprache als Medium unterschätzt. Ludwig Wittgensteins Philosophie wird als Gegenentwurf zur traditionellen Sprachauffassung verwendet, die Sprache als ein Instrument zur Benennung betrachtet.
- Die Sprachvergessenheit der Medientheorie
- Die Medialitätsvergessenheit der Sprachtheorie
- Wittgensteins Konzept sozialer Sprachspiele
- Das Verhältnis von Sprache und Denken
- Sprache als Medium des Geistes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der Vernachlässigung der Medialität von Sprache in der Medientheorie und Sprachtheorie vor. Es wird argumentiert, dass ein begrenztes Kommunikationsverständnis, das Kommunikation auf den Transport von Information reduziert, die Rolle von Sprache als Medium unterschätzt. Die Arbeit zielt darauf ab, diese Einschränkung durch die Analyse von Ludwig Wittgensteins Philosophie aufzuzeigen.
- Die Sprachvergessenheit der Medientheorie: Dieses Kapitel beleuchtet die Tendenz in der Medientheorie, Medialität mit Technologie gleichzusetzen und die Medialität von Sprache zu ignorieren. Es wird argumentiert, dass dieses Phänomen auf ein Transport-Modell der Kommunikation zurückzuführen ist, das Medien als reine Repräsentationsmedien betrachtet.
- Die Medialitätsvergessenheit der Sprachtheorie: Dieses Kapitel diskutiert, wie die Sprachwissenschaft in ihrer kognitivistischen Ausrichtung die materielle und mediale Erscheinung von Sprache aus der Erkenntnis ausschließt. Es wird argumentiert, dass die Struktur- und Handlungstheorien der Sprache und Kommunikation einem Zwei-Welten-Modell folgen, das zwischen einer abstrakten Ebene der Sprache und einer konkreten Ebene ihrer Verwendung unterscheidet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Medialität von Sprache, die Sprachvergessenheit der Medientheorie und die Medialitätsvergessenheit der Sprachtheorie. Sie untersucht das Verhältnis von Sprache und Denken und analysiert Ludwig Wittgensteins Philosophie im Kontext des Medienbegriffs. Wichtige Themen sind die Kritik an einem Transport-Modell der Kommunikation, die Bedeutung sozialer Sprachspiele und die Rolle von Sprache als Medium des Geistes.
- Quote paper
- M.A. Jens Claaßen (Author), 2004, Sprache als Medium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35721