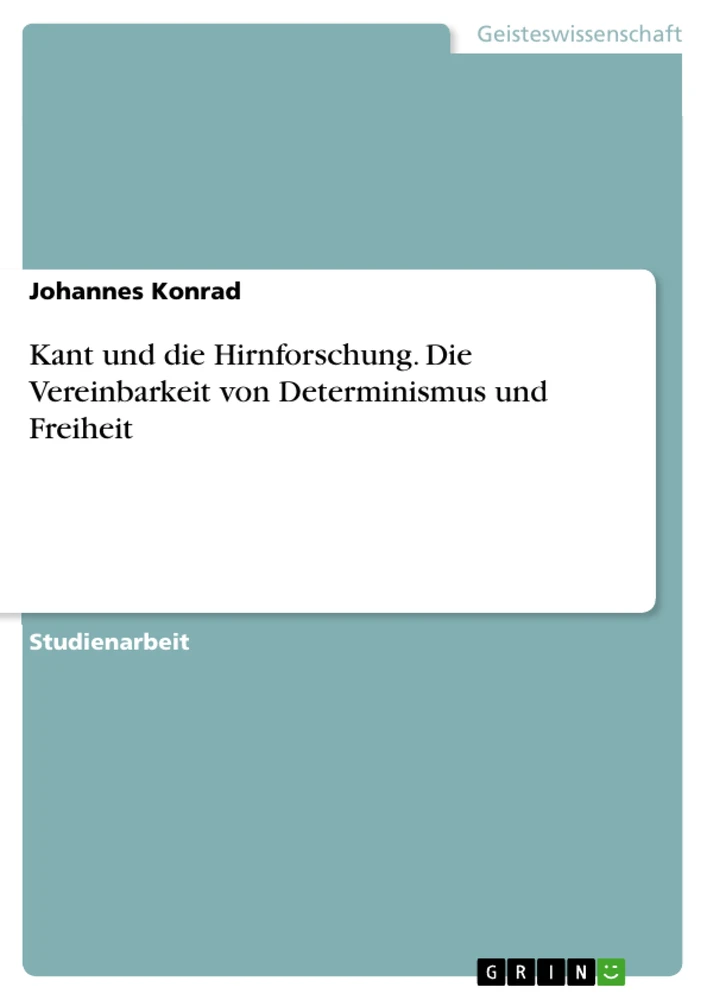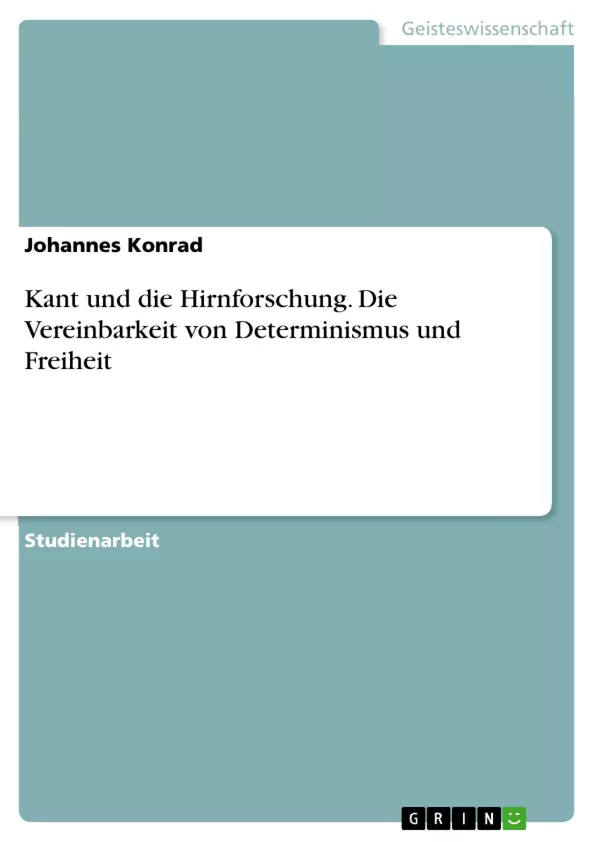Die Hirnforschung konnte durch den technischen Fortschritt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Vorgänge innerhalb des Gehirns immer genauer beobachten. So ließen sich beispielsweise mit der in den 1980er Jahren entwickelten Magnetresonanztomographie erstmals Aktivitäten verschiedener Hirnareale und deren Veränderung unter bestimmten Umständen beobachten. Diese Beschreibbarkeit von Vorgängen im Gehirn bis auf Ebene der Neuronen veranlasste einige Neurowissenschaftler sich auch Fragen zu-zuwenden, die bisher als Domäne der Philosophie oder Theologie galten, allen voran, der nach der Freiheit des Willens. So unternahm der Physiologe Benjamin Libet 1979 ein Experiment mit dem er die Existenz eines freien Willens anhand neuronaler Aktivitäten nachweisen wollte. Seitdem gilt dieses Experiment als der empirische Nachweis für die naturkausale Determiniertheit des menschlichen Willens.
Auch wenn dies nicht von allen Neurowissenschaftlern in dieser Konsequenz unterstützt wird, so vertreten doch einzelne Forscher an exponierter Stelle eine solche Position. Zu nennen sind hier vor allem Wolf Singer, der mit seinem in der FAZ erschienen Artikel „Keiner kann anders als er ist“ eine streng deterministische Position einnahm. (...) Es handelt sich bei diesem naturkausal verstandenen Determinismus zwar nicht unbedingt um eine weit verbreitete Position. Dennoch drängt sie in die öffentliche und fachliche Wahrnehmung und sollte daher beachtet werden. Zumal eine tatsächliche Widerlegung des freien Willens für die Philosophie äußerst folgenschwer wäre, nicht zuletzt für die Kants, in dessen Denken die Freiheit eine zentrale Position einnimmt.
Daher soll im Folgenden überprüft werden, ob die These einer Nichtexistenz des freien Willens wegen der vollständigen Determiniertheit des Menschen Kants Konzeption eines Handelns aus Freiheit trifft. Hierzu werde ich zeigen, wie die bei Kant metaphysisch verankert Freiheit sich im Handeln realisieren und damit in der empirischen Welt real werden soll. Dabei werde ich mich in erster Linie auf die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ stützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Nivellierung von Freiheit in der Kausalität
- Roths Verständnis von Freiheit
- Autonomie und Determinismus
- Von der Idee der Freiheit zur Freiheit im Handeln
- Empirische Welt und Verstandeswelt
- Vernunft und Freiheit
- Handeln aus Freiheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von Determinismus und Freiheit im Kontext der Hirnforschung und Kants Moralphilosophie. Sie analysiert, ob die These einer Nichtexistenz des freien Willens aufgrund vollständiger naturkausalen Determiniertheit Kants Konzeption eines Handelns aus Freiheit widerlegt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Relevanz empirischer Befunde für metaphysische Fragen der Freiheit.
- Der Determinismus in der Hirnforschung und seine Implikationen für den freien Willen.
- Kants Verständnis von Freiheit und seine metaphysische Fundierung.
- Die Beziehung zwischen empirischer Welt und Verstandeswelt in Bezug auf Freiheit.
- Die Realisierung von Freiheit im Handeln nach Kant.
- Eine kritische Auseinandersetzung mit Gerhard Roths Position zum freien Willen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Hintergrund der Arbeit: Der Fortschritt in der Hirnforschung, insbesondere die Möglichkeit, Gehirnaktivitäten zu beobachten, hat zu neuen Debatten über den freien Willen geführt. Neurowissenschaftler wie Wolf Singer und Gerhard Roth vertreten deterministische Positionen, die die philosophische Diskussion herausfordern, insbesondere Kants Moralphilosophie, in der Freiheit eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit untersucht, ob die deterministische Perspektive Kants Konzeption des Handelns aus Freiheit beeinträchtigt.
Die Nivellierung von Freiheit in der Kausalität: Dieses Kapitel analysiert Gerhard Roths materialistischen Ansatz, der Willensfreiheit widerlegt. Roths Verständnis von Freiheit basiert auf einem streng materialistischen Weltbild, das Geist als eine empirische Erscheinung betrachtet, die durch neuronale Prozesse erklärt werden kann. Das Libet-Experiment wird als vermeintlicher empirischer Beweis für die Determiniertheit des Willens interpretiert. Die Kritik an Roths Ansatz liegt in der Unvereinbarkeit seines empirisch orientierten Freiheitsbegriffes mit der metaphysischen Freiheit, die Kant postuliert. Roths Versuch, Freiheit im Rahmen einer kausal geschlossenen Welt nachzuweisen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Von der Idee der Freiheit zur Freiheit im Handeln: Dieses Kapitel untersucht, wie Kants metaphysische Freiheit sich im Handeln realisieren soll. Es wird der Unterschied zwischen der empirischen und der Verstandeswelt beleuchtet, um zu zeigen, wie Freiheit im Handeln nach Kant möglich ist. Kant unterscheidet zwischen der Welt der Erscheinungen, die den Naturgesetzen unterliegt, und der Welt der Dinge an sich, in der Freiheit möglich ist. Nur im Bereich der Dinge an sich ist ein Handeln aus freiem Willen möglich, während das Handeln in der empirischen Welt durch Kausalität bestimmt ist. Der Fokus liegt auf der Vermittlung dieser beiden Welten und der Möglichkeit, Freiheit trotz der Kausalität in der Erfahrungswelt zu denken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Nivellierung von Freiheit in der Kausalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von Determinismus und Freiheit. Sie analysiert, ob die These einer Nichtexistenz des freien Willens aufgrund vollständiger naturkausalen Determiniertheit Kants Konzeption eines Handelns aus Freiheit widerlegt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Relevanz empirischer Befunde (insbesondere der Hirnforschung) für metaphysische Fragen der Freiheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Determinismus in der Hirnforschung und seine Implikationen für den freien Willen, Kants Verständnis von Freiheit und dessen metaphysische Fundierung, die Beziehung zwischen empirischer und Verstandeswelt im Bezug auf Freiheit, die Realisierung von Freiheit im Handeln nach Kant und eine kritische Auseinandersetzung mit Gerhard Roths Position zum freien Willen.
Welche Position vertritt Gerhard Roth?
Gerhard Roth vertritt einen materialistischen Ansatz, der Willensfreiheit widerlegt. Sein Verständnis von Freiheit basiert auf einem streng materialistischen Weltbild, das Geist als eine empirische Erscheinung betrachtet, die durch neuronale Prozesse erklärt werden kann. Das Libet-Experiment wird von ihm als vermeintlicher empirischer Beweis für die Determiniertheit des Willens interpretiert.
Wie kritisiert die Arbeit Roths Position?
Die Arbeit kritisiert Roths Unvereinbarkeit seines empirisch orientierten Freiheitsbegriffes mit der metaphysischen Freiheit, die Kant postuliert. Roths Versuch, Freiheit im Rahmen einer kausal geschlossenen Welt nachzuweisen, wird als von vornherein zum Scheitern verurteilt betrachtet.
Wie beschreibt die Arbeit Kants Verständnis von Freiheit?
Die Arbeit beleuchtet Kants Unterscheidung zwischen empirischer und Verstandeswelt. Freiheit ist nach Kant nur im Bereich der Dinge an sich möglich, während das Handeln in der empirischen Welt durch Kausalität bestimmt ist. Die Arbeit fokussiert auf die Vermittlung dieser beiden Welten und die Möglichkeit, Freiheit trotz der Kausalität in der Erfahrungswelt zu denken.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit ist aufgebaut mit Einleitung, einem Kapitel zur Nivellierung von Freiheit in der Kausalität (mit Fokus auf Roth), einem Kapitel zur Realisierung von Freiheit im Handeln nach Kant und einem Fazit. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten, aber implizit geht es darum, die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Determinismus und Freiheit im Kontext der Hirnforschung und Kants Philosophie zu untersuchen und zu bewerten.)
- Quote paper
- Johannes Konrad (Author), 2016, Kant und die Hirnforschung. Die Vereinbarkeit von Determinismus und Freiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357233