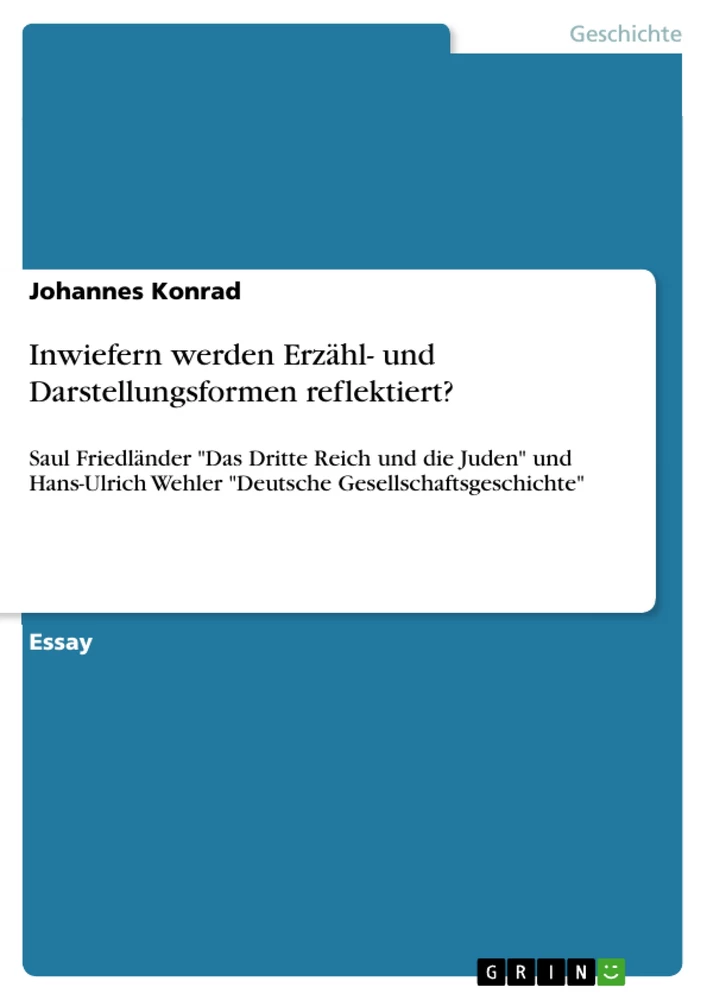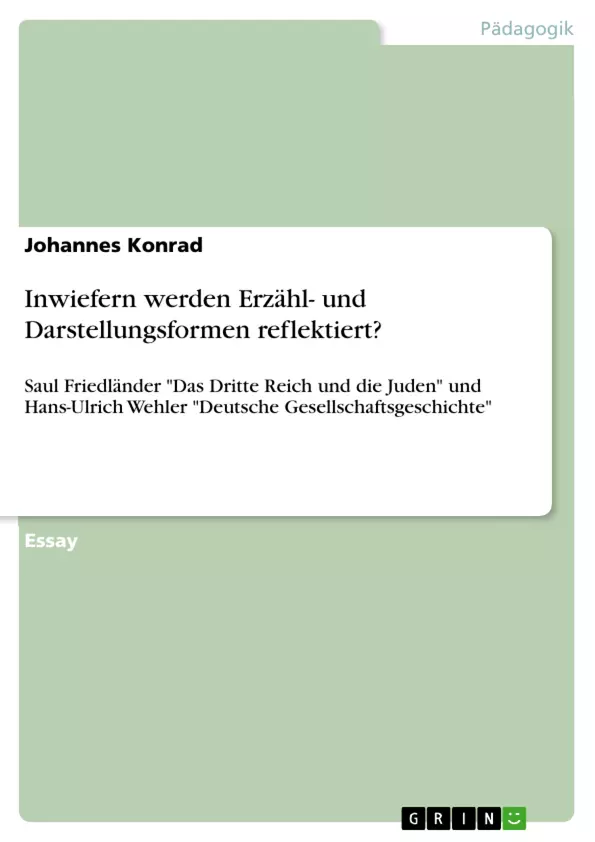Mitte der 1980er Jahre fand im Schatten des „Historikerstreits“ mit der „Historismusdebatte“ eine zweite geschichtswissenschafftliche Auseinandersetzung statt. Sie wurde ausgelöst vom Münchner Historiker Martin Broszat, der 1985 sein „Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus“ publizierte hatte. Die Forderung nach einer distanzierten, nicht moralisierenden Herangehensweise an den Nationalsozialismus und die Shoa löste eine Debatte über eine angemessene Darstellung dieser Geschichte aus, an der sich unter anderem Saul Friedländer und Hans-Ulrich Wehler mit je gegensätzlichen Positionen beteiligten. Angesichts des zunehmenden Verlusts der Augenzeugenschaft über die NS-Zeit und einer zunehmend „unbefangenen“ Darstellung in der Populärkultur, scheint die Frage nach der adäquaten Form nach wie vor aktuell. Im Folgenden werde ich daher Friedländers und Wehlers Hauptwerke auf eben diese Frage hin vergleichend betrachten und untersuchen inwiefern sie diese reflektieren.
Exzerpt:
(...) Diese geschlossene Zeitwahrnehmung ist jedoch nur aus der Täterperspektive möglich, die somit von den schlaglichtartigen Berichten der Opfer abgegrenzt wird. Dieser Gegensatz ist von Friedländer ausdrücklich beabsichtigt. Im Vorwort zu „die Jahre der Vernichtung“ weist er auf die Vielzahl der Perspektiven hin, aus denen sich die Quellen zur Shoa zusammensetzen. Diese will der Autor zu einer Gesamtdarstellung verbinden, wobei er besonderen Wert darauf legt den Opfern eine Stimme zu geben, die bisher aus der wissenschaftlichen Betrachtung des Holocaust ausgespart worden sei. Die persönlichen Aufzeichnungen sind für Friedländer jedoch auch aus einem anderen Grund unverzichtbar. Gerade durch ihren subjektiven und unmittelbaren Charakter sollen sie eine objektive „Businass-as-usual-Historiographie“ durchbrechen, die eine Darstellung der Massenvernichtung verflachen und domestizieren würde. Friedländer wählt für seine Darstellung also bewusst eine fragmentierte Form, die weder eine geschlossene Narration aus der Täterperspektive bietet, noch die Zeitzeugenberichte zur mikrohistorischen Betrachtung verknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hans-Ulrich Wehler: „Deutsche Gesellschaftsgeschichte“
- Die „Bielefelder Schule“
- Struktur und Prozess
- Der deutsche Sonderweg
- Kritik an Heinrich August Winkler
- Saul Friedländer: „Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939-1945“
- Fragmentierte Darstellung
- Die „integrierte Geschichte“
- Briefwechsel mit Martin Broszat
- Vergleichende Betrachtung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Implikationen des „narrative turn“ für die Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik am Beispiel der Werke von Hans-Ulrich Wehler („Deutsche Gesellschaftsgeschichte“) und Saul Friedländer („Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939-1945“). Dabei wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Autoren Erzähl- und Darstellungsformen reflektieren und diese mit ihrem jeweiligen Forschungsansatz verknüpfen.
- Reflexion von Erzähl- und Darstellungsformen
- Verknüpfung von Forschungsansatz und Darstellungsform
- Der „narrative turn“ in der Geschichtswissenschaft
- Die Rolle der Geschichte im Kontext der Shoa
- Die Historisierung des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der „Historismusdebatte“ dar und erläutert die Relevanz der Frage nach der adäquaten Form der Darstellung des Nationalsozialismus und der Shoa.
Das Kapitel über Hans-Ulrich Wehler beleuchtet dessen „Deutsche Gesellschaftsgeschichte“ und dessen strukturalistischen Ansatz. Wehler fokussiert auf die gesellschaftlichen Dimensionen von Politik, Kultur, Wirtschaft und sozialer Ungleichheit und verwendet dabei eine teils achronologische Darstellung, die den deutschen Sonderweg als Leitmotiv verfolgt.
Das Kapitel über Saul Friedländer analysiert dessen „Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939-1945“. Friedländer setzt auf eine fragmentierte Darstellung, die Zeitzeugenberichte mit chronologischen Schilderungen kombiniert. Diese „integrierte Geschichte“ soll den Opfern der Shoa eine Stimme geben und die Grenzen der konventionellen Narrativität sprengen.
Der Vergleich der beiden Werke zeigt die unterschiedlichen Ansätze der Autoren in Bezug auf die Historisierung des Nationalsozialismus. Wehler folgt der Forderung nach einer abstrakten Darstellung, während Friedländer auf Unmittelbarkeit setzt. Beide reflektieren die Art ihrer Präsentation, wobei Friedländer die Narration stärker in die Reflexion einbezieht.
Schlüsselwörter
Geschichtswissenschaft, Geschichtsdidaktik, „narrative turn“, „Historismusdebatte“, Nationalsozialismus, Shoa, Hans-Ulrich Wehler, Saul Friedländer, „Deutsche Gesellschaftsgeschichte“, „Das Dritte Reich und die Juden“, Erzählformen, Darstellungsformen, Historisierung, Sonderweg, Zeitzeugenberichte, Fragmentierung, „integrierte Geschichte“.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Historismusdebatte“ der 1980er Jahre?
Eine Debatte über die angemessene Darstellung des Nationalsozialismus, ausgelöst durch Martin Broszats Plädoyer für eine „Historisierung“ der NS-Zeit.
Wie unterscheidet sich Saul Friedländers Ansatz von Wehlers?
Friedländer nutzt eine fragmentierte, „integrierte Geschichte“, die Opfern eine Stimme gibt, während Wehler einen abstrakten, strukturgeschichtlichen Ansatz verfolgt.
Was bedeutet „narrative turn“ in der Geschichtswissenschaft?
Es ist die Reflexion darüber, dass historische Darstellungen immer auch erzählte Geschichten sind und die Form der Erzählung die Interpretation beeinflusst.
Was ist die „Bielefelder Schule“?
Eine Richtung der Geschichtswissenschaft, der Hans-Ulrich Wehler angehörte und die soziale Strukturen und Prozesse über die Ereignisgeschichte stellte.
Warum sind Opferberichte für Friedländer unverzichtbar?
Sie durchbrechen eine objektive „Business-as-usual-Historiographie“, die die Massenvernichtung laut Friedländer verflachen und domestizieren würde.
- Arbeit zitieren
- Johannes Konrad (Autor:in), 2016, Inwiefern werden Erzähl- und Darstellungsformen reflektiert?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357234