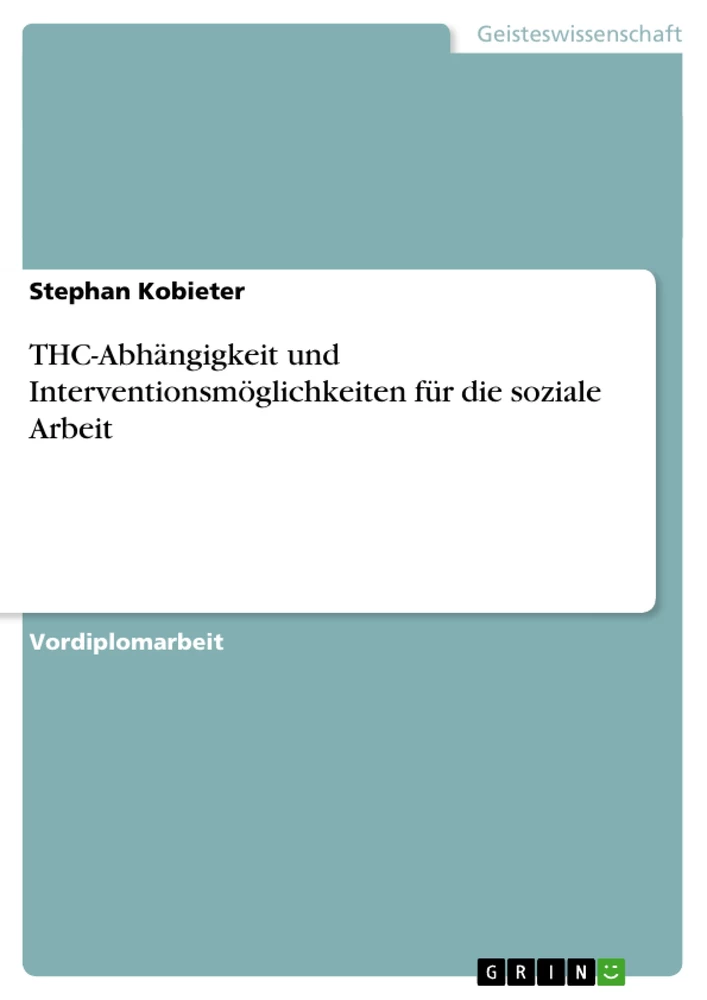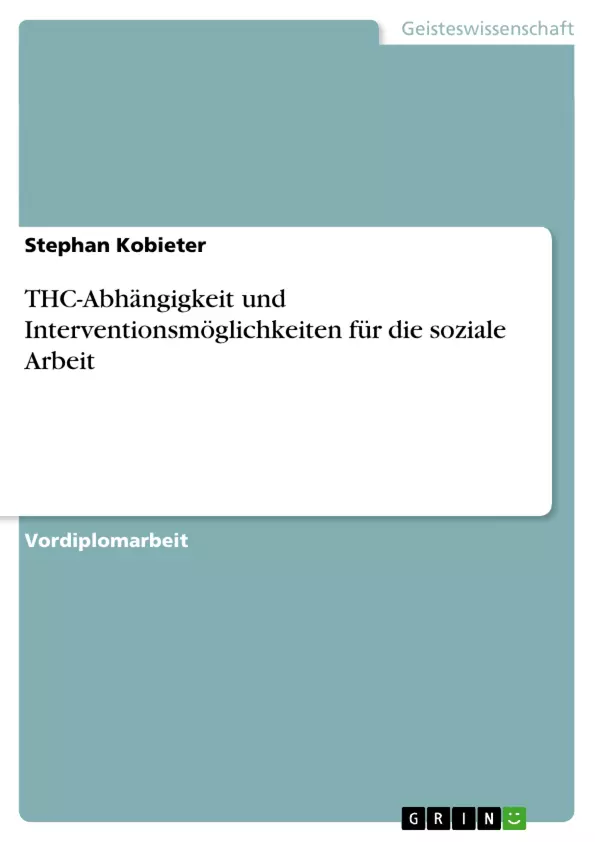Cannabis ist weltweit die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Trotz des Verbotes der Pflanze in den westlichen Industrienationen hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte diese Droge in unserem Kulturkreis etablieren können, so dass heute ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen eigene Erfahrungen im Umgang mit Cannabis haben. Für viele dieser Jugendlichen bleibt Cannabis eine Erfahrung auf dem Weg zum „Erwachsenwerden“, d.h., sie kommen über das „Probierstadium“ nicht hinaus. Ein großer Teil der Leute, die Cannabis konsumieren, behaupten, dass diese Droge harmlos ist und nicht abhängig machen kann. Demgegenüber steht die stetig wachsende Gruppe von Cannabiskonsumenten, welche öfter konsumieren, als sie das selber möchten und deswegen auch Beratungsstellen aufsuchen.
Cannabiskonsum wird demzufolge in der Gesellschaft kontrovers diskutiert, wobei das Spektrum von der Verharmlosung bis zum restriktiven Ablehnung reicht. Ich werde mich daher im Folgenden, ausgehend von einer kurzen Darstellung der Botanik des Hanfes, einem Überblick über Cannabisprodukte und den Rauschwirkungen des Cannabis (Kapitel 2) dem Problem der Cannabisabhängigkeit zuwenden (Kapitel 3). Die Rauschwirkung von Cannabis beruht auf Tetrahydrocannabinol (THC). Im Folgenden werden Cannabis- und Haschisch- und THC-Abhängigkeit als Synonyme gebraucht. Ebenso wird bei den Begriffen Abhängigkeit und Sucht verfahren, obwohl der Begriff der Sucht in der Fachsprache nicht mehr gebräuchlich ist. Im Kapitel 4 meiner Arbeit, werde ich die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten sozialer Arbeit bei Cannabiskonsum/-abhängigkeit vorstellen, aber auch Schwachstellen der präventiven Angebote näher beleuchten. Die Ergebnisse meiner Arbeit fasse ich in einem kurzen Resümee zusammen. Nicht untersucht werden soll, ob und wie Cannabis den Einstieg zum Konsum anderer Drogen ebnet. Des weiteren soll in dieser Arbeit auch nicht die Frage geklärt werden, ob und wie Cannabiskonsum schizophrene Psychosen auslösen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Cannabis - Produkte und Rauschwirkung
- Botanik des Hanfes
- Cannabisprodukte
- Rauschwirkung des Cannabis
- Zum Problem der THC-Abhängigkeit
- Allgemeine Bemerkungen zur Abhängigkeitsproblematik
- Zur Begrifflichkeit von Abhängigkeit
- Theorien zu den Ursachen der Entstehung von Abhängigkeit
- Cannabiskonsum und Abhängigkeit
- Präventionsansätze für die soziale Arbeit
- Die drei Säulen der Prävention
- Primärpräventive Ansätze
- Sekundärpräventive Ansätze
- Tertiärpräventive Ansätze
- Defizite innerhalb des Versorgungssystems
- Schlusswort/ Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der THC-Abhängigkeit und den damit verbundenen Interventionsmöglichkeiten für die soziale Arbeit. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für die Problematik des Cannabiskonsums und der Abhängigkeit zu entwickeln und geeignete Präventionsansätze zu beleuchten.
- Botanik und Pharmakologie des Cannabis
- Das Abhängigkeitspotential von THC
- Theorien zur Entstehung von Abhängigkeit
- Präventive Maßnahmen der sozialen Arbeit
- Defizite im Versorgungssystem für THC-Abhängige
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung zum Thema THC-Abhängigkeit und zeigt die Relevanz der Thematik im gesellschaftlichen Kontext auf. Kapitel zwei befasst sich mit der Botanik des Hanfes, verschiedenen Cannabisprodukten und deren Rauschwirkungen. Das dritte Kapitel widmet sich dem Problem der THC-Abhängigkeit, beleuchtet verschiedene Theorien zur Entstehung von Abhängigkeit und analysiert die Verbindung zwischen Cannabiskonsum und Abhängigkeit. Im vierten Kapitel werden präventive Ansätze der sozialen Arbeit vorgestellt, die drei Säulen der Prävention erläutert und verschiedene Interventionsmöglichkeiten diskutiert.
Schlüsselwörter
Cannabis, THC, Abhängigkeit, Prävention, soziale Arbeit, Intervention, Versorgungssystem, Cannabiskonsum, Rauschwirkung, Botanik, Theorien, Ursachen, Sekundärprävention, Tertiärprävention, Primärprävention
Häufig gestellte Fragen
Ab wann spricht man von einer THC-Abhängigkeit?
Abhängigkeit liegt vor, wenn Konsumenten öfter konsumieren, als sie beabsichtigen, und trotz negativer Folgen nicht aufhören können.
Welche Rauschwirkungen hat Cannabis?
Die Wirkung basiert auf dem Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) und wird im Text im Kontext der Botanik des Hanfes erläutert.
Welche Präventionsansätze gibt es in der Sozialen Arbeit?
Es wird zwischen Primärprävention (Vorbeugung), Sekundärprävention (Früherkennung) und Tertiärprävention (Schadensbegrenzung) unterschieden.
Gibt es Defizite im Versorgungssystem für Cannabisabhängige?
Ja, die Arbeit beleuchtet Schwachstellen in den präventiven Angeboten und dem Zugang zu spezialisierten Beratungsstellen.
Ist Cannabis eine harmlose Droge?
Die Arbeit diskutiert die gesellschaftliche Kontroverse zwischen Verharmlosung und den realen Problemen wachsender Abhängigkeitsgruppen.
- Citar trabajo
- Stephan Kobieter (Autor), 2005, THC-Abhängigkeit und Interventionsmöglichkeiten für die soziale Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35726