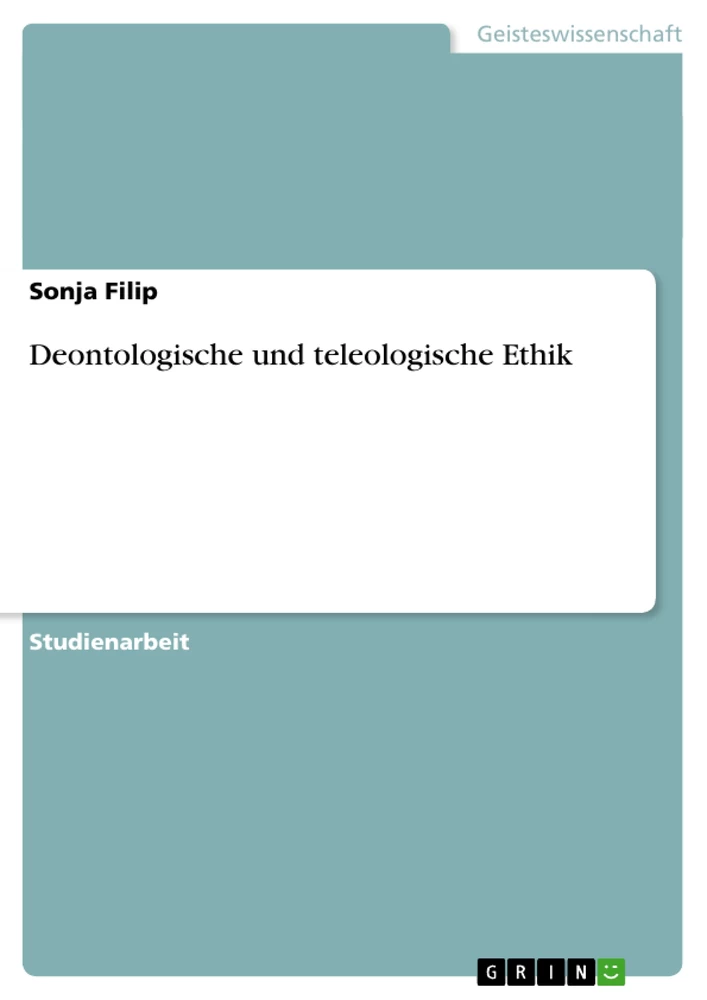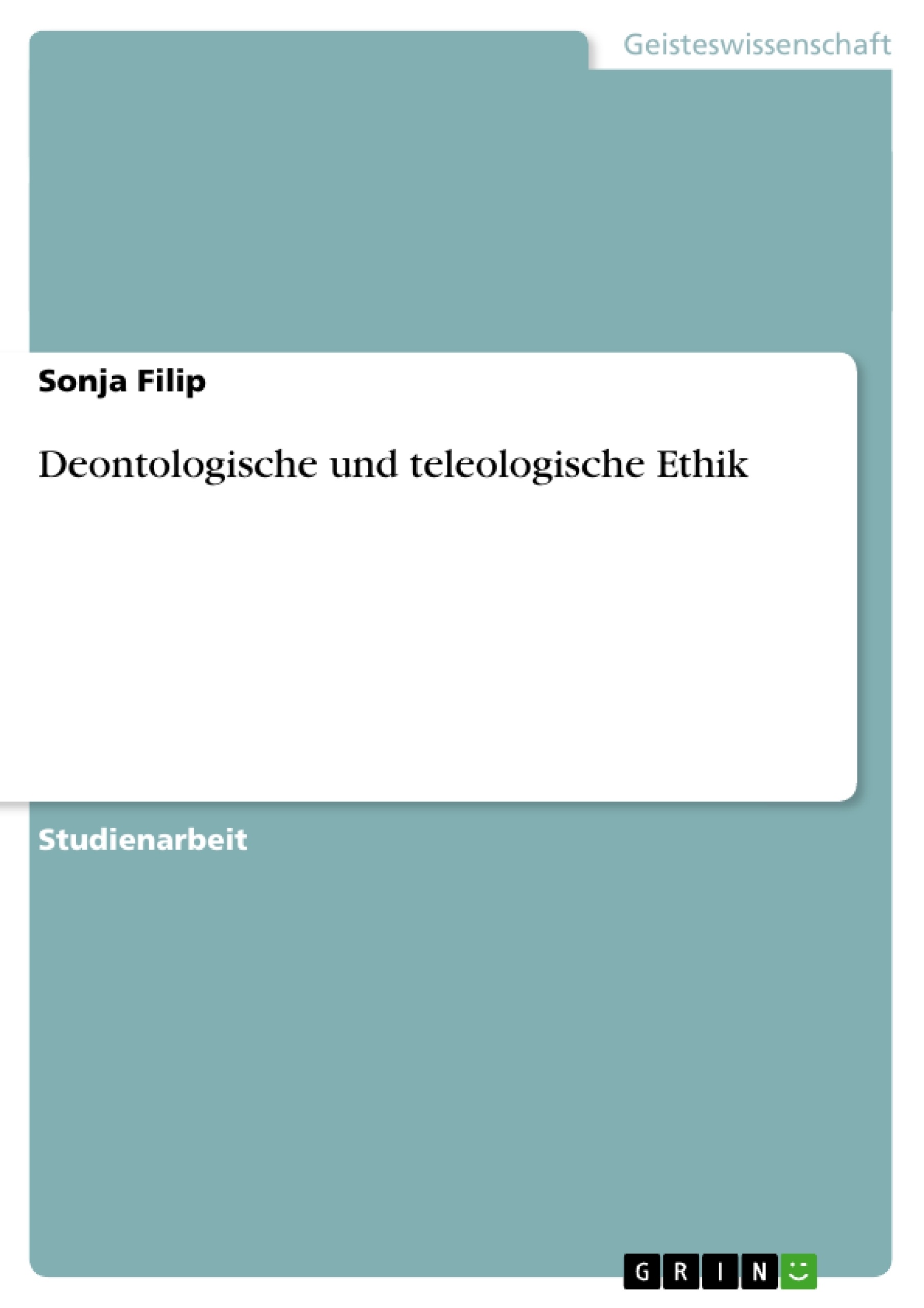Ausgearbeitetes, gründliches Referat über Deontologische und Teleologische Theorien. Ich beginne mein Referat mit der Frage, wann Menschen beginnen, über Moral zu philosophieren. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sie unzufrieden mit dem herrschenden Verhaltenskodex sind oder wenn sie an eben diesem zweifeln. In solchen Situationen beginnen sie, ihn zu hinterfragen. Hieraus ergibt sich direkt die Problemstellung, die ich als Ausgangsfrage für mein Referat ansetzen möchte: Dienen herrschende Normen als Verhaltensmaßstab? Und können sie als Maßstab für „moralisch richtig“ und „moralisch falsch“ fungieren? Moralphilosophien betrachten diese Thematik sehr kritisch. Für sie gibt es eine Vielzahl von Einwänden, die schließlich dafür sorgen, dass – zumindest aus ihrer Sicht - die Antwort klar „nein“ heißen muss. Einige dieser Einwände will ich kurz nennen und erläutern. Die tatsächlichen Normen einer Gesellschaft sind nie sehr präzise und lassen Ausnahmen zu – sie können demnach nicht allgemeingültig sein. Eine gute Beispielsituation hierfür ist vielleicht, dass es Konsens ist, das Töten von Menschen als moralisch schlecht anzusehen. Wie passt das aber zu der Situation eines Soldaten im Krieg, der angewiesen wird, auch den Tod vieler Gegner in Kauf zu nehmen? Oder: Wie passt unsere Norm, nicht zu töten, zu Staaten, in denen die Todesstrafe praktiziert wird? Diese Ausnahmen werden zwar zugelassen, sind aber nicht ausreichend in das Normensystem integriert.
Ein anderer Einwand der Moralphilosophen ist, dass Normen in einer konkreten Situation in Konflikt miteinander geraten können. Hierzu wird im Text Sokrates’ Beispiel aus dem 1. Buch von Platons „Staat“1 angeführt. Dort findet sich folgende Situation: Person A hat Person B versprochen, ihr die Waffen zurückzugeben, die diese ihr geliehen hat. Nun ist Person A aber in dem Wissen, dass Person B mit den Waffen Schaden anrichten will – und befindet sich demnach in einem Konflikt: Welche Norm ist nun höher zu achten – die Norm, welche besagt, dass Versprechen gehalten werden müssen, oder aber die, dass man, soweit es in der eigenen Macht steht, andere vor möglichem Schaden schützen soll? Das Problem, das ersichtlich wird, ist das der fehlenden Rangfolge, der fehlenden Hierarchie im Normensystem. Des weiteren führen die Moralphilosophen an, Normen seien im Allgemeinen konservativ und negativ, „nicht bejahend und konstruktiv, nicht schöpferisch und anpassungsfähig an neue Situationen“2.
Inhaltsverzeichnis
- Die Ausgangsfrage
- Teleologische Theorien
- Wessen Wohl soll man fördern?
- Deontologische Theorien
- Ethischer Egoismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die Frage nach der Gültigkeit herrschender Normen als Maßstab für moralisch richtiges und falsches Handeln. Es analysiert teleologische und deontologische Theorien als alternative Konzepte zur Bestimmung von Moralität.
- Die Kritik an herrschenden Normen als alleinigem Moralmaßstab
- Teleologische Ethik und der Fokus auf außermoralische Werte
- Die Frage nach dem zu fördernden Wohl (Individuum vs. Gesellschaft)
- Einführung in den ethischen Egoismus
- Deontologische Ansätze als Gegenposition zu teleologischen Überlegungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Ausgangsfrage: Dieses Kapitel beleuchtet die Unzufriedenheit mit bestehenden Verhaltenskodizes als Ausgangspunkt moralischer Reflexion. Es präsentiert verschiedene Einwände gegen die Verwendung herrschender Normen als alleinige Grundlage für moralische Beurteilung. Diese Einwände umfassen die mangelnde Präzision und Allgemeingültigkeit von Normen, die Möglichkeit von Normenkonflikten (veranschaulicht am Beispiel von Sokrates aus Platons „Staat“), den konservativen Charakter von Normen und ihre kulturelle Relativität. Das Kapitel argumentiert, dass die bloße Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Normen nicht automatisch moralische Richtigkeit impliziert.
Teleologische Theorien: Dieses Kapitel führt in die Grundlagen teleologischer Ethiken ein, die das moralische Urteil auf die Folgen von Handlungen gründen. Es betont den außermoralischen Wert als Ziel, an dem sich teleologische Theorien orientieren (z.B. Glück oder ein gelingendes Leben bei Aristoteles). Eine Handlung ist moralisch richtig, wenn sie ein größeres Übergewicht an guten gegenüber schlechten Konsequenzen erzeugt als jede andere verfügbare Alternative. Die Handlung selbst ist nicht intrinsisch gut oder schlecht, sondern erlangt ihren moralischen Wert durch ihre Folgen. Das Kapitel diskutiert die Uneinigkeit unter Teleologen bezüglich der Frage, wessen Wohl gefördert werden soll: das des Einzelnen (ethischer Egoismus) oder das der Gesellschaft (ethischer Universalismus/Utilitarismus).
2.1. Wessen Wohl soll man fördern?: Dieser Abschnitt befasst sich mit der zentralen Frage innerhalb teleologischer Ethiken, welches Wohl im Fokus der moralischen Bewertung stehen sollte. Er stellt zwei gegensätzliche Positionen dar: den ethischen Egoismus, der das Wohl des Individuums priorisiert, und den ethischen Universalismus/Utilitarismus, der das größtmögliche Glück für alle anstrebt. Während der ethische Egoismus argumentiert, dass eine Person immer das tun sollte, was ihr persönlich den größten Nutzen bringt (Hobbes und Nietzsche als Beispiele), fokussiert der Utilitarismus auf das allgemeine Wohl der Gesellschaft. Der Abschnitt legt die Grundlage für ein tiefergehendes Verständnis der unterschiedlichen Ansätze innerhalb teleologischer Ethiken.
Schlüsselwörter
Deontologische Theorien, Teleologische Theorien, Ethischer Egoismus, Moral, Normen, Ethik, Wert, Konsequenzen, Wohl, Gesellschaft, Individuum, Moralische Beurteilung, Handlung, Konflikt, Universalismus, Utilitarismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Referat: Ethische Theorien - Teleologie und Deontologie
Was ist das Thema des Referats?
Das Referat untersucht die Gültigkeit herrschender Normen als Maßstab für moralisch richtiges und falsches Handeln und analysiert teleologische und deontologische Theorien als alternative Konzepte zur Bestimmung von Moralität.
Welche ethischen Theorien werden behandelt?
Das Referat behandelt hauptsächlich teleologische und deontologische Theorien. Im Detail werden teleologische Ansätze mit dem Fokus auf Konsequenzen und den verschiedenen Konzepten des zu fördernden Wohls (Individuum vs. Gesellschaft) untersucht. Der ethische Egoismus wird als spezielle Form der teleologischen Ethik erläutert. Deontologische Ansätze werden als Gegenposition zu den teleologischen Überlegungen vorgestellt, jedoch ohne detaillierte Erläuterung.
Welche Kritik an herrschenden Normen wird geübt?
Das Referat kritisiert die Verwendung herrschender Normen als alleinige Grundlage für moralische Beurteilung aufgrund von mangelnder Präzision und Allgemeingültigkeit, der Möglichkeit von Normenkonflikten, ihrem konservativen Charakter und ihrer kulturellen Relativität. Die bloße Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Normen impliziert nicht automatisch moralische Richtigkeit.
Was sind teleologische Theorien?
Teleologische Ethiken gründen das moralische Urteil auf die Folgen von Handlungen. Sie orientieren sich an außermoralischen Werten wie Glück oder einem gelingenden Leben. Eine Handlung ist moralisch richtig, wenn sie ein größeres Übergewicht an guten gegenüber schlechten Konsequenzen erzeugt.
Welche zentrale Frage wird innerhalb der teleologischen Ethiken gestellt?
Die zentrale Frage in teleologischen Ethiken ist, wessen Wohl im Fokus der moralischen Bewertung stehen sollte: das des Individuums (ethischer Egoismus) oder das der Gesellschaft (ethischer Universalismus/Utilitarismus).
Was ist ethischer Egoismus?
Ethischer Egoismus besagt, dass eine Person immer das tun sollte, was ihr persönlich den größten Nutzen bringt (Beispiele: Hobbes und Nietzsche).
Was ist der Unterschied zwischen ethischem Egoismus und Utilitarismus?
Ethischer Egoismus priorisiert das Wohl des Individuums, während der Utilitarismus (als Beispiel für ethischen Universalismus) das größtmögliche Glück für alle anstrebt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Referat?
Deontologische Theorien, Teleologische Theorien, Ethischer Egoismus, Moral, Normen, Ethik, Wert, Konsequenzen, Wohl, Gesellschaft, Individuum, Moralische Beurteilung, Handlung, Konflikt, Universalismus, Utilitarismus.
- Quote paper
- Sonja Filip (Author), 2004, Deontologische und teleologische Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35745