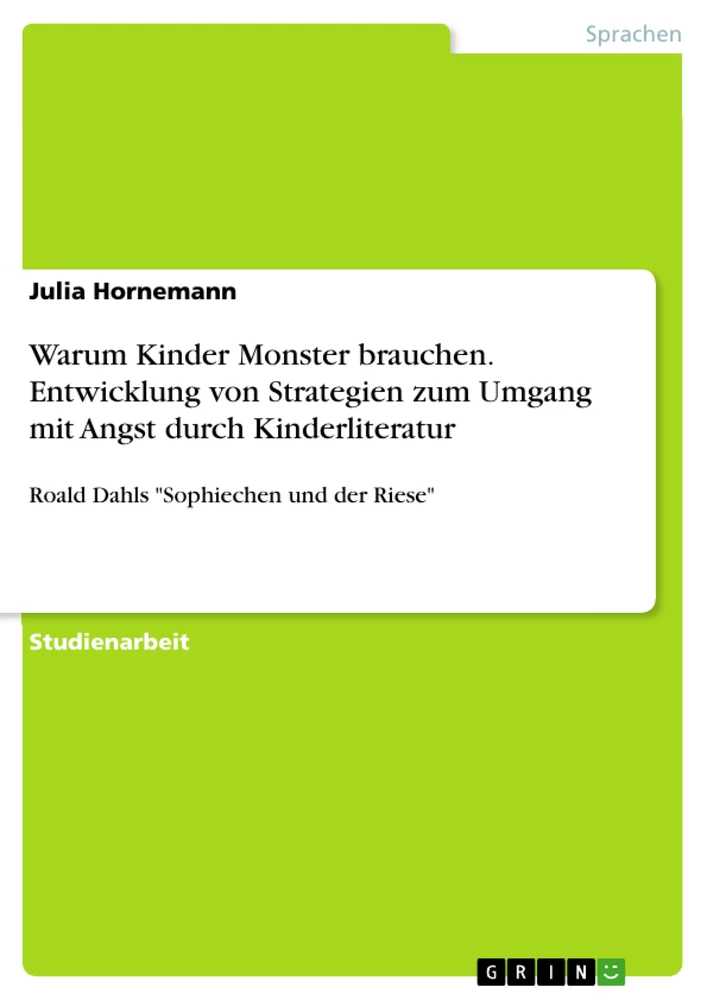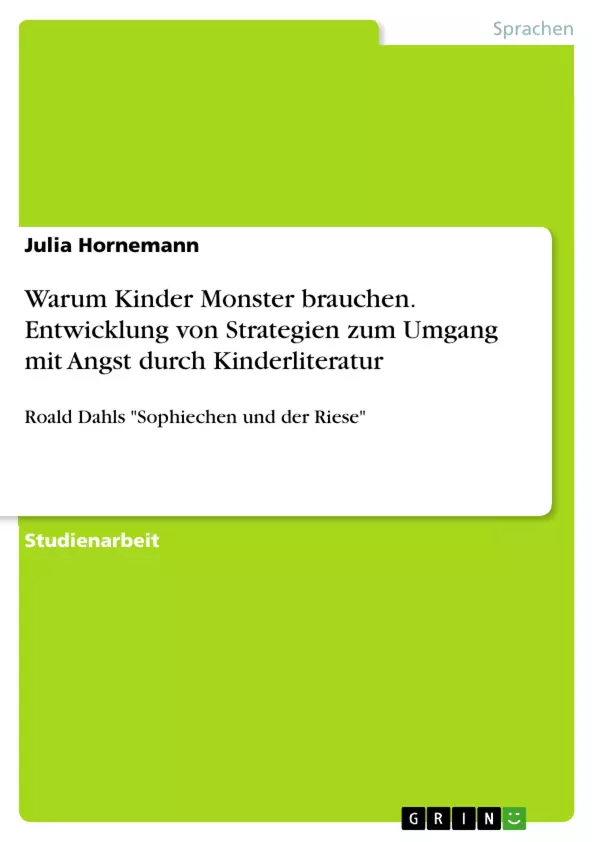Es gibt viele Kinderbücher, die von Monstern und schaurigen Kreaturen handeln. Warum Kinder diese Geschichten so gerne haben und warum Kinder diese Geschichten brauchen, wird in dieser Hausarbeit beschrieben.
Die erfolgreichsten Bücher der Kinder und Jugendliteratur sind spannende Geschichten, die Kinder gruseln, sie den Atem anhalten und staunen lassen. Warum aber gruseln Kinder sich so gerne? Was macht für sie den Reiz aus, sich freiwillig Angstgefühlen auszusetzen?
Die folgende Arbeit befasst sich mit Monstern in Kinderbüchern und mit der Frage, was Kinder während der Auseinandersetzung mit diesen Monstern lernen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Angstbewältigung, welche Strategien mit Ängsten umzugehen erworben werden oder wie Ängste sogar überwunden werden können. Das Ziel dieser Arbeit ist zu zeigen, dass es sinnvoll ist, Kindern Bücher über Monster zur Verfügung zu stellen – nicht um ihre Ängste zu mehren, sondern um ihnen Wege zu zeigen, mit ihren vorhandenen Ängsten umzugehen und diese zu besiegen. Dafür muss zunächst geklärt werden, welche Ängste Kinder empfinden. Je nach Alter der Kinder können diese unterschiedlich sein oder aber anders empfunden werden. Anschließend wird die Lust an der Angst beschrieben, d. h., dass Kinder von sich aus Angst suchen, um sich dieser zu stellen, mit ihr umzugehen und Selbstvertrauen aus der überstandenen Angstsituation zu gewinnen. Warum nicht nur Spiele, sondern auch Bücher für diese Angstlust ein geeignetes Mittel darstellen und sich dazu eignen, Strategien für die Angstbewältigung zu entwickeln, wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.
Schließlich wird an dem Jugendroman "Sophiechen und der Riese" von Roald Dahl anschaulich gemacht, wie genau die Angst vor Monstern, der Sieg über diese Angst und die Stärken, die Kinder aus der literarischen Erfahrung ziehen, in Geschichten funktionieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wovor sich Kinder fürchten
- Schaurig schöne Geschichten – Angstlust
- Wie Geschichten die Angst besiegen
- Sophiechen und der Riese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Monstern in Kinderbüchern und deren Beitrag zur Angstbewältigung bei Kindern. Das Hauptziel ist aufzuzeigen, dass Kinderbücher mit Monstern nicht Ängste verstärken, sondern Kindern Strategien zum Umgang mit und zur Überwindung von Ängsten vermitteln können. Die Arbeit analysiert, welche Ängste Kinder haben, wie die "Angstlust" funktioniert und wie Kinderliteratur dabei helfen kann, diese Ängste zu bewältigen.
- Kindliche Ängste und ihre Entwicklung
- Der Reiz der Angst und die "Angstlust"
- Die Rolle von Kinderliteratur bei der Angstbewältigung
- Strategien zum Umgang mit Angst in Geschichten
- Analyse von Roald Dahls "Sophiechen und der Riese"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung von Monstern in Kinderbüchern für die Entwicklung von Angstbewältigungsstrategien vor. Sie beschreibt den Fokus auf die Angstbewältigung und das Ziel, aufzuzeigen, wie Kinderbücher Kindern helfen können, mit ihren Ängsten umzugehen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die behandelten Aspekte, von der Beschreibung kindlicher Ängste über die Angstlust bis hin zur Analyse von Roald Dahls "Sophiechen und der Riese".
Wovor sich Kinder fürchten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Natur kindlicher Ängste. Es differenziert zwischen Furcht (Realangst) und Angst, wobei die Unschärfe dieser Unterscheidung im Kindesalter hervorgehoben wird. Es werden verschiedene Arten von Kinderängsten, wie Verlustängste, Angst vor dem Unbekannten und soziale Ängste, diskutiert. Das Kapitel betont die Bedeutung des Umgangs mit diesen Ängsten für die kindliche Entwicklung und Selbstfindung. Die Schwierigkeiten, kindliche Ängste zu verstehen und zu artikulieren, werden ebenfalls angesprochen, und es wird darauf hingewiesen, dass rationales Entgegenwirken bei kleineren Kindern oft wirkungslos ist, da die Angst oft ein Symbol für tiefere, unausgesprochene Ängste darstellt.
Schlüsselwörter
Kinderliteratur, Monster, Angst, Angstbewältigung, Strategien, Kinderängste, Entwicklungspsychologie, Roald Dahl, Sophiechen und der Riese, Angstlust, Fantasie, Realität.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Angstbewältigung in Kinderbüchern am Beispiel von "Sophiechen und dem Riesen"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Monstern in Kinderbüchern und deren Beitrag zur Angstbewältigung bei Kindern. Sie analysiert kindliche Ängste, den Aspekt der "Angstlust" und wie Kinderliteratur helfen kann, Ängste zu bewältigen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Roald Dahls "Sophiechen und dem Riesen".
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist aufzuzeigen, dass Kinderbücher mit Monstern nicht Ängste verstärken, sondern Kindern Strategien zum Umgang mit und zur Überwindung von Ängsten vermitteln können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt kindliche Ängste und ihre Entwicklung, den Reiz der Angst und die "Angstlust", die Rolle von Kinderliteratur bei der Angstbewältigung, Strategien zum Umgang mit Angst in Geschichten und eine Analyse von Roald Dahls "Sophiechen und dem Riesen".
Welche Arten von Kinderängsten werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Arten von Kinderängsten, wie Verlustängste, Angst vor dem Unbekannten und soziale Ängste. Sie betont die Bedeutung des Umgangs mit diesen Ängsten für die kindliche Entwicklung und Selbstfindung.
Wie wird die "Angstlust" erklärt?
Die Arbeit beleuchtet den Reiz der Angst und den Aspekt der "Angstlust", also das Vergnügen, das Kinder am Erleben von Angst in geschützten Kontexten haben können.
Welche Rolle spielt Kinderliteratur bei der Angstbewältigung?
Die Arbeit argumentiert, dass Kinderliteratur, insbesondere Geschichten mit Monstern, Kindern Strategien vermitteln kann, um mit ihren Ängsten umzugehen und diese zu überwinden.
Wie wird Roald Dahls "Sophiechen und der Riese" in die Analyse einbezogen?
Roald Dahls "Sophiechen und der Riese" dient als Fallbeispiel zur Analyse, wie Kinderbücher Strategien zur Angstbewältigung vermitteln können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderliteratur, Monster, Angst, Angstbewältigung, Strategien, Kinderängste, Entwicklungspsychologie, Roald Dahl, Sophiechen und der Riese, Angstlust, Fantasie, Realität.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu kindlichen Ängsten, Angstlust, der Rolle der Kinderliteratur, eine detaillierte Analyse von "Sophiechen und dem Riesen" und ein Fazit.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Kinderbücher mit Monstern nicht nur unterhaltsam sind, sondern auch eine wichtige Funktion bei der Entwicklung von Angstbewältigungsstrategien bei Kindern einnehmen.
- Arbeit zitieren
- Julia Hornemann (Autor:in), 2016, Warum Kinder Monster brauchen. Entwicklung von Strategien zum Umgang mit Angst durch Kinderliteratur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358156