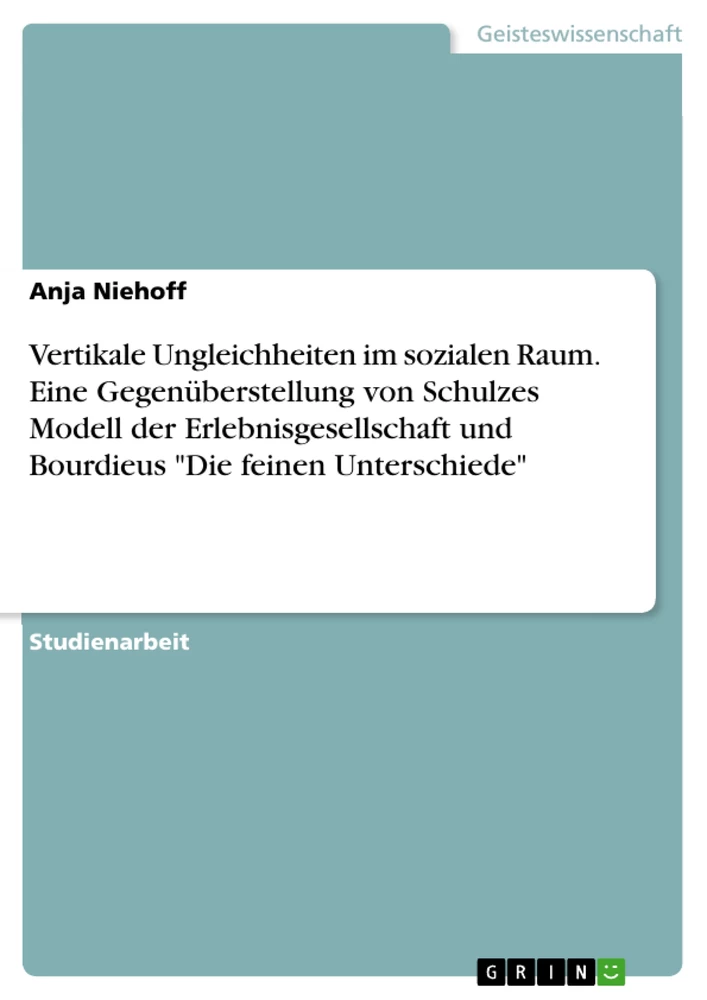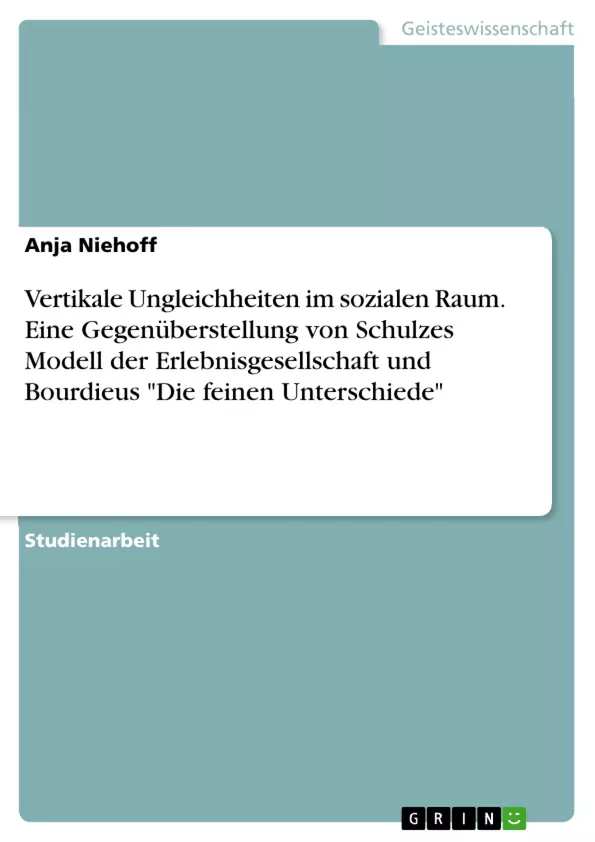In dieser Arbeit werden zunächst die beiden Lebensstilkonzepte in Gerhard Schulzes Modell der Erlebnisgesellschaft und in Pierre Bourdieus Werk "Die feinen Unterschiede" in den für die Vergleichsforschung relevanten Aspekten beleuchtet. In diesem Zusammenhang werden zentrale Begriffe der beiden Theorien erläutert, um anschließend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze herauszuarbeiten.
Nach dieser Gegenüberstellung bezieht die Arbeit die diskutierten Theorien noch auf die aktuelle Situation und fragt, ob Schulze mit seiner Prognose für die Zukunft der Milieustrukturen Recht behalten hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Pierre Bourdieu und sein Werk „Die feinen Unterschiede“
- 2.1 Der „Habitus“ und der „soziale Raum“
- 2.2 Kapital bei Bourdieu
- 2.2.1 Ökonomisches Kapital
- 2.2.2 Kulturelles Kapital
- 2.2.3 Soziales Kapital
- 2.3 „Die feinen Unterschiede“ im Geschmack
- 3 Gerhard Schulzes Modell der „Erlebnisgesellschaft“
- 3.1 Alltagsästhetische Schemata
- 3.2 Fünf Milieubeschreibungen
- 3.2.1 Niveaumilieu
- 3.2.2 Harmoniemilieu
- 3.2.3 Integrationsmilieu
- 3.2.4 Selbstverwirklichungsmilieu
- 3.2.5 Unterhaltungsmilieu
- 4 Diskussion: Was verbindet bzw. unterscheidet die dargestellten Theorien?
- 5 Hat Schulzes Entvertikalisierungsthese Bestand?
- 5.1 Wertewandel als „Ventilfunktion“
- 5.2 Entvertikalisierung oder doppelte Vertikalisierung?
- 6 Zum Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von Pierre Bourdieu ("Die feinen Unterschiede") und Gerhard Schulze ("Die Erlebnisgesellschaft") zur sozialen Ungleichheit. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Theorien herauszuarbeiten und die These von Schulzes Entvertikalisierung der Gesellschaft zu diskutieren.
- Vergleich der Konzepte von Bourdieu und Schulze zur sozialen Ungleichheit
- Analyse des Kapitalbegriffs bei Bourdieu (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital)
- Untersuchung des Habitus und des sozialen Raums nach Bourdieu
- Bewertung der "Erlebnisgesellschaft" und ihrer Milieustrukturen nach Schulze
- Diskussion der Entvertikalisierungsthese und ihrer Gültigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Wandel in der Ungleichheitsforschung, vom Fokus auf Lebensstile und Milieus in den 1980er und 90er Jahren zurück zu einer verstärkten Betrachtung vertikaler Ungleichheiten. Sie führt die zentralen Werke von Bourdieu und Schulze ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit: einen Vergleich beider Theorien und eine kritische Auseinandersetzung mit der Entvertikalisierungsthese. Die wiederkehrende Bedeutung sozialer Ungleichheit trotz Wohlstandszunahme und Bildungsexpansion wird hervorgehoben, unter Bezugnahme auf den "Fahrstuhleffekt" von Ulrich Beck.
2 Pierre Bourdieu und sein Werk „Die feinen Unterschiede“: Dieses Kapitel beschreibt Bourdieus Konzept des Geschmacks als gesellschaftliches Phänomen, verknüpft mit sozialem Raum, Herkunft und Habitus. Es werden die drei Geschmacksdimensionen (legitim, mittel, populär) eingeführt, bevor die zentralen Begriffe "sozialer Raum" und "Habitus" sowie die Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) erläutert werden. Bourdieus These von der Reproduktion von Klassenstrukturen durch den Kampf um kulturelle Distinktion wird vorgestellt, wobei die ästhetische Dimension als Instrument der Abgrenzung eine wichtige Rolle spielt. Das Kapitel betont die Erweiterung des Kapitalbegriffs über die reine ökonomische Perspektive hinaus.
3 Gerhard Schulzes Modell der „Erlebnisgesellschaft“: Dieses Kapitel stellt Schulzes Modell der Erlebnisgesellschaft dar, welches im Kontrast zu Bourdieus Theorie steht. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der alltagsästhetischen Schemata und der fünf Milieubeschreibungen (Niveaumilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu, Selbstverwirklichungsmilieu, Unterhaltungsmilieu). Es wird die These der Entstrukturierung der Klassengesellschaft durch eine Pluralisierung der Lebensstile und Formen kulturellen Kapitals behandelt. Die Kapitelzusammenfassung würde die verschiedenen Milieus und ihre Charakteristika detailliert beschreiben und die implizierten Veränderungen in der sozialen Strukturierung analysieren.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Vertikale Ungleichheit, Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede, Habitus, Sozialer Raum, Kapital (ökonomisch, kulturell, sozial), Gerhard Schulze, Erlebnisgesellschaft, Lebensstile, Milieus, Entvertikalisierung, Wertewandel, Distinktion, Klassenstrukturen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Bourdieu und Schulze zur sozialen Ungleichheit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Theorien von Pierre Bourdieu ("Die feinen Unterschiede") und Gerhard Schulze ("Die Erlebnisgesellschaft") zur sozialen Ungleichheit. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze und diskutiert kritisch Schulzes These von der Entvertikalisierung der Gesellschaft.
Welche Theorien werden verglichen?
Im Mittelpunkt stehen Pierre Bourdieus Konzept des sozialen Raums, des Habitus und der verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) sowie Gerhard Schulzes Modell der Erlebnisgesellschaft mit ihren fünf Milieubeschreibungen (Niveaumilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu, Selbstverwirklichungsmilieu, Unterhaltungsmilieu).
Was ist Bourdieus Kernaussage?
Bourdieu argumentiert, dass soziale Ungleichheit durch den "Kampf um kulturelle Distinktion" reproduziert wird. Geschmack, Habitus und die verschiedenen Kapitalformen prägen die soziale Position und beeinflussen den Zugang zu Ressourcen und Macht.
Was ist Schulzes Kernaussage?
Schulze beschreibt eine "Erlebnisgesellschaft", in der die Klassengesellschaft durch eine Pluralisierung von Lebensstilen und kulturellen Kapitalformen entstrukturiert wird. Seine Entvertikalisierungsthese postuliert einen Wandel in der sozialen Strukturierung.
Wie werden Bourdieu und Schulze verglichen?
Die Arbeit analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Theorien hinsichtlich ihrer Erklärungen sozialer Ungleichheit. Dabei wird insbesondere der Umgang mit dem Konzept des Kapitals und der Frage nach der Strukturierung der Gesellschaft untersucht.
Was ist der Habitus nach Bourdieu?
Der Habitus beschreibt bei Bourdieu ein System dauerhafter, inkorporierter Dispositionen, die das Handeln und Denken von Individuen prägen. Er ist Ergebnis sozialer Herkunft und beeinflusst den Geschmack und die Lebensführung.
Was sind die Kapitalformen bei Bourdieu?
Bourdieu unterscheidet ökonomisches Kapital (wirtschaftliche Ressourcen), kulturelles Kapital (Bildung, Wissen) und soziales Kapital (Netzwerke). Diese Kapitalformen wirken zusammen und beeinflussen die soziale Position eines Individuums.
Was sind die Milieus nach Schulze?
Schulze beschreibt fünf Milieus in der Erlebnisgesellschaft, die sich durch unterschiedliche Lebensstile und Werte auszeichnen: Niveaumilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu, Selbstverwirklichungsmilieu und Unterhaltungsmilieu. Diese Milieus spiegeln unterschiedliche Formen der Alltagsästhetik wider.
Was ist die Entvertikalisierungsthese von Schulze?
Schulzes Entvertikalisierungsthese besagt, dass die klassische vertikale Klassengesellschaft durch eine Pluralisierung von Lebensstilen und eine zunehmende Individualisierung entstrukturiert wird. Die Arbeit diskutiert die Gültigkeit dieser These.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe sind soziale Ungleichheit, vertikale Ungleichheit, Habitus, sozialer Raum, ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital, Erlebnisgesellschaft, Lebensstile, Milieus, Entvertikalisierung, Wertewandel und Distinktion.
- Citation du texte
- Anja Niehoff (Auteur), 2016, Vertikale Ungleichheiten im sozialen Raum. Eine Gegenüberstellung von Schulzes Modell der Erlebnisgesellschaft und Bourdieus "Die feinen Unterschiede", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358165