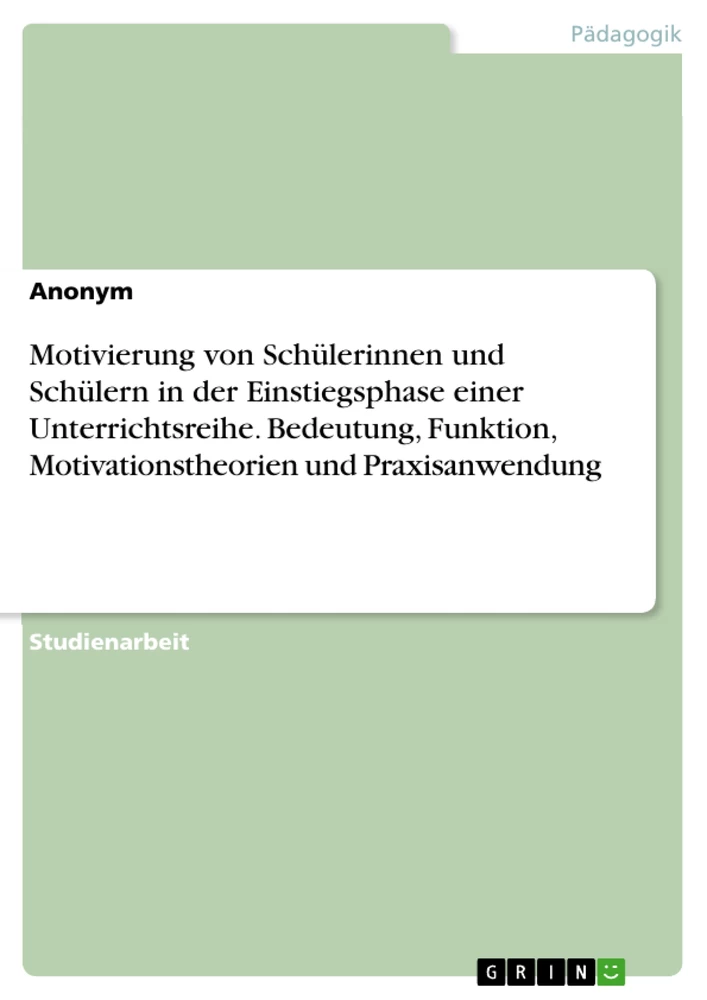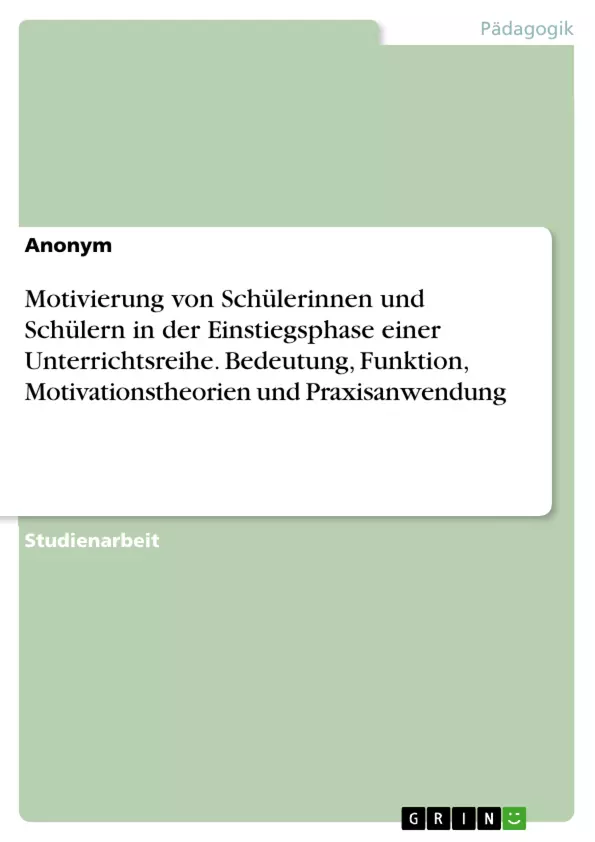In dieser Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung gerade die Einstiegsphase als diejenige Phase des Unterrichts hat, in der ein neues Thema eingeführt werden und vorbereitet werden soll. Das heißt, es sollen mit dieser Phase inhaltlich die Grundlagen geschaffen werden, die zu bearbeitenden Aufgaben und die zu diesem Thema zu schreibende Klassenarbeit möglichst gut zu bewältigen. Je besser diese Einstiegsphase die Schülerinnen und Schüler inhaltlich auf den Rest der Unterrichtsreihe vorbereitet, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese die bearbeitenden Aufgaben möglichst gut bewältigen werden. Gleiches gilt dabei neben der inhaltlichen Vorbereitung für das methodische Vorgehen. Die Methoden für den Unterrichtseinstieg sollten so gewählt werden, dass die Lehrkraft nicht nur die erforderlichen Informationen vermittelt, sondern sie sollen den Schülerinnen und Schülern auch einen Grund geben, sich diese Lerninhalte anzueignen und sie anzuwenden. Eben dazu sollten sie von der Lehrkraft motiviert werden.
Im ersten Kapitel wird daher zunächst auf die Einstiegsphase und deren Funktion eingegangen. Im zweiten Kapitel werden zwei für die schulische Praxis relevante Motivationstheorien vorgestellt. Im dritten Kapitel wird dann genauer auf zwei Methoden für die Einstiegsphase eingegangen und diese schließlich vor dem Hintergrund der in Kapitel zwei vorgestellten Motivationstheorien untersucht.
Welche Bedeutung kommt der Einstiegsphase für die Motivierung von Schülerinnen und Schülern zu? Mit der Einstiegsphase beginnt ein neues Unterrichtsthema und die Motivierung der Schülerinnen und Schüler soll zu einer möglichst hohen Lernleistung führen. Da gerade jüngere Schülerinnen und Schüler häufig noch nicht die erforderliche Reife erlangt haben, sich selbst zu motivieren, ist es wichtig, dass die Lehrkräfte in dieser Hinsicht unterstützen und somit möglichst gute Grundlagen für den Lernerfolg schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einstiegsphase
- Funktionen der Einstiegsphase
- Methoden für die Einstiegsphase
- Der informierende Einstieg
- Der stumme Impuls
- Motivation im schulpraktischen Kontext
- Motivationstheorien im schulpraktischen Kontext
- Operante Konditionierung
- Humanistische Psychologie
- Motivierung in der Einstiegsphase
- Formen und Möglichkeiten der Motivierung in der Einstiegsphase
- Informierender Einstieg
- Stummer Impuls
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung der Einstiegsphase im Unterricht für die Motivierung von Schülerinnen und Schülern. Sie analysiert die Funktionen der Einstiegsphase und stellt zwei relevante Methoden für die Einstiegsphase vor: den informierenden Einstieg und den stummen Impuls. Die Arbeit betrachtet diese Methoden im Kontext von Motivationstheorien und untersucht, inwieweit sie die Motivation von Schülerinnen und Schülern fördern können.
- Die Rolle der Einstiegsphase in der Unterrichtsgestaltung
- Funktionen der Einstiegsphase: Neugier wecken, Interesse erzeugen, Verantwortungsbereitschaft fördern
- Relevante Motivationstheorien im schulpraktischen Kontext
- Analyse des informierenden Einstiegs und des stummen Impulses hinsichtlich ihrer motivationalen Effekte
- Bedeutung von Transparenz und Eigenständigkeit im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung der Einstiegsphase für die Motivierung von Schülerinnen und Schülern. Das erste Kapitel analysiert die Funktionen der Einstiegsphase im Unterricht und beschreibt die Bedeutung von Neugier, Interesse und Verantwortungsbereitschaft. Das zweite Kapitel stellt zwei wichtige Motivationstheorien im schulpraktischen Kontext vor: die operante Konditionierung und die humanistische Psychologie. Das dritte Kapitel untersucht zwei konkrete Methoden für die Einstiegsphase: den informierenden Einstieg und den stummen Impuls. Es analysiert, inwieweit diese Methoden die Funktionen der Einstiegsphase erfüllen und auf welche Weise sie die Motivation von Schülerinnen und Schülern beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Einstiegsphase, Motivation, Motivationstheorien, Operante Konditionierung, Humanistische Psychologie, Unterrichtseinstieg, Informierender Einstieg, Stummer Impuls, Lernmotivation, Schulpraktischer Kontext, Transparenz, Eigenständigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Einstiegsphase im Unterricht so wichtig?
Sie schafft die inhaltlichen und methodischen Grundlagen für eine Unterrichtsreihe und ist entscheidend für die Motivierung der Schüler, sich neues Wissen anzueignen.
Was ist ein „informierender Unterrichtseinstieg“?
Dabei legt die Lehrkraft die Ziele und den Ablauf der Stunde offen, um Transparenz zu schaffen und den Schülern Orientierung zu bieten.
Wie funktioniert die Methode des „stummen Impulses“?
Die Lehrkraft präsentiert ein Medium (Bild, Gegenstand) ohne Worte, um Neugier zu wecken und Schüler zu eigenen Hypothesen und Äußerungen anzuregen.
Welche Motivationstheorien sind für die Schule relevant?
Die Arbeit beleuchtet die operante Konditionierung (Lernen durch Verstärkung) und die humanistische Psychologie (Fokus auf Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit).
Wie können Lehrkräfte die Selbstmotivation fördern?
Indem sie in der Einstiegsphase Verantwortungsbereitschaft wecken und den Schülern den Sinn und Nutzen der Lerninhalte verdeutlichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Motivierung von Schülerinnen und Schülern in der Einstiegsphase einer Unterrichtsreihe. Bedeutung, Funktion, Motivationstheorien und Praxisanwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358178