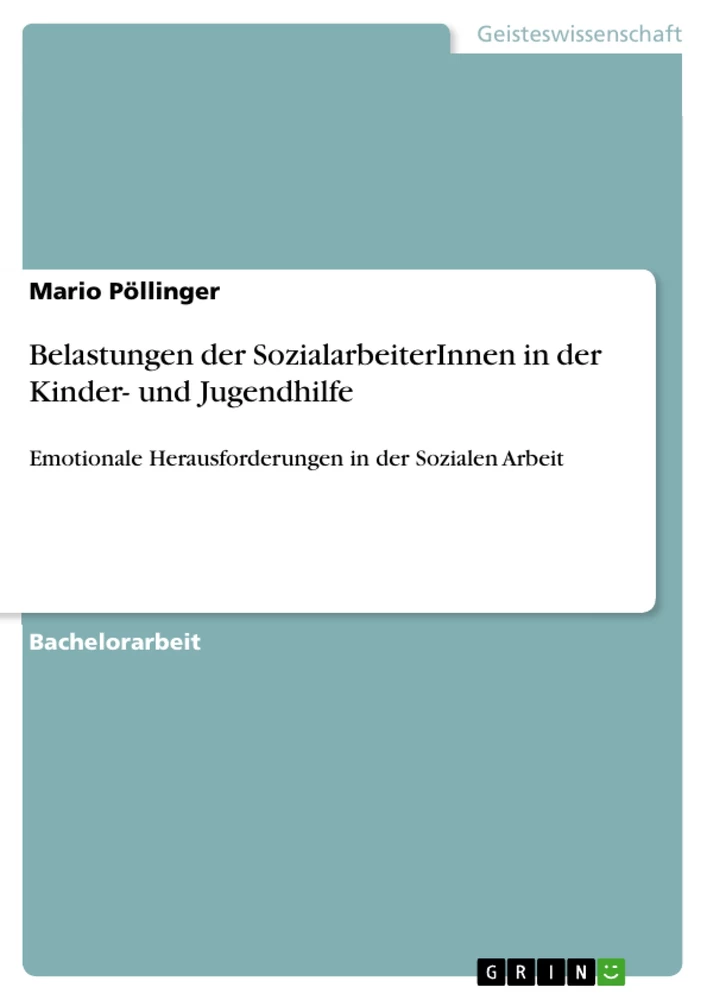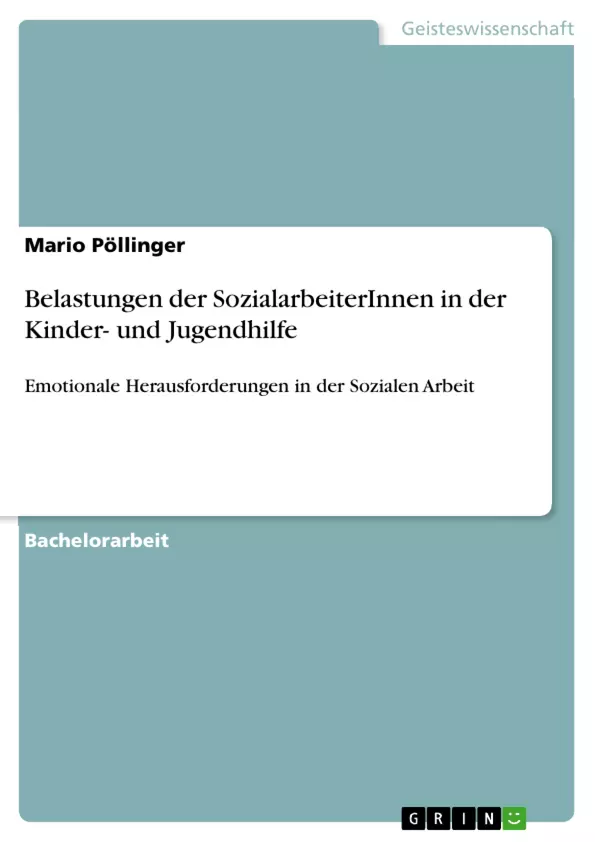Praxisbezogen geht dieses Buch auf die Belastungen und Haftungen der SozialarbeiterInnen ein.
Dabei werden im ersten Teil dieser Arbeit die Arbeitssituation und die daraus resultierenden Belastungen der MitarbeiterInnen der KJHT beschreiben. Zusätzlich wird ein Fall von strafrechtlicher Verfolgung aufgerollt und dargestellt.
Im zweiten Teil dieser Abhandlung beschreibe ich, was ein drohendes Strafverfahren auf psychischer, beruflicher und privater Ebene mit SozialarbeiterInnen macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Arbeitssituation Soziale Arbeit
- 1.1. Interkulturalität
- 1.2. Fachkräftemangel
- 1.3. Politische Einflussnahme
- 1.4. Ökonomisierung
- 1.5. Psychische Erkrankungen
- 2. Fall aus der Praxis
- 2.1. Fallbeschreibung
- 2.2. Umgang der Behörden mit den Betroffenen
- 2.2.1. Umgang des ehemaligen Dienstgebers
- 2.2.1.1. Emotionale Belastung der MitarbeiterInnen in dieser Phase
- 2.2.2. Umgang der Strafverfolgungsbehörden mit den Beschuldigten
- 2.2.2.1. Emotionale Belastung der MitarbeiterInnen in dieser Phase
- 2.3. Ausgang der Ermittlungen
- 2.3.1. Emotionale Belastungen der MitarbeiterInnen in dieser Phase
- 3. Interview mit Angehöriger
- 4. Interview mit Sozialarbeiterin
- 5. Psychische Auswirkungen der Belastungen
- 5.1. Angststörungen
- 5.1.1. Gründe für Angststörungen
- 5.1.2. Therapiemöglichkeiten von Angstzuständen
- 5.2. Schlafstörungen
- 5.2.1. Diagnostik von Schlafstörungen
- 5.2.2. Therapiemöglichkeiten von Schlafstörungen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Belastungen von SozialarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere im Kontext strafrechtlicher Untersuchungen. Die Arbeit analysiert die Arbeitsbedingungen und die daraus resultierenden Belastungen, die zu emotionalen und psychischen Problemen führen können.
- Arbeitssituation in der Kinder- und Jugendhilfe
- Fallbeispiel einer strafrechtlichen Verfolgung
- Psychische Auswirkungen von Belastungen
- Angststörungen und Schlafstörungen als häufige Folgen
- Therapiemöglichkeiten bei psychischen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Arbeitsbedingungen von SozialarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Herausforderungen durch Interkulturalität, Fachkräftemangel, politische Einflussnahme, Ökonomisierung und psychische Erkrankungen.
Kapitel 2 präsentiert einen Fall aus der Praxis, in dem ein Sozialarbeiter strafrechtlich verfolgt wird. Es werden die Reaktionen der Behörden, des ehemaligen Arbeitgebers und die emotionalen Belastungen des Sozialarbeiters während des Verfahrens dargestellt.
Kapitel 3 und 4 enthalten Interviews mit einer Angehörigen und einer Sozialarbeiterin, die Einblicke in die persönlichen Erfahrungen und Perspektiven auf die Belastungen geben.
Kapitel 5 untersucht die psychischen Auswirkungen der Belastungen, insbesondere Angststörungen und Schlafstörungen. Es werden die Gründe für diese Probleme sowie die Therapiemöglichkeiten erläutert.
Schlüsselwörter
Emotion, Haftung, psychische Erkrankung, Belastung, Strafverfahren, Kinder- und Jugendhilfe, Sozialarbeit, Angststörungen, Schlafstörungen, Therapiemöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Belastungen sind Sozialarbeiter in der Jugendhilfe ausgesetzt?
Sie kämpfen mit Fachkräftemangel, politischer Einflussnahme, Ökonomisierung des Sektors und zunehmenden psychischen Erkrankungen.
Wie wirkt sich ein drohendes Strafverfahren auf Sozialarbeiter aus?
Es führt zu massiven psychischen Belastungen, Angststörungen und Schlafstörungen, die oft auch das Privatleben und die berufliche Existenz bedrohen.
Warum kommt es in der Sozialen Arbeit zu strafrechtlicher Verfolgung?
Oft geht es um Haftungsfragen bei Kindeswohlgefährdung, wenn Entscheidungen der Behörden im Nachhinein gerichtlich überprüft werden.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei arbeitsbedingten Angststörungen?
Die Arbeit nennt psychotherapeutische Ansätze und Beratungsangebote, um die emotionalen Folgen von Überlastung und Strafverfahren zu bewältigen.
Wie gehen Dienstgeber mit beschuldigten Mitarbeitern um?
Ein Fallbeispiel zeigt, dass der Umgang oft von Distanzierung geprägt ist, was die emotionale Belastung der betroffenen Sozialarbeiter zusätzlich verschärft.
- Quote paper
- Mario Pöllinger (Author), 2017, Belastungen der SozialarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358302