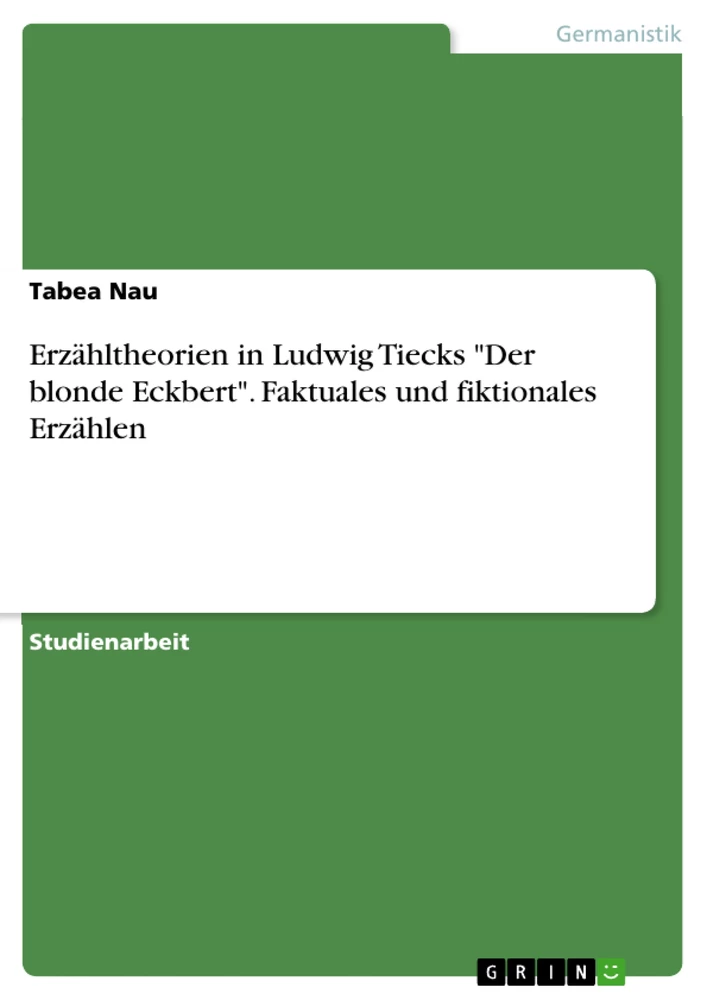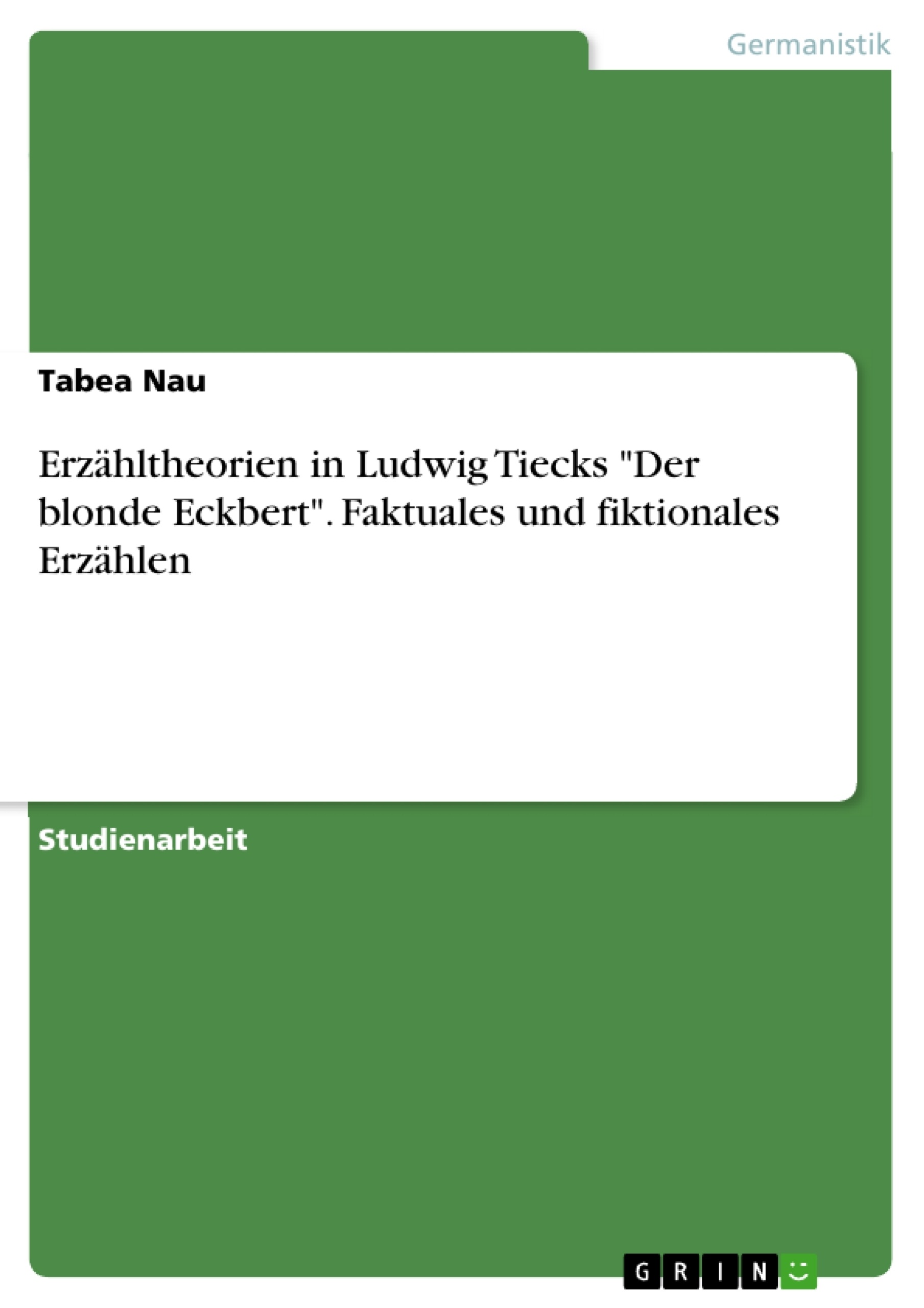Ludwig Tieck (31.05.1773-28.04.1853) war nicht nur ein Schriftsteller der romantischen Bewegung, er arbeitete auch als Herausgeber und Sammler von Literatur und als Übersetzer. So führte er beispielsweise A.W. Schlegels Shakespeare-Übersetzungen (1825-33) fort. Zudem gehörte er dem Künstlerkreis der Jenaer Frühromantik an. Genau in dieser Zeit – um 1800 – entstand auch das Märchen Der blonde Eckbert. Während meiner Recherche zu dieser Arbeit sind mir zahlreiche Interpretationen des blonden Eckberts, sowie Ansätze zur Beantwortung der Gattungsfrage ins Auge gefallen. Mein Interesse gilt jedoch der Erzählstruktur des als Kunstmärchen ausgewiesenen Textes. Deshalb möchte ich hauptsächlich auf die erzähltheoretische Analyse eingehen, wobei ich mich ausschließlich an Matías Martínez und Michael Scheffel – Einführung in die Erzähltheorie – orientieren werde.
„Im Gegensatz zu anderen Überblicksdarstellungen der Erzähltheorie leitet [dieses Buch] zentrale Komponenten literarischen Erzählens aus dem Grundphänomen der Fiktionalität ab und umfasst sowohl das ›Wie‹ als auch das ›Was‹ von Erzählungen.“
Zunächst werde ich den Begriff des Erzählens erläutern um auf das faktuale und fiktionale Erzählen einzugehen und um aufzuzeigen, welche Art des Erzählens im blonden Eckbert angewendet wurde. Es folgt das Kapitel der Zeitverhältnisse, das von Gérard Genette begründet ist und von Martínez und Scheffel aufgegriffen wird. Es setzt sich hauptsächlich mit drei Leitfragen auseinander, nämlich:
1. Welcher Reihenfolge geht die Erzählung nach (Ordnung/Reihenfolge),
2. Über welchen Zeitraum werden die Geschehnisse einer Erzählung geschildert (Dauer) und
3. Wie oft wird wiederholendes oder nichtwiederholendes Geschehen in einer Erzählung präsentiert (Frequenz).
Abschließend werde ich auf den Modus eingehen, der in Distanz und Fokalisierung unterteilt wird.
Auf Grund des vorgegebenen Rahmens dieser Hausarbeit werde ich mich ausschließlich auf die oben genannten Themen fokussieren und die interpretativen Ansätze dieses Märchens auslassen. Bezogen auf Martínez und Scheffel bedeutet das, dass ich mich überwiegend mit dem Wie beschäftigen und das Was eher außer Acht lassen werde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Faktuales vs. Fiktionales Erzählen
- Zeitverhältnisse
- Ordnung/Reihenfolge
- Dauer/Erzähltempo
- Frequenz
- Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Fazit
- Anhang
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der erzähltheoretischen Analyse von Ludwig Tiecks „Der blonde Eckbert“. Das Ziel ist es, die Erzählstruktur des Märchens anhand der Theorien von Matías Martínez und Michael Scheffel zu beleuchten.
- Unterscheidung zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen
- Analyse der Zeitverhältnisse in Bezug auf Ordnung, Dauer und Frequenz
- Untersuchung des Erzählmodus in Bezug auf Distanz und Fokalisierung
- Die Rolle der Rahmen- und Binnenhandlung in Tiecks Erzählung
- Das Zusammenspiel von Fiktion und Authentizität im romantischen Erzählen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Ludwig Tieck als Vertreter der romantischen Bewegung vor und erläutert den Fokus der Arbeit auf die erzähltheoretische Analyse von „Der blonde Eckbert“. Das erste Kapitel untersucht die Unterscheidung zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen und stellt die Verwendung einer Als-Ob-Struktur im Text heraus. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Zeitverhältnissen und untersucht die chronologische Ordnung, die durch Anachronien unterbrochen wird. Die Analyse der Ordnung/Reihenfolge untersucht die Rahmen- und Binnenhandlung des Textes. Der dritte Teil analysiert den Modus der Erzählung und die damit verbundenen Aspekte der Distanz und Fokalisierung.
Schlüsselwörter
Erzähltheorie, Ludwig Tieck, „Der blonde Eckbert“, Kunstmärchen, faktuales Erzählen, fiktionales Erzählen, Zeitverhältnisse, Ordnung, Dauer, Frequenz, Modus, Distanz, Fokalisierung, Rahmenhandlung, Binnenhandlung, Anachronie, Analepse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen bei Tieck?
Die Arbeit untersucht, wie Ludwig Tieck in „Der blonde Eckbert“ eine „Als-Ob-Struktur“ nutzt, um zwischen fiktionalen Elementen und einer scheinbaren Authentizität zu balancieren.
Welche Rolle spielen die Zeitverhältnisse in der Erzähltheorie des Textes?
Die Analyse konzentriert sich auf Ordnung, Dauer und Frequenz. Dabei wird untersucht, wie die chronologische Reihenfolge durch Anachronien wie Analepsen (Rückblenden) unterbrochen wird.
Was versteht man unter dem Begriff „Modus“ in dieser Analyse?
Der Modus unterteilt sich in Distanz und Fokalisierung. Es wird analysiert, aus welcher Perspektive erzählt wird und wie nah der Erzähler am Geschehen ist.
Wie sind Rahmen- und Binnenhandlung im „blonden Eckbert“ verknüpft?
Die Arbeit analysiert die Struktur der Erzählung, bei der eine Geschichte innerhalb einer Geschichte (Binnenhandlung) eingebettet ist, und wie dies die erzählerische Ordnung beeinflusst.
An welchen Theoretikern orientiert sich die Arbeit?
Die Analyse stützt sich primär auf die Einführung in die Erzähltheorie von Matías Martínez und Michael Scheffel sowie auf die Zeit-Theorien von Gérard Genette.
- Quote paper
- Tabea Nau (Author), 2017, Erzähltheorien in Ludwig Tiecks "Der blonde Eckbert". Faktuales und fiktionales Erzählen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358376