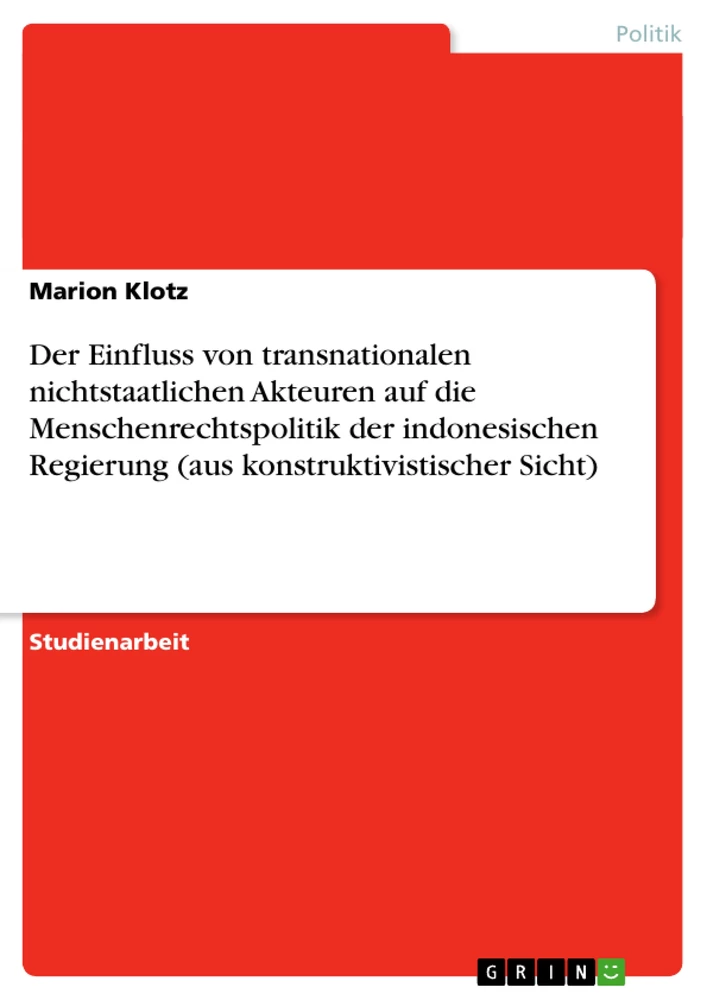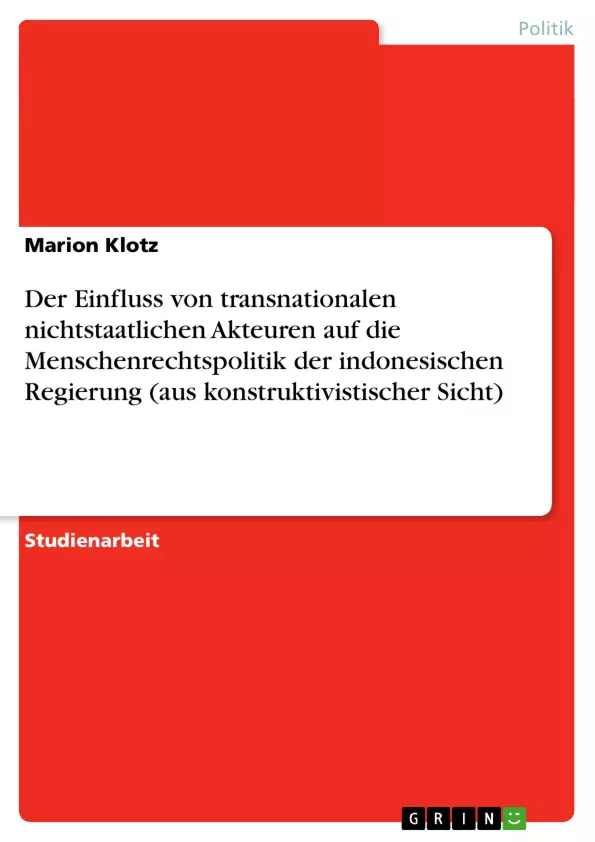Seit der Entlassung Osttimors in die Unabhängigkeit ist Indonesien in Sachen Menschenrechtspolitik aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit verschwunden. Dabei ist leider nicht davon auszugehen, dass die indonesische Demokratie sich vollständig stabilisiert hat und dass die Menschenrechtsverletzungen ein Ende gefunden haben. Trotz allem hat die Inselgruppe in den letzten 15 Jahren enorme Fortschritte von einem totalitären Staat zu einer mehr oder minder stabilen Demokratie gemacht (vgl. ai 2004: 1). In der vorliegenden Arbeit werde ich diesen Prozess des Menschenrechtswandels in Indonesien näher beleuchten und dabei mit Hilfe eines konstruktivistischen Ansatzes vor allem die Frage behandeln, welche Rolle internationale nichtstaatliche Organisationen innerhalb dieses Prozesses gespielt haben. Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil stelle ich die Theorie vor, mit der ich in der Folge arbeite: Den Konstruktivismus. In Folge des begrenzten Rahmens dieser Arbeit konzentriere ich mich hier auf die Hauptthesen, liefere also nur einen mehr oder weniger groben Überblick. Als Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen gehe ich dabei zuerst auf das konstruktivistische Verständnis vom Individuum und dessen Verhältnis zur Gesellschaft ein. Danach behandele ich kurz das konstruktivistische Bild vom Staat und der Beziehung der Staaten untereinander, um mich dann mit einem der wichtigsten Aspekte für das Verständnis d ieser Arbeit, der Rolle von nichtstaatlichen Akteuren im internationalen System, zu befassen. Im zweiten Teil konzentriere ich mich dann auf die empirische Analyse der Fragestellung. Hierbei lehne ich mich an das Spiralmodell des Menschenrechtswandels von Risse et al an und vergleiche es mit den tatsächlichen Vorgängen in Indonesien. Die Unterteilung in fünf Kapitel entspricht der Einteilung des Spiralmodells in verschiedene Phasen. Am Ende jedes Kapitels ziehe ich ein kurzes Resümee bezüglich der Anwendbarkeit des Modells in der untersuchten Phase. Im letzten Teil meiner Arbeit fasse ich die Hauptargumente der beiden vorangehenden Kapitel zusammen und beurteile kurz die Anwendbarkeit der konstruktivistischen Theorie auf die hier behandelte Fragestellung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlage: Der Konstruktivismus
- Das Verhältnis vom Individuum zur Gesellschaft
- Staat und Staatensystem
- Nichtstaatliche Akteure
- Empirische Analyse: Ein Spiralmodell des Menschenrechtswandels
- Erste Phase: Repression
- Zweite Phase: Leugnen
- Dritte Phase: Taktische Konzessionen
- Vierte Phase: Präskriptiver Status
- Fünfte Phase: Normengeleitetes Verhalten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Prozess des Menschenrechtswandels in Indonesien und untersucht dabei die Rolle internationaler nichtstaatlicher Organisationen innerhalb dieses Prozesses. Der Fokus liegt auf der Anwendung des konstruktivistischen Ansatzes zur Analyse der Dynamik des Menschenrechtswandels.
- Der Einfluss von internationalen nichtstaatlichen Akteuren auf die Menschenrechtspolitik der indonesischen Regierung
- Die Relevanz des konstruktivistischen Ansatzes für die Analyse des Menschenrechtswandels
- Die Anwendung des Spiralmodells des Menschenrechtswandels auf den Fall Indonesien
- Die Bedeutung sozialer Normen und Identitätsbildung im Kontext des Menschenrechtswandels
- Die Rolle von Macht und Interessen im internationalen System
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Struktur der Arbeit dar. Der Fokus liegt auf den Menschenrechtsverletzungen in Indonesien und der Frage, welche Rolle nichtstaatliche Akteure bei der Veränderung der Menschenrechtspolitik spielen.
- Theoretische Grundlage: Der Konstruktivismus: Dieses Kapitel erläutert die zentralen Thesen des Konstruktivismus. Es werden die konstruktivistischen Ansichten zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Staat und Staatensystem sowie die Rolle nichtstaatlicher Akteure im internationalen System beleuchtet.
- Empirische Analyse: Ein Spiralmodell des Menschenrechtswandels: Das Kapitel analysiert den Menschenrechtswandel in Indonesien anhand des Spiralmodells von Risse et al. Die fünf Phasen des Modells (Repression, Leugnen, taktische Konzessionen, präskriptiver Status und normengeleitetes Verhalten) werden auf die indonesische Situation angewandt.
Schlüsselwörter
Menschenrechtswandel, Indonesien, Konstruktivismus, nichtstaatliche Akteure, Spiralmodell, soziale Normen, Identität, Interessen, Macht.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben transnationale nichtstaatliche Akteure auf die indonesische Menschenrechtspolitik?
Die Arbeit untersucht, wie internationale NGOs durch Druck und soziale Normen den Wandel Indonesiens von einem totalitären Staat zu einer Demokratie beeinflusst haben, wobei insbesondere der konstruktivistische Ansatz zur Erklärung herangezogen wird.
Was ist das Spiralmodell des Menschenrechtswandels?
Das Spiralmodell nach Risse et al. beschreibt fünf Phasen des Wandels: Repression, Leugnen, taktische Konzessionen, präskriptiver Status und normengeleitetes Verhalten. Die Arbeit prüft die Anwendbarkeit dieses Modells auf Indonesien.
Warum wird der Konstruktivismus als theoretische Grundlage gewählt?
Der Konstruktivismus ermöglicht es, die Rolle von Identitäten, sozialen Normen und nichtstaatlichen Akteuren im internationalen System zu analysieren, anstatt sich nur auf staatliche Machtinteressen zu konzentrieren.
Welche Rolle spielt Osttimor in dieser Analyse?
Die Unabhängigkeit Osttimors markiert einen Wendepunkt, nach dem Indonesien zwar aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit rückte, der Prozess der demokratischen Stabilisierung jedoch kritisch weiterverfolgt werden muss.
In welche Teile ist die Arbeit gegliedert?
Die Arbeit ist in drei Teile unterteilt: die theoretische Vorstellung des Konstruktivismus, die empirische Analyse anhand des Spiralmodells und eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Arbeit zitieren
- Marion Klotz (Autor:in), 2004, Der Einfluss von transnationalen nichtstaatlichen Akteuren auf die Menschenrechtspolitik der indonesischen Regierung (aus konstruktivistischer Sicht), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35847