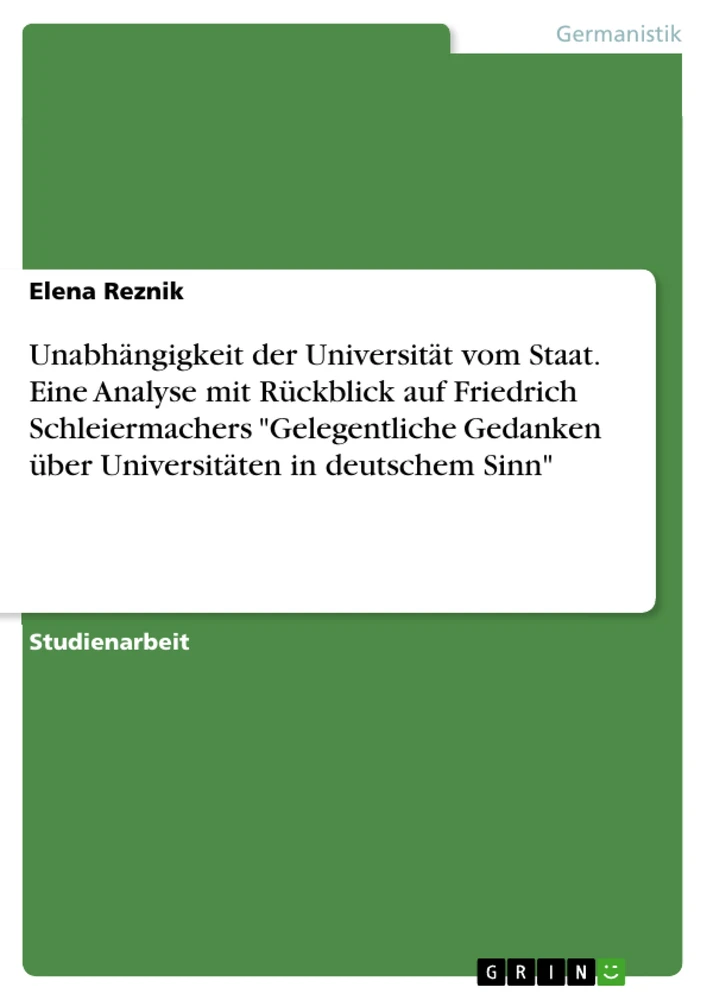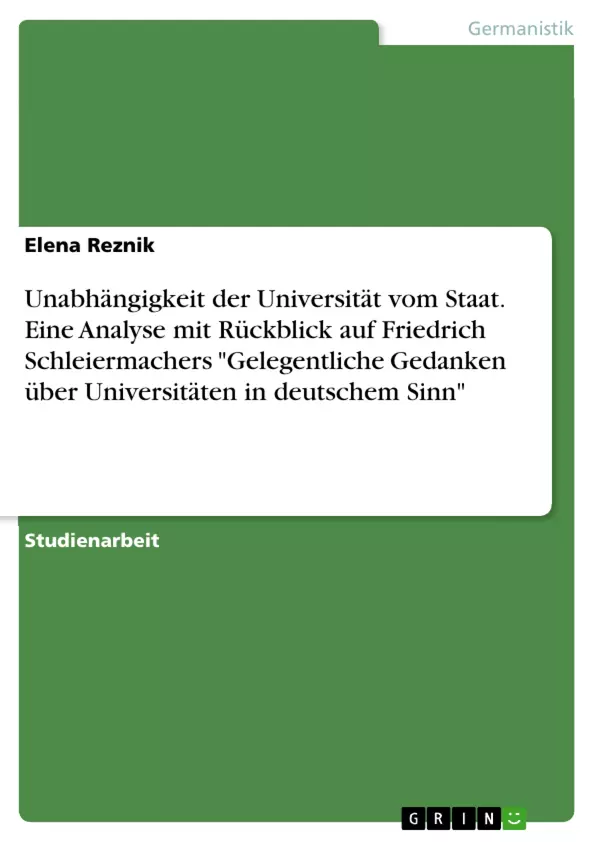In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die Frage zu beantworten, wie und ob die Universitäten vom Staat unabhängig werden können bzw. sollen, mit Hinblick auf Friedrich Schleiermachers Werk „Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn“.
Im ersten Teil der Arbeit wird das Bild der Universität laut Schleiermacher erläutert und zusammengefasst. Der sich daraus ableitende Zweck der Wissenschaft und ihre Beziehung zum Staat werden im zweiten und dritten Teil der Arbeit ausführlich und tiefgründig dargestellt. Im vierten Teil wird auf die Frage der Selbstorganisation der Universitäten und ihre Freiheitsanspruch eingegangen. Der fünfte und sechste Teil schildert die Finanzierungsmöglichkeiten der Universitäten als Wege für ihre Unabhängigkeit und darauf bezogene staatliche Restriktionen. In der Schlussfolgerung wird versucht, das gesamte Bild dieser Verhältnisse aus der Sicht Schleiermachers und der heutigen Perspektive darzustellen.
In seinem Werk „Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn“ aus dem Jahr 1808 geht Schleiermacher schon im ersten Teil auf das Verhältnis zwischen Staat und wissenschaftlichem Verein an. Durch die sechs Kapitel hindurch lassen sich seine Bildungsideen zur Reformierung der deutschen Universitäten deutlich herausbilden, die bei der Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin (heute Humboldt-Universität) ihre Anwendung fanden.
Das Problemfeld der Verhältnisse zwischen dem Staat und der Universität liegt der Entstehung der Universitäten zugrunde. Seit der Gründung der Bologna-Universität im 11. Jahrhundert stieg die Wichtigkeit des Vorhandenseins von Bildungsanstalten in Europa. Sie entwickelten sich aus den ersten Kirchschulen und -seminaren hin zu Prestige- und Privatvereinen der Landsfürsten, später mit Aufkommen der Bürokratie zu Staatslehranstalten. Ihre Struktur, Ordnung, soziale und staatliche Bedeutung änderte sich von Zeit zu Zeit. Aber jahrhundertelang bis zur heutigen Zeit griffen europäische Staaten in die Organisation und Lehre der Universitäten mit derhilfe von Überwachungsmechanismen und Reglementierungen ein: „Der Dienstherr der Universitäten, der moderne Nationalstaat, war, wenn er sich noch aufgeklärt gab, als absolutistisches Herrschaftssystem an einer um ihrer selbst willen gepflegten Wissenschaft kaum interessiert“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Wesen und Aufbau der Universität bei Friedrich Schleiermacher
- 2. Wissenschaft ist ein Gemeinschaftswerk
- 3. Wissenschaftler als „Staatsdiener“
- 4. Freiheit der Universitäten durch Selbstverwaltung...
- 5. Selbstfinanzierung statt Staatsfinanzierung
- 6. Staat Universität – Wirtschaft..
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Frage nach der Unabhängigkeit der Universität vom Staat, basierend auf Schleiermachers Werk „Gelegentliche Gedanken über die Universitäten im deutschen Sinne“. Die Arbeit analysiert Schleiermachers Gedanken zur Rolle der Universität in der Gesellschaft, der Beziehung zwischen Wissenschaft und Staat sowie der Finanzierung von Universitäten.
- Wesen und Aufbau der Universität nach Schleiermacher
- Die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft
- Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Staat
- Freiheit und Selbstverwaltung der Universitäten
- Finanzierungsmöglichkeiten und staatliche Restriktionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Arbeit im Kontext des Seminars „Akademische Wissensordnungen in der europäischen Neuzeit“ vor und führt in das Thema der Unabhängigkeit der Universität vom Staat ein.
- 1. Wesen und Aufbau der Universität bei Friedrich Schleiermacher: Dieses Kapitel analysiert Schleiermachers Vorstellung von der Universität als einem komplexen System, das sich in die drei Formen Schule, Universität und Akademie gliedert. Es werden die spezifischen Aufgaben und Kompetenzen jeder Institution im Hinblick auf die Förderung der Wissenschaft erläutert.
- 2. Wissenschaft ist ein Gemeinschaftswerk: Dieses Kapitel befasst sich mit Schleiermachers Sichtweise auf Wissenschaft als ein gemeinsames Unternehmen, das die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Wissenschaftlern erfordert.
- 3. Wissenschaftler als „Staatsdiener“: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Wissenschaftlers als „Staatsdiener“ und diskutiert die Ambivalenz dieser Beziehung. Es wird argumentiert, dass der Staat zwar die Wissenschaft fördert, gleichzeitig aber auch ihren Freiraum einschränken kann.
- 4. Freiheit der Universitäten durch Selbstverwaltung: Dieses Kapitel analysiert Schleiermachers Vision von einer freien Universität, die durch Selbstverwaltung und Autonomie geprägt ist. Es werden die Vorteile dieser Struktur für die freie Forschung und Lehre betont.
- 5. Selbstfinanzierung statt Staatsfinanzierung: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für Universitäten und diskutiert die Vor- und Nachteile der Selbstfinanzierung im Vergleich zur staatlichen Finanzierung.
- 6. Staat Universität – Wirtschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Staat, Universität und Wirtschaft. Es wird diskutiert, wie sich der Einfluss der Wirtschaft auf die Forschung und Lehre gestalten kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Universität, Wissenschaft, Staat, Selbstverwaltung, Finanzierung, Bildung und Philosophie. Sie analysiert das Verhältnis von Staat und Universität, die Autonomie der Wissenschaft und die Notwendigkeit einer freien Forschung. Zu den zentralen Themen gehören die Regulierung von Universitäten, die Rolle der Philosophie in der Wissenschaft und die Frage nach dem richtigen Verhältnis von staatlicher und privater Finanzierung im Bildungsbereich.
Häufig gestellte Fragen
Wie sah Friedrich Schleiermacher das Wesen der Universität?
Für Schleiermacher war die Universität Teil eines dreigliedrigen Systems aus Schule, Universität und Akademie, wobei die Universität der Ort der freien wissenschaftlichen Erkenntnis ist.
Sollten Universitäten vom Staat unabhängig sein?
Schleiermacher argumentierte für eine weitgehende Selbstverwaltung und Freiheit der Wissenschaft, sah Wissenschaftler aber gleichzeitig in einer gewissen Pflicht als "Staatsdiener".
Welche Finanzierungsmodelle schlug Schleiermacher vor?
Die Arbeit diskutiert Schleiermachers Gedanken zur Selbstfinanzierung der Universitäten als Weg zur Unabhängigkeit von staatlichen Restriktionen.
Welche Rolle spielt die Selbstverwaltung für die wissenschaftliche Freiheit?
Selbstverwaltung wird als essenziell angesehen, um Forschung und Lehre vor politischer Einflussnahme und Reglementierung durch den Staat zu schützen.
Wie hat Schleiermacher die deutsche Universitätsreform beeinflusst?
Seine Bildungsideen fanden direkte Anwendung bei der Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, der heutigen Humboldt-Universität.
Was ist das Problem des Staates als "Dienstherr" der Wissenschaft?
Oft ist der Nationalstaat primär an verwertbaren Ergebnissen interessiert, während die Wissenschaft Freiheit benötigt, um Wissen um seiner selbst willen zu pflegen.
- Quote paper
- Elena Reznik (Author), 2009, Unabhängigkeit der Universität vom Staat. Eine Analyse mit Rückblick auf Friedrich Schleiermachers "Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358657