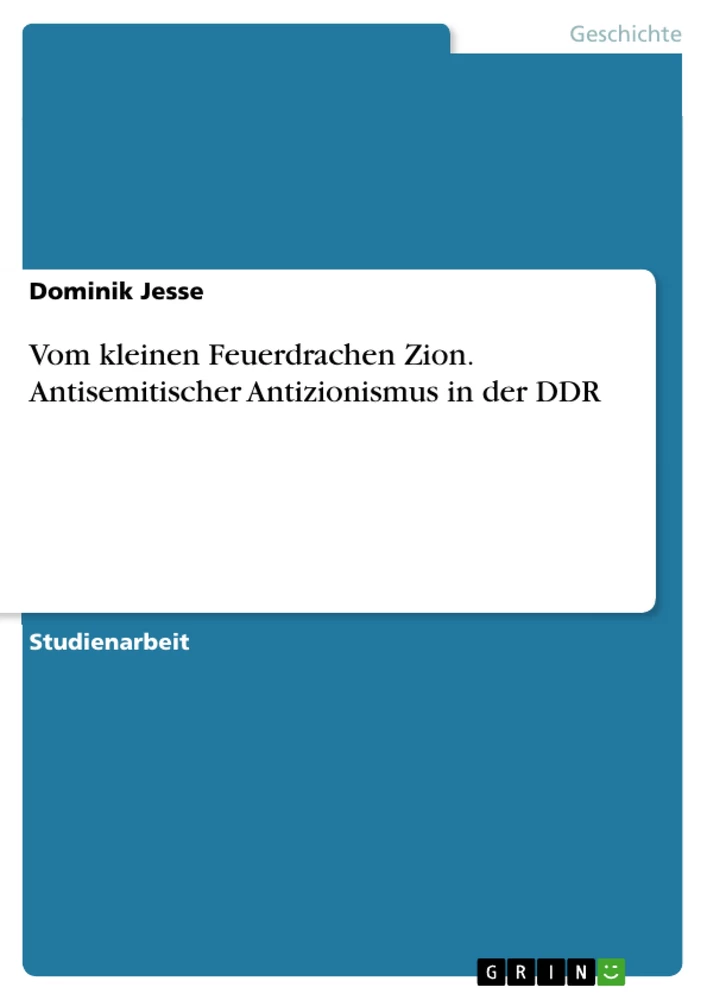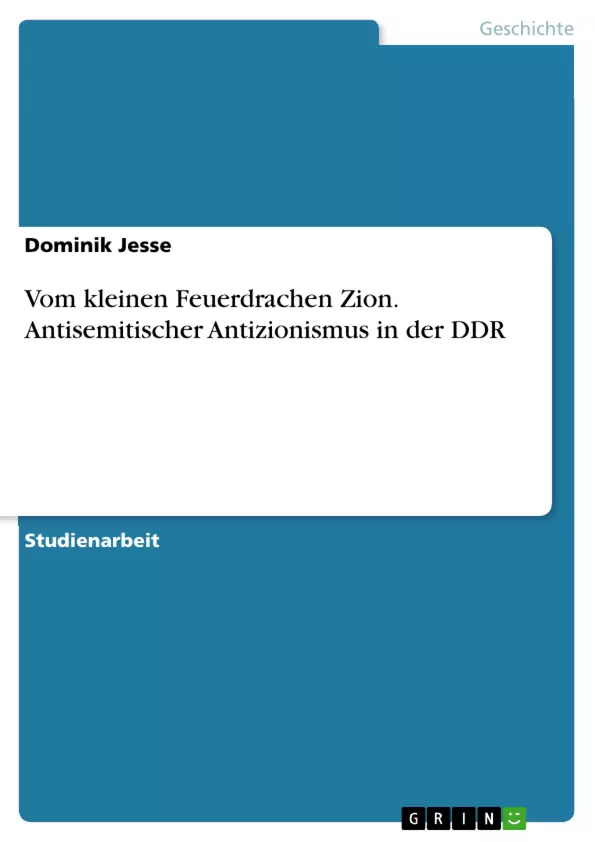Im November 1984 erschien in der DDR-Kinderzeitschrift "Die ABC-Zeitung" das Märchen vom kleinen "Feuerdrachen Zion", der ohne Not und nur aus Undankbarkeit und Habgier heraus das Land der "Kinder Palästinas" (Basedow 1984: 18) zerstört. Unter Rückgriff auf explizit antisemitische Stereotype stellte der Artikel den Nahostkonflikt nicht nur vereinfacht, sondern als alleinig von Israel zu verantworten dar. Da die ABC-Zeitung das propagandistische Organ des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und mithin parteinah war, lag dieser antizionistischen Darstellung sicherlich kein ärgerliches Versehen, wohl aber eine direkte oder indirekte Vorgabe der ostdeutschen Staatsführung zugrunde. Dass eine solch einseitige Verzerrung der politischen Realitäten in Nahost auch tatsächlich beabsichtigt war, erklärt sich aus der dezidiert israelfeindlichen Politik, die von der SED bis in die späten 1980er Jahre betrieben wurde. Verwundern muss indes, dass sich diese antizionistische Agitation nur wenige Jahre nach dem Ende der Shoah im marxistisch-leninistischen deutschen Teilstaat mit traditionellen antisemitischen Feindbildern schmückte, verstand sich die DDR doch in ihrem Selbstverständnis als genuin antifaschistischer Staat, der die deutsche judenfeindliche Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen habe. In der folgenden Arbeit soll diesem vermeintlichen Widerspruch nachgespürt werden. Während zunächst eine Antwort auf die Frage gefunden werden muss, weshalb und inwiefern die DDR ein antizionistischer Staat war, ist im Anschluss daran zu untersuchen, weshalb und inwieweit sich der jedenfalls in der öffentlichen Debatte tabuisierte klassische Antisemitismus in einer ausdrücklichen Feindschaft gegen Israel wiederfinden konnte (vgl. Voigt 2008). Ziel der folgenden Ausführungen ist es also nicht, etwaige antisemitische und antizionistische Tendenzen innerhalb der Bevölkerung oder Versäumnisse im historischen und gesellschaftlichen Umgang mit dem millionenfachen Mord an den europäischen Juden aufzudecken. Wohl aber soll dargestellt werden, dass die DDR ein Land war, in dem sich aus politischen und ideologischen Gründen etwas herausbilden konnte, das als "antisemitischer Antizionismus" (Haury 2016: 11) bezeichnet werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Definition - Antisemitischer Antizionismus
- 2 Strukturelle Nähe - Marxismus-Leninismus und Antisemitismus
- 3 Ebenen eines Nichtverhältnisses - Der Antizionismus der DDR.
- 3.1 Geopolitischer Pragmatismus.
- 3.2 Anerkennung und Legitimation
- 4 Antisemitischer Antizionismus in der DDR..
- 4.1 Die antizionistischen \"Säuberungen\" von 1952/53.
- 4.2 Zwischen Schuldabwehr und Propaganda.….………………………….
- Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die antizionistische Politik der DDR und ihre Beziehung zum Antisemitismus. Das Ziel ist es, die Gründe für die dezidierte Feindschaft der DDR gegenüber Israel zu beleuchten und zu zeigen, wie der Antizionismus der DDR die Grenzen zum Antisemitismus überschritten hat. Die Arbeit konzentriert sich dabei insbesondere auf die antizionistischen „Säuberungen“ von 1952/53, die Rolle der Propaganda im Kontext des Nahostkonflikts und die Rolle des Marxismus-Leninismus im Kontext des Antisemitismus.
- Die Definition des Begriffs „antisemitischer Antizionismus“
- Die strukturelle Nähe zwischen Marxismus-Leninismus und Antisemitismus
- Die Gründe für die Feindschaft der DDR gegenüber Israel
- Die antizionistische Propaganda der DDR
- Die Beziehung zwischen Antizionismus und Antisemitismus in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und gibt einen Überblick über den Kontext der antizionistischen Politik der DDR. Kapitel 1 definiert den Begriff „antisemitischer Antizionismus“ und grenzt ihn vom Antisemitismus und der Kritik am politischen Agieren Israels ab. Kapitel 2 behandelt die strukturelle Nähe zwischen Marxismus-Leninismus und Antisemitismus, die für das Verständnis des antisemitischen Antizionismus in der DDR von Bedeutung ist. Kapitel 3 analysiert die Gründe für die erklärte Feindschaft der DDR gegenüber Israel, wobei der geopolitische Pragmatismus und die Anerkennung und Legitimation des Staates Israel durch die DDR untersucht werden. Kapitel 4 analysiert die antizionistischen „Säuberungen“ von 1952/53 und untersucht die Rolle der Propaganda im Kontext des Nahostkonflikts. Schließlich fasst die Zusammenfassung die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Antisemitischer Antizionismus, Marxismus-Leninismus, Antisemitismus, Antizionismus, DDR, Staat Israel, Nahostkonflikt, Propaganda, „Säuberungen“ von 1952/53, geopolitischer Pragmatismus, Anerkennung und Legitimation. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Ideologie und die Politik der DDR und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung Israels und der Juden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist mit dem Titel „Vom kleinen Feuerdrachen Zion“ gemeint?
Es bezieht sich auf ein Märchen in einer DDR-Kinderzeitschrift von 1984, das unter Verwendung antisemitischer Stereotype Israel als habgierigen Zerstörer darstellte.
Was versteht man unter „antisemitischem Antizionismus“?
Es beschreibt eine Form der Feindschaft gegen Israel, die sich klassischer antisemitischer Vorurteile und Bilder bedient, oft unter dem Deckmantel politischer Kritik.
Warum war die DDR so israelfeindlich eingestellt?
Gründe waren geopolitischer Pragmatismus (Bündnisse mit arabischen Staaten) sowie die ideologische Einordnung Israels als Brückenkopf des Imperialismus.
Gab es in der DDR antisemitische „Säuberungen“?
Ja, die Arbeit thematisiert die antizionistischen Säuberungen von 1952/53, bei denen jüdische Parteimitglieder und Funktionäre verfolgt wurden.
Wie passte das zum antifaschistischen Selbstverständnis der DDR?
Die Arbeit untersucht diesen Widerspruch: Während die DDR sich offiziell als antifaschistisch definierte, nutzte sie für ihre Außenpolitik dennoch judenfeindliche Feindbilder.
Welche Rolle spielte der Marxismus-Leninismus dabei?
Die Arbeit analysiert die strukturelle Nähe zwischen marxistischen Theorien und bestimmten antisemitischen Denkmustern im Kontext der DDR-Ideologie.
- Quote paper
- Dominik Jesse (Author), 2017, Vom kleinen Feuerdrachen Zion. Antisemitischer Antizionismus in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358686