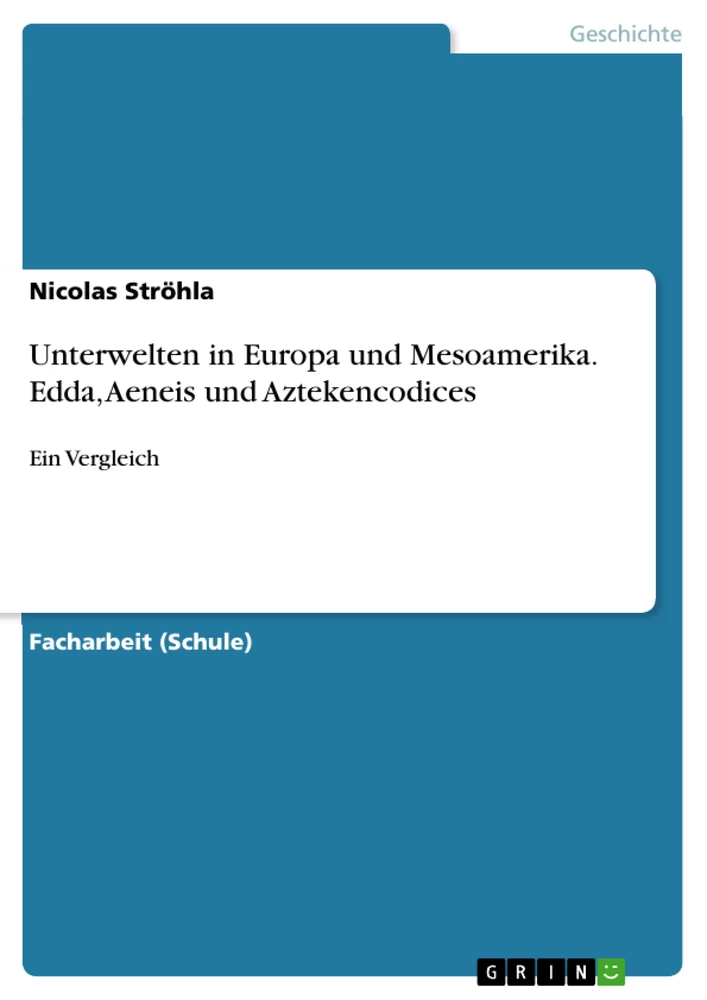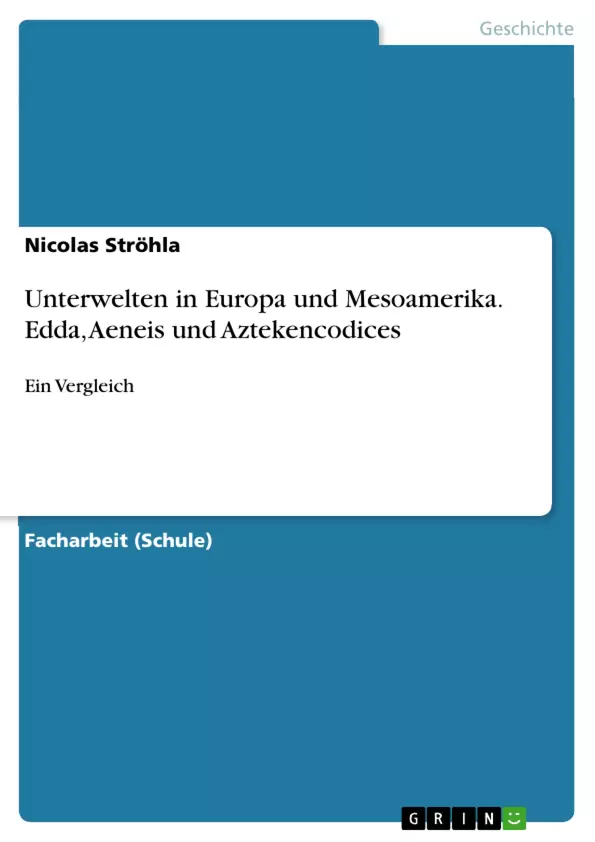In der Seminararbeit lenkt der Autor sein Augenmerk auf die Unterweltvorstellungen von Wikingern und Nordgermanen sowie Römern in Europa sowie Azteken in Mesoamerika und stellt sie mit Bezug auf die Edda, Aeneis und die Aztekencodices vergleichend gegenüber. Dabei widerlegt der Autor den gängigen Mythos von der einen Unterwelt, der nicht oder nur bedingt gilt.
Schon immer haben sich die Menschen die Frage gestellt, war mit ihnen nach dem Tod passiert und wohin sie dann kommen. Die Suche nach der Antwort auf diese Frage beschäftigt nicht nur uns in der heutigen Zeit, im Hier und Jetzt, sondern seit der Steinzeit auch Menschen unterschiedlichster Völker, die mehrere Jahrhunderte vor uns lebten und starben. Sie versuchten, sich ein Bild davon zu machen, an welchen Totenorte sie dann ihr Schattendasein führen würden.
Anders als heute, in einer Welt, in der der Tod durch die Errungenschaften der Medizin in weite Ferne gerückt wird und in der Menschen unter normalen Bedingungen ein hohes Alter erreichen können, war der Tod in frühester Zeit der ständige Begleiter der Menschen. Da er jederzeit eintreten konnte, wollten die Menschen die Ungewissheit über das Jenseits wenigstens dadurch einschränken, indem sie sich in ihrer jeweiligen Religion ein Leben danach erschufen.
So hatten die Wikinger und Nordgermanen 3, die Azteken 4 Unterwelten. Und auch bei den Römern gab es eigentlich mehr Unterwelten, die jedoch in einer einzigen vereint waren.
Folgende Fragen beantwortet der Autor in seiner Arbeit:
Welchen eigentlichen Sinn und Zweck hatten die schriftlichen Quellen, aus denen sich die einzelnen Darstellungen der Unterwelt entnehmen lassen?
In welchem historischen Zusammenhang entstanden sie und wer hat sie verfasst?
Wie muss man sich den Aufbau der einzelnen Jenseitsorte vorstellen und wie viele gab es davon in den genannten Kulturen?
Lässt sich möglicherweise ein Zusammenhang zwischen der Lebensweise der Völker im Diesseits zur Unterwelt nach dem Tod feststellen?
Und wie kommt es, dass man trotz zeitlich und geografisch trennender Elemente, wie z. B. Atlantik sowie Nord- und Ostsee, dennoch derart viele Gemeinsamkeiten zwischen den jeweiligen Unterwelten erkennen kann?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Edda
- I.1. Begriffsklärung
- I.2. Die Edda-Übersetzung in deutscher Sprache
- I.3. „Die Götter- und Heldenlieder der Älteren Edda“
- I.4. „Die Edda des Snorri Sturluson“
- I.5. Die Anzahl der eddischen Unterwelten
- I.6. Die Unterwelt Hel vor Ragnarök
- I.6.a) Die Lage und die Unterteilung von Hel
- I.6.b) Das Totengericht
- I.6.c) Der Grenzfluss
- I.6.d) Die Bewohner Hels
- I.6.e) Das Schiff Naglfar
- I.7. Die „Unterwelt“ Walhall in der Götterwelt Asgard vor Ragnarök
- I.8. Die Unterwelt Rán am Meeresboden vor Ragnarök
- I.9. Der Weltuntergang Ragnarök
- I.10. Die Zeit nach Ragnarök
- II. Die Aeneis
- II.1. Das Heldenpos und der Gründungsmythos des Römischen Reiches
- II.2. Die Motive der Katabasis
- II.3. Der Orcus
- II.3.a) Die Vorhalle
- II.3.b) Der Unterweltfluss Styx
- II.3.c) Der Höllenhund Cerberus
- II.3.d) Bezirk der fälschlicherweise zum Tode Verurteilten
- II.3.e) Bezirk der Selbstmörder
- II.3.f) Die Trauergefilde
- II.3.g) Bezirk der Kriegshelden
- II.3.h) Der Tartarus
- II.3.i) Das Elysium
- II.4. Die neue alte Welt
- III. Die Aztekencodices
- III.1. Die Geschichte der Azteken
- III.2. Die Quellen
- III.3. Die Unterwelten
- III.3.a) Die Anzahl der Unterwelten
- III.3.b) Der Totenort Mictlan
- III.3.c) Der Totenort Tlalocan
- III.3.d) Der Totenort In ichan tonatiuh ilhujcac
- III.3.e) Die Sonderstellung der Großkaufleute
- III.3.f) Die Opferarten
- III.3.g) Der Totenort Xochatlapan
- A. Gemeinsamkeiten der Unterwelten von Edda, Aeneis und Aztekencodices
- B. Gemeinsamkeiten zweier Unterwelten
- C. Unterschiede zwischen den Unterwelten
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht vergleichend die Unterweltvorstellungen der nordgermanischen Mythologie (Edda), der römischen Mythologie (Aeneis) und der aztekischen Kultur (Aztekencodices). Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Konzepte aufzuzeigen und gängige Vereinfachungen zu widerlegen, indem die Komplexität der jeweiligen Unterwelten herausgestellt wird. Die Arbeit analysiert die schriftlichen Quellen, ihren historischen Kontext und die Darstellung der Jenseitsorte.
- Vergleich der Unterweltkonzepte in drei verschiedenen Kulturen.
- Analyse der schriftlichen Quellen und ihres historischen Kontextes.
- Beschreibung des Aufbaus und der Struktur der jeweiligen Unterwelten.
- Untersuchung möglicher Zusammenhänge zwischen der Lebensweise der Völker und ihren Unterweltvorstellungen.
- Erklärung der Gemeinsamkeiten trotz geographischer und zeitlicher Distanz.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die zentrale Forschungsfrage nach dem Jenseits und dessen Darstellung in verschiedenen Kulturen. Sie hebt den Fokus auf die Edda, Aeneis und Aztekencodices als Quellen und kündigt den Vergleich der Unterweltvorstellungen an, wobei die gängige Vorstellung einer einzigen Unterwelt widerlegt werden soll. Die Einleitung beschreibt den Umfang der Arbeit und benennt die zentralen Fragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen, einschließlich der Unterschiede zwischen den jeweiligen Unterwelten und den Gründen für die bestehenden Gemeinsamkeiten.
I. Die Edda: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Begriffsklärung der „Edda“, differenziert zwischen der Lieder-Edda und der Prosa-Edda und beleuchtet die Herausforderungen der Übersetzung dieser altisländischen Texte ins Deutsche. Es beschreibt den Prozess der mündlichen Überlieferung von Wissen in der vorchristlichen skandinavischen Gesellschaft und untersucht die Rolle der Runen. Der Abschnitt diskutiert anschließend die Entstehung und Bedeutung der verschiedenen eddischen Quellen für das Verständnis der nordgermanischen Unterwelten, einschließlich der Schwierigkeiten der Übersetzung und der Frage nach der Einheitlichkeit des verwendeten Materials.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Vergleich der Unterweltvorstellungen in Edda, Aeneis und Aztekencodices
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht vergleichend die Unterweltvorstellungen der nordgermanischen Mythologie (Edda), der römischen Mythologie (Aeneis) und der aztekischen Kultur (Aztekencodices). Ziel ist der Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Konzepte und die Widerlegung gängiger Vereinfachungen durch die Hervorhebung der Komplexität der jeweiligen Unterwelten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die schriftlichen Quellen Edda, Aeneis und Aztekencodices, ihren historischen Kontext und die Darstellung der Jenseitsorte. Es wird zwischen der Lieder-Edda und der Prosa-Edda unterschieden und die Herausforderungen der Übersetzung altisländischer Texte ins Deutsche beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Unterweltkonzepte in drei verschiedenen Kulturen, die Analyse der schriftlichen Quellen und ihres historischen Kontextes, die Beschreibung des Aufbaus und der Struktur der jeweiligen Unterwelten, die Untersuchung möglicher Zusammenhänge zwischen der Lebensweise der Völker und ihren Unterweltvorstellungen sowie die Erklärung der Gemeinsamkeiten trotz geographischer und zeitlicher Distanz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Edda (inkl. Begriffsklärung, Übersetzungsprobleme, Beschreibung der verschiedenen Unterwelten wie Hel, Walhall, Rán und Ragnarök), zur Aeneis (inkl. Katabasis-Motive, Beschreibung des Orcus mit seinen verschiedenen Bezirken wie Elysium und Tartarus) und zu den Aztekencodices (inkl. Geschichte der Azteken, Beschreibung der verschiedenen Totenorte wie Mictlan, Tlalocan und Xochatlapan). Zusätzliche Kapitel vergleichen die Gemeinsamkeiten der Unterwelten allgemein und paarweise sowie deren Unterschiede. Einleitung und Schlusswort runden die Arbeit ab.
Welche zentrale These wird widerlegt?
Die Arbeit widerlegt die gängige Vereinfachung, dass es nur eine einzige Unterwelt gibt. Stattdessen wird die Komplexität und Vielschichtigkeit der Unterweltvorstellungen in den drei untersuchten Kulturen herausgestellt.
Welche Aspekte der jeweiligen Kulturen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die schriftlichen Quellen, den historischen Kontext der jeweiligen Kultur und die Darstellung der Jenseitsvorstellungen. Im Fall der Edda wird auch die mündliche Überlieferung und die Rolle der Runen thematisiert. Bei den Azteken wird die Geschichte der Azteken und die verschiedenen Opferarten mit einbezogen.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden aufgezeigt?
Die Arbeit zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Struktur und im Aufbau der Unterwelten, in den beschriebenen Orten und Bewohnern sowie in den Funktionen und Bedeutungen der jeweiligen Jenseitsvorstellungen auf. Diese werden sowohl im Gesamtvergleich als auch im paarweisen Vergleich dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Nicolas Ströhla (Autor:in), 2016, Unterwelten in Europa und Mesoamerika. Edda, Aeneis und Aztekencodices, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359186