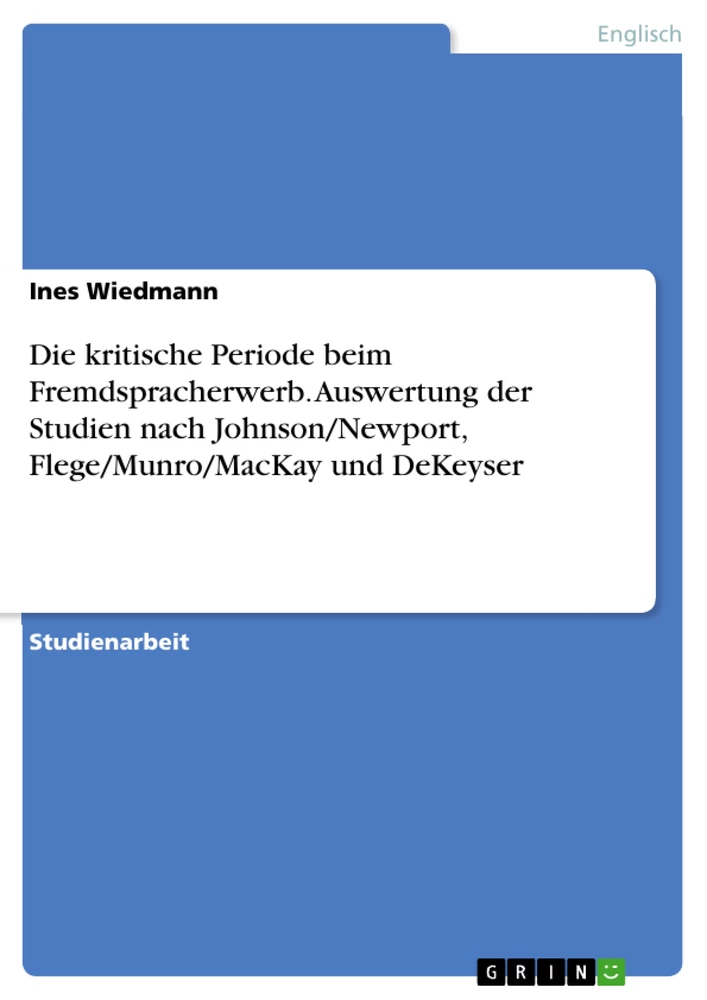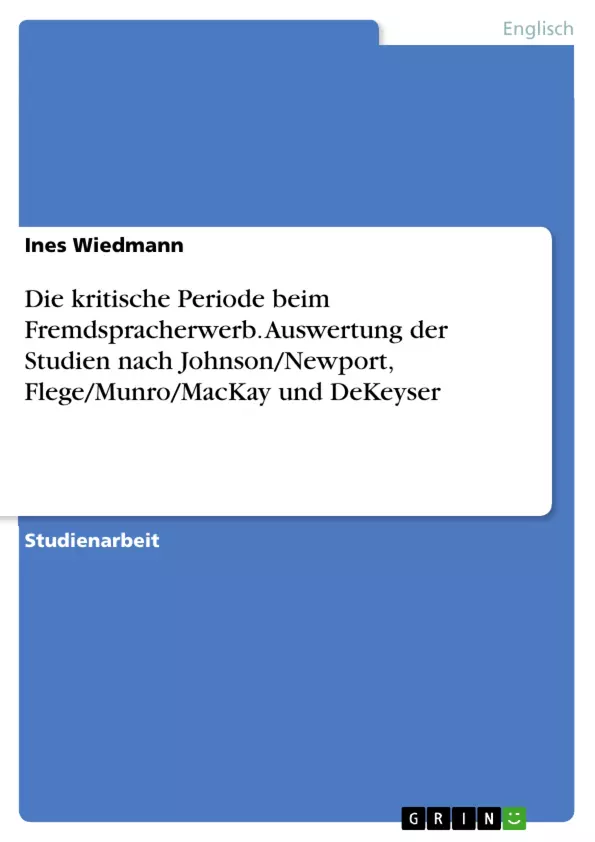In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob es eine kritische Periode beim Fremdspracherwerb gibt, ob es einen sogenannten Cut-off Point gibt, nachdem ein Spracherwerb nicht mehr möglich ist, und wenn ja, wann er stattfindet. Um diesen Fragen nachzugehen, werden drei der bedeutendsten Studien zu diesem Thema betrachtet und miteinander verglichen.
Durch die vielen verschiedenen Krisen und Kriege auf der Welt sind heutzutage sehr viele Menschen auf der Flucht. Die Zahl der Anträge auf Asyl ist alleine in Deutschland in den letzten 8 Jahren fast um das Zehnfache gestiegen. Für viele der Flüchtlinge besteht keine Möglichkeit, in ihr Heimatland zurückzukehren; sie müssen sich also ein neues Leben in einem Land aufbauen, dessen Sprache und Kultur ihnen fremd ist. Der erste Schritt, um sich zurechtzufinden, ist der Erwerb der Sprache, da Sprache das wichtigste Mittel für eine erfolgreiche Integration darstellt. Doch ist es überhaupt möglich, im Erwachsenenalter eine Fremdsprache auf einem hohen Niveau zu erlernen? Und wie verhält es sich mit den Kindern, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Wann ist für sie der beste Zeitpunkt, um die neue Fremdsprache zu lernen?
Dies führt zu der Frage, ob es eine kritische Periode beim Sprachenerwerb gibt, nach der die Fremdsprache nicht mehr erlernt werden kann. Die Hypothese der kritischen Periode ist – seit ihrer Einführung von Penfield und Roberts (1959) und ihrer weiteren Erforschung durch den Linguisten und Neurologen Eric Lenneberg – eines der interessantesten Gebiete der Spracherwerbsforschung und Gegenstand kontroverser Diskussionen. Es gibt zahlreiche Studien zu diesem Thema, deren Ergebnisse die Existenz einer kritischen Periode entweder bestätigen oder anzweifeln. Forschung in diesem Gebiet kann also dabei helfen, festzustellen, inwieweit eine Fremdsprache im Erwachsenenalter erlernt werden kann und wann es am sinnvollsten ist, Kinder an eine Fremdsprache heranzuführen. Doch dieses Thema ist nicht nur für Flüchtlingspolitik und Wissenschaft relevant. Auch in der Wirtschaft spielt es eine große Rolle, da Fremdsprachenkenntnisse, vor allem Englischkenntnisse, immer wichtiger werden. Ob beruflich oder gesellschaftlich; sie sind fast überall eine Voraussetzung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsabgrenzung
- Johnson & Newport
- Die Studie
- Ergebnisse
- Flege, Munro & MacKay
- Die Studie
- Ergebnisse
- DeKeyser
- Die Studie
- Ergebnisse
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Hypothese der kritischen Periode im Fremdsprachenerwerb. Sie befasst sich mit der Frage, ob es einen "Cut-off Point" gibt, nach dem der Erwerb einer Fremdsprache nicht mehr vollständig möglich ist, und wenn ja, wann dieser Zeitpunkt eintritt. Die Arbeit analysiert und vergleicht drei bedeutende Studien zum Thema, um einen umfassenden Überblick über die aktuelle Forschung zu bieten.
- Die Existenz einer kritischen Periode im Fremdsprachenerwerb
- Der Einfluss des Alters auf die Erlernbarkeit einer Fremdsprache
- Die Rolle biologischer Faktoren im Sprachlernprozess
- Die Bedeutung von Forschungsergebnissen für die Praxis, z.B. im Bereich der Integrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Relevanz des Themas im Kontext von Flucht und Migration. Sie stellt die Hypothese der kritischen Periode vor und skizziert die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
- Das Kapitel "Begriffsabgrenzung" definiert den Begriff der kritischen Periode und erläutert seine historische Entwicklung. Es stellt die wichtigsten Theorien und Forschungsergebnisse im Kontext der kritischen Periode vor.
- Das Kapitel "Johnson & Newport" fasst die Ergebnisse einer wichtigen Studie zum Einfluss des Alters auf den Erwerb der englischen Sprache zusammen. Es analysiert die Methoden und Ergebnisse der Studie und diskutiert deren Relevanz für die Hypothese der kritischen Periode.
- Das Kapitel "Flege, Munro & MacKay" stellt eine weitere Studie zum Einfluss des Alters auf den Fremdsprachenerwerb vor. Es beschreibt die Methoden und Ergebnisse der Studie und vergleicht sie mit den Ergebnissen von Johnson & Newport.
- Das Kapitel "DeKeyser" analysiert eine Studie zum Einfluss des Alters auf den Erwerb der französischen Sprache. Es stellt die Methoden und Ergebnisse der Studie dar und diskutiert deren Implikationen für die Hypothese der kritischen Periode.
Schlüsselwörter
Kritische Periode, Fremdsprachenerwerb, Spracherwerb, Alter, Cut-off Point, Sprachperformanz, biologische Faktoren, Integrationspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob es beim Fremdspracherwerb eine kritische Periode oder einen "Cut-off Point" gibt, nach dem das Erlernen einer Sprache nicht mehr vollständig möglich ist.
Welche bedeutenden Studien werden in der Arbeit ausgewertet?
Es werden die Studien von Johnson/Newport, Flege/Munro/MacKay und DeKeyser analysiert und miteinander verglichen.
Was besagt die Hypothese der kritischen Periode?
Die Hypothese besagt, dass es ein zeitlich begrenztes Fenster gibt (meist in der Kindheit), in dem das menschliche Gehirn besonders empfänglich für den Spracherwerb ist.
Warum ist dieses Thema für die Integrationspolitik relevant?
Da Sprache der Schlüssel zur Integration ist, hilft die Forschung zu klären, inwieweit Erwachsene noch hohe Sprachniveaus erreichen können und wann der beste Zeitpunkt für die Sprachförderung bei Kindern ist.
Wer waren die Pioniere der Forschung zur kritischen Periode?
Die Theorie wurde ursprünglich von Penfield und Roberts (1959) eingeführt und später maßgeblich vom Linguisten Eric Lenneberg weiterentwickelt.
Welche Rolle spielen biologische Faktoren laut der Arbeit?
Biologische Faktoren bestimmen maßgeblich die Plastizität des Gehirns und beeinflussen somit, wie effizient und natürlich eine Fremdsprache in verschiedenen Lebensaltern erlernt werden kann.
- Quote paper
- Ines Wiedmann (Author), 2015, Die kritische Periode beim Fremdspracherwerb. Auswertung der Studien nach Johnson/Newport, Flege/Munro/MacKay und DeKeyser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359292