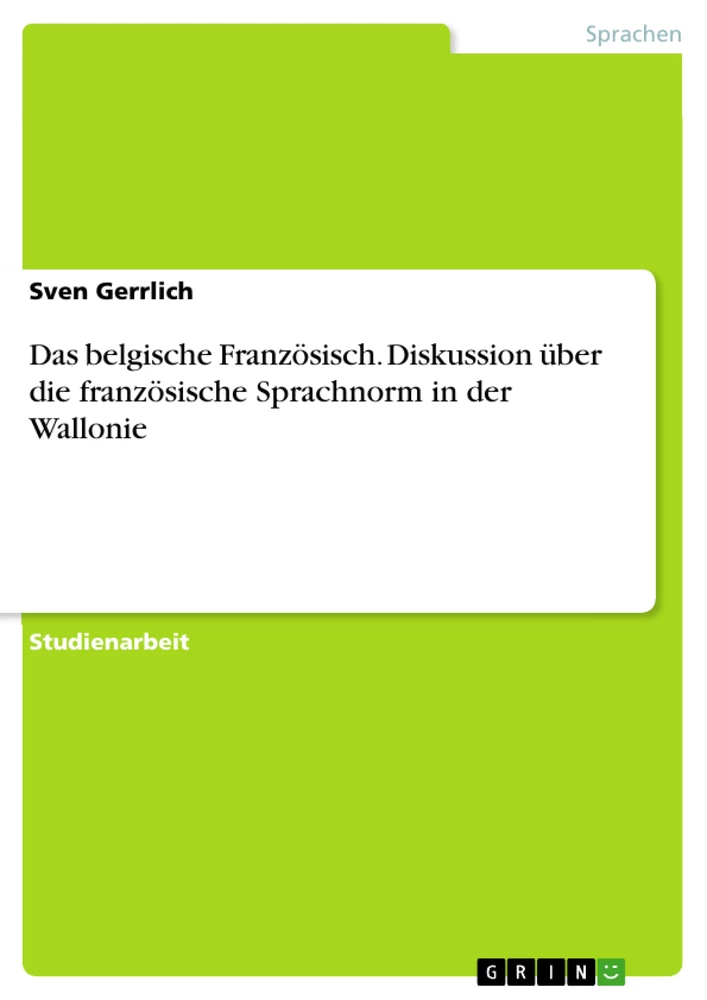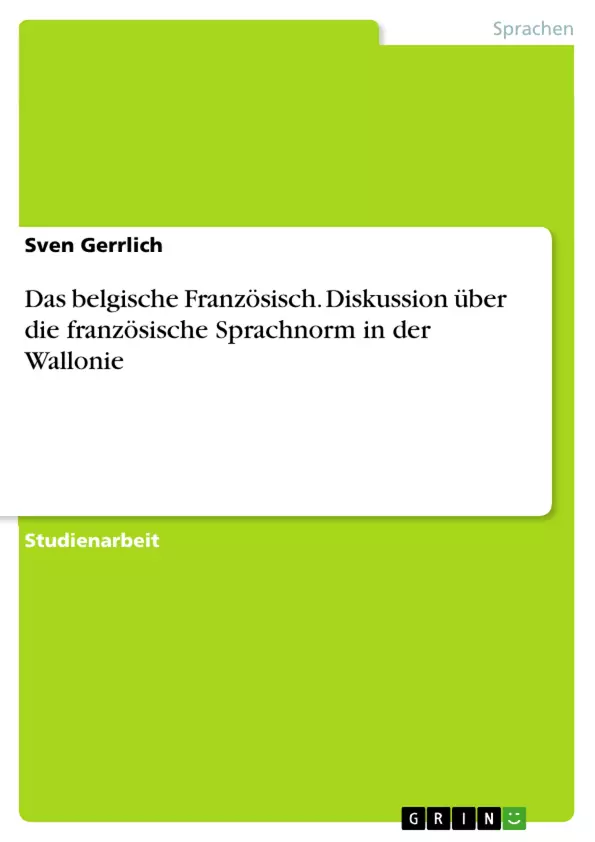Diese Arbeit beschäftigt sich im Rahmen der französischen Sprachnorm in der Wallonie mit folgenden Fragen: Wie sieht generell das Verhältnis der Länder Frankreich und Belgien im Bezug auf Sprachverordnungen aus? Hat die „Académie française“ überhaupt Einfluss in Belgien? Und wenn ja oder nein, welche Art von Sprachpolitik wird in der „communauté française de Belgique“ dann betrieben?
Beim Staat Belgien handelt es sich um einen Staat der ganz besonderen Art. Ein Staat mit gleich drei Amtssprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch – wobei das Deutsche mit einer Sprechergemeinde von nur 75.000 Sprechern eher eine Minderheit innerhalb der 10-Millionen-Einwohner-Nation Belgien darstellt. Zweifelsohne spielen also das Flämische und das Französische eine weitaus wichtigere Rolle und sind seit Jahrzehnten das Hauptaugenmerk expansiver Sprachpolitik. Der über Jahrzehnte, ja mittlerweile seit der Gründung Belgiens 1830 über fast zwei Jahrhunderte dauernde Sprachenstreit zwischen dem niederländisch dominierten Flandern im Norden und dem französischsprachigen Süden ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt und barg immer wieder Konflikte auf beiden Seiten in sich.
Bei einer Vielzahl von Belgizismen, einer auf den ersten Blick scheinbar weniger strikt handgehabten Sprachpolitik im Vergleich zur „grande sœur: La France“, ist es auch interessant, kurz einen Blick auf die Sprachinstitute Belgiens zu werfen. Um den Umfang dieser Arbeit nicht zu sprengen, hat sich der Autor für zwei belgische Institute entschieden: Die „Académie royale de langue et de litérature française en Belgique“ und die private Organisation „La Maison de la Francité“ mit Sitz in Brüssel. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, auch einen kurzen Blick auf die wichtigen Beiträge belgischer Linguisten und Grammatiker zur Normierung des Französischen werfen. Grevisses „Grammaire française“ zur „bon usage“ gilt nicht zu Unrecht als die wohl bis dato umfassendste und beste Grammatik („meilleur grammaire française“).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problematisierung der Festsetzung einer einheitlichen Norm des Französischen
- Gibt es eine Sprachnorm in der Wallonien?
- Situation des Französischen in Wallonien
- Verhältnis zum französischen Frankreichs
- Französische Sprachpflege in Belgien
- Académie royale de langue et de littérature française en Belgique
- La Maison de la Francité
- Belgische Grammatiker
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der aktuellen Situation des Französischen in Belgien und untersucht, ob es im französischsprachigen Teil des Landes eine überregionale belgische Norm gibt.
- Die Situation des Französischen in Wallonien im Vergleich zum Französischen Frankreichs
- Die Rolle der Sprachpflege in Belgien und die Einflussnahme der Académie française
- Der Einfluss von belgischen Linguisten und Grammatikern auf die Normierung des Französischen
- Die Frage des Auto-Image der Belgier bezüglich ihres Französischs
- Die Bedeutung der Sprachpolitik in der Communauté française de Belgique
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik der Festsetzung einer einheitlichen Sprachnorm in Belgien dar und beleuchtet die historische Entwicklung der Sprachsituation.
- Kapitel 1 thematisiert die strikte französische Sprachpolitik und die Herausbildung einer einheitlichen Norm.
- Kapitel 2 untersucht die Frage nach einer überregionalen Norm im französischsprachigen Teil Belgiens und beleuchtet die diastratischen und diaphasischen Varietäten des Französischen in Wallonien.
- Kapitel 3 beleuchtet die französische Sprachpflege in Belgien und analysiert die Rolle der Académie royale de langue et de littérature française en Belgique, La Maison de la Francité sowie belgischer Grammatiker.
Schlüsselwörter
Französische Sprachnorm, Wallonien, Belgien, Frankreich, Sprachpflege, Académie française, belgische Grammatiker, Soziolinguistik, Auto-Image, Sprachpolitik, Communauté française de Belgique
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine eigene Sprachnorm für das Französische in Belgien?
In der Wallonie orientiert man sich stark an der Norm aus Frankreich, jedoch gibt es spezifische Belgizismen und regionale Eigenheiten.
Welchen Einfluss hat die Académie française in Belgien?
Obwohl sie keine direkte rechtliche Gewalt hat, dient sie als prestigeträchtiges Vorbild für die Sprachpflege in der französischen Gemeinschaft Belgiens.
Was sind typische Belgizismen?
Dazu gehören Begriffe, die im Standardfranzösischen anders verwendet werden, oft beeinflusst durch die historische Entwicklung und den Kontakt zum Flämischen.
Wer war Maurice Grevisse?
Grevisse war ein bedeutender belgischer Grammatiker, dessen Werk „Le Bon Usage“ als eine der besten französischen Grammatiken weltweit gilt.
Wie viele Amtssprachen hat Belgien?
Belgien hat drei Amtssprachen: Niederländisch (Flämisch), Französisch und Deutsch.
- Quote paper
- Sven Gerrlich (Author), 2012, Das belgische Französisch. Diskussion über die französische Sprachnorm in der Wallonie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359308