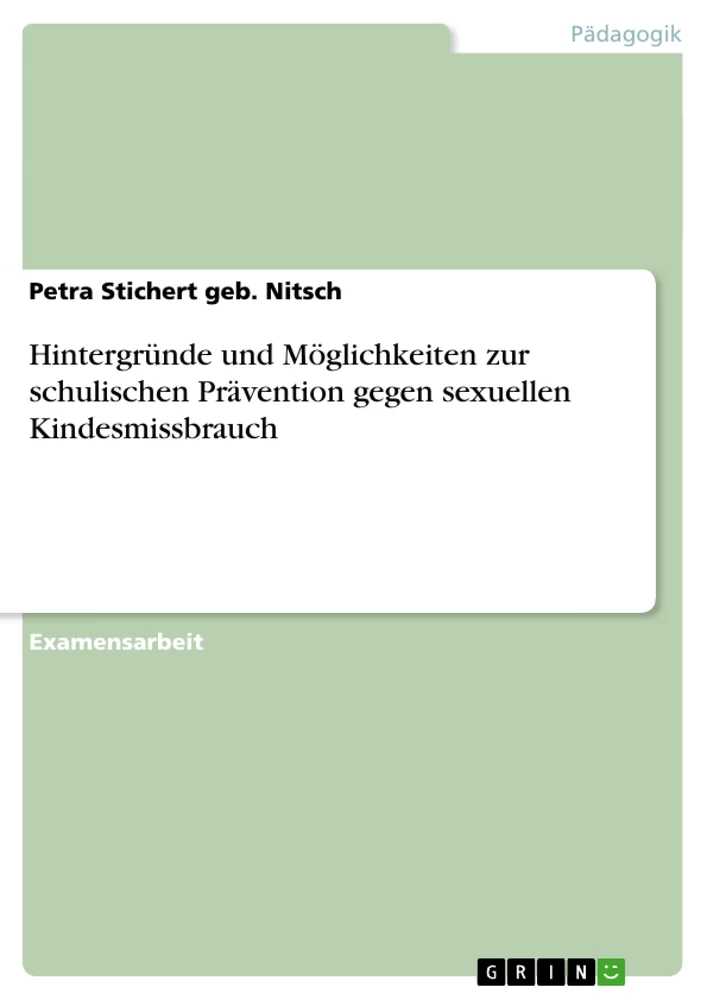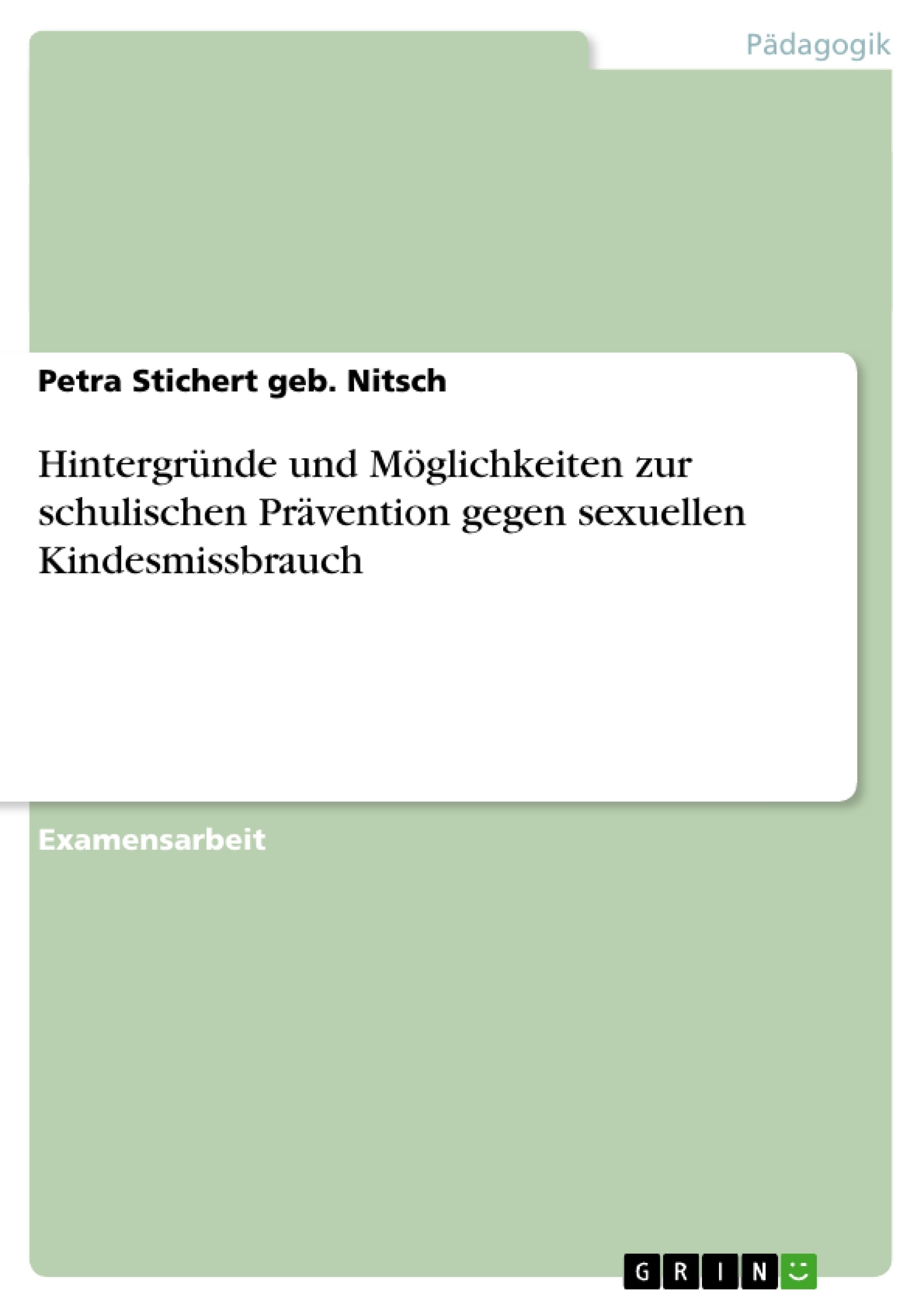Sexueller Kindesmissbrauch ist ein Thema, das im Bewusstsein der Öffentlichkeit zunehmend mehr Raum einnimmt. Dies ist vor allem auf eine umfassende Thematisierung in den Medien zurückzuführen. Als Folgen sind sowohl eine Zunahme bekannt werdender Fälle von Kindesmissbrauch als auch ein wachsendes Verständnis für dessen Auswirkungen auf die Opfer zu beobachten. Die Hochrechnungen über die Häufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch schockieren ebenso wie die Intensität und Vielzahl seiner Folgen, weisen beide doch deutlich auf ein grundlegendes, gesellschaftliches Problem hin. Dennoch lassen effiziente Maßnahmen zur Reduzierung von Kindesmissbrauch auf sich warten, denn die Unsicherheit im Umgang mit diesem Thema ist groß: Zu viele Ängste, zu tiefgreifende gesellschaftliche Probleme, zu verwurzelte Tabus werden hier angesprochen. Zudem unterliegt sexueller Missbrauch in der Regel einer so wirkungsvollen Geheimhaltung, dass nicht einmal annähernd realistische Datenerhebungen und Untersuchungen durchführbar sind. Diese fordert unsere Gesellschaft jedoch als Voraussetzung für umfassende Veränderungen. Viele Ansätze, sexuellem Kindesmissbrauch entgegenzuwirken, scheitern deshalb an den Schwierigkeiten, die notwendige institutionelle, rechtliche oder finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ein Umdenken wäre hier erforderlich.
Seit einiger Zeit wird eine gangbare Alternative in der präventiven Arbeit gegen sexuellen Kindesmissbrauch gesehen. Idealerweise soll diese umfassend wirken und früh genug ansetzen, um Kindesmissbrauch gar nicht geschehen zu lassen. In der Praxis zeigen sich jedoch auch hier viele Probleme. So sind beispielsweise Inhalt, Methoden und Effizienz derzeitiger Präventionsarbeit kaum erforscht und dementsprechend umstritten. Ein weiteres Defizit liegt in der mangelnden Abstimmung einzelner präventiver Maßnahmen aufeinander. Zudem ist auch die wichtigste Voraussetzung für eine sinnvolle Präventionsarbeit noch nicht ausreichend gegeben: eine Sensibilisierung für die Erlebniswelt der Opfer und TäterInnen, die zur Tat führt bzw. aus dieser resultiert.
Eine Annäherung an diese Erlebniswelt sowie die Entwicklung eines hierauf aufbauenden Präventionskonzepts sind die Ziele dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Sexueller Mißbrauch von Kindern
- 2.1. Definitionen und Daten
- 2.2. Die Thematisierung von Kindesmißbrauch in der Öffentlichkeit
- 2.3. Gesellschaftsprofil
- 2.4. TäterInnenprofile
- 2.4.1. Tätermotiv: Macht
- 2.4.2. Tätermotiv: Einsamkeit
- 2.4.3. TäterInnenmotiv: Pädophilie
- 2.4.4. Frauen als Täterinnen
- 2.5. Opferprofile
- 2.5.1. Vertrauensverlust und Lähmung durch Widersprüche
- 2.5.2. Überlebensstrategien
- 2.5.3. Relevante Aspekte für das Ausmaß der Schädigung
- 2.5.4. Symptome
- 2.5.5. Familienstrukturen der Opfer
- 2.5.6. Jungen als Opfer
- 3. Mißbrauchsprävention
- 3.1. Theoretische Ansätze
- 3.2. Schulische Präventionsarbeit: Möglichkeiten und Probleme
- 3.3. Initiativen zur schulischen Präventionsarbeit
- 3.4. Ein Konzept zur schulischen Präventionsarbeit: Eltern aufklären - LehrerInnen fortbilden - Kinder stärken
- 3.4.1. Langfristige Forderungen
- 3.4.2. Organisation
- 3.4.3. Eltern aufklären
- 3.4.4. LehrerInnen fortbilden
- 3.4.5. Kinder stärken
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Hintergründe und Möglichkeiten der schulischen Präventionsarbeit gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Sie beleuchtet die Problematik des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Kontext der Gesellschaft und beleuchtet Täter- und Opferprofile. Die Arbeit konzentriert sich auf die Möglichkeiten der schulischen Präventionsarbeit und diskutiert verschiedene theoretische Ansätze, bestehende Initiativen sowie ein eigenes Konzept zur Stärkung von Kindern, Aufklärung von Eltern und Fortbildung von Lehrkräften.
- Definition und Ausmaß des sexuellen Kindesmissbrauchs
- Täter- und Opferprofile
- Theoretische Ansätze zur Präventionsarbeit
- Möglichkeiten und Herausforderungen der schulischen Präventionsarbeit
- Entwicklung eines Konzepts zur schulischen Präventionsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Sexueller Missbrauch von Kindern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des sexuellen Kindesmissbrauchs, statistischen Daten, der öffentlichen Wahrnehmung des Themas und der Analyse von Täter- und Opferprofilen. Es werden die verschiedenen Motive von Tätern beleuchtet und auf das besondere Problem der weiblichen Täterschaft eingegangen. Außerdem werden die Folgen von Missbrauch für die Opfer, wie Vertrauensverlust, Überlebensstrategien und Symptome, sowie die Familienstrukturen der Opfer und die besondere Situation von Jungen als Opfer beschrieben.
- Kapitel 3: Mißbrauchsprävention: Dieses Kapitel erörtert verschiedene theoretische Ansätze der Missbrauchsprävention. Es untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der schulischen Präventionsarbeit sowie verschiedene Initiativen, die sich diesem Thema widmen. Schließlich präsentiert es ein Konzept zur schulischen Präventionsarbeit, das auf die drei Säulen der Aufklärung von Eltern, der Fortbildung von Lehrkräften und der Stärkung von Kindern setzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche sexueller Kindesmissbrauch, Präventionsarbeit, Täter- und Opferprofile, Schulische Präventionsarbeit, Aufklärung von Eltern, Fortbildung von Lehrkräften und Stärkung von Kindern. Wichtige Aspekte sind die Definition und das Ausmaß des Missbrauchs, sowie die Analyse der Motive von Tätern und die Folgen für die Opfer.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist schulische Prävention gegen Kindesmissbrauch so wichtig?
Schulen erreichen fast alle Kinder frühzeitig und bieten einen Raum, in dem durch Sensibilisierung und Stärkung des Selbstbewusstseins Missbrauch verhindert oder frühzeitig erkannt werden kann.
Welche Täterprofile werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit beleuchtet Motive wie Macht, Einsamkeit und Pädophilie und geht zudem auf das oft tabuisierte Thema der weiblichen Täterschaft ein.
Welche Folgen hat sexueller Missbrauch für die Opfer?
Häufige Folgen sind massiver Vertrauensverlust, Lähmung durch widersprüchliche Gefühle gegenüber Bezugspersonen sowie verschiedene psychische und psychosomatische Symptome.
Wie sieht das vorgestellte Präventionskonzept aus?
Das Konzept basiert auf drei Säulen: Aufklärung der Eltern, Fortbildung der Lehrkräfte und die direkte Stärkung der Kinder ("Kinder stärken").
Welche Probleme gibt es bei der aktuellen Präventionsarbeit?
Oft mangelt es an finanzieller Unterstützung, wissenschaftlicher Erforschung der Methoden sowie an einer ausreichenden Sensibilisierung für die Erlebniswelt der Opfer.
Werden auch Jungen als Opfer thematisiert?
Ja, die Arbeit geht explizit auf die besondere Situation von Jungen als Opfer ein, die oft mit zusätzlichen gesellschaftlichen Tabus konfrontiert sind.
- Arbeit zitieren
- Petra Stichert geb. Nitsch (Autor:in), 2000, Hintergründe und Möglichkeiten zur schulischen Prävention gegen sexuellen Kindesmissbrauch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35938